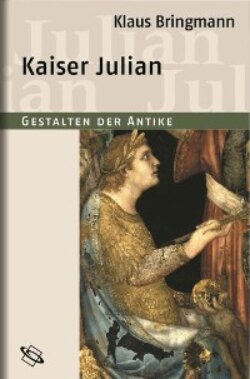Читать книгу Kaiser Julian - Klaus Bringmann - Страница 10
I. Kindheit und Jugend 1. Familie und Kindheit
ОглавлениеDer spätere Kaiser Julian, mit vollem Namen Flavius Claudius Julianus, wurde wahrscheinlich im Mai/Juni des Jahres 331 in Konstantinopel, dem von Kaiser Konstantin ein Jahr zuvor zur zweiten Reichshauptstadt erhobenen Byzanz, geboren.1 Sein Vater Iulius Constantius war ein Halbbruder des Kaisers und stammte aus der Ehe, die ihr gemeinsamer Vater Constantius I. Chlorus mit Theodora, der Stieftochter des den Westen des Reiches regierenden Kaisers Maximian, eingegangen war, bevor dieser ihn am 1. März 293 mit dem Titel Caesar zum Unterkaiser und präsumtiven Nachfolger erhob. Julians Mutter Basilina, die schon wenige Monate nach seiner Geburt starb, stammte aus einer vornehmen Familie aus dem griechischen Osten des Reiches. Ihr Vater Julius Julianus diente von 315 bis 324 dem Kaiser Licinius als Praetorianerpraefekt des Orients, das heißt als ranghöchster Beamter der zivilen Administration im Ostteil des Reiches. In die Katastrophe des Licinius wurde er nicht verwickelt. Als Konstantin im Jahre 324 seinen Rivalen besiegt hatte, ehrte er Julius Julianus wegen seiner vorbildlichen Verwaltung und belohnte ihn mit einem Konsulat für das Jahr 325.2 Basilina war Iulius Constantius’ zweite Frau. Aus seiner ersten Ehe mit Galla, der Schwester zweier späterer Konsuln,3 waren eine Tochter und zwei Söhne hervorgegangen. Der ältere, der schon früh verstarb, bleibt für uns namenlos und schemenhaft, der jüngere, der im Jahre 325 oder 326 geborene Constantius Gallus, teilte mit seinem Halbbruder Julian das schwere Schicksal einer gefährdeten und bedrohten Kindheit.
Die Zugehörigkeit zur konstantinischen Dynastie bedeutete die Chance des Aufstiegs zur Kaiserwürde und zugleich latente Lebensgefahr. Es war Kaiser Konstantin, der das von Diokletian geschaffene System der Tetrarchie, eines aus zwei Oberkaisern, die den Titel Augustus führten, und zwei Unterkaisern, die Caesares genannt wurden, bestehenden Kollegiums, zum Einsturz brachte und eine neue Familiendynastie begründete. Das tetrarchische System war dazu bestimmt, die ständige Gefahr von Kaiserusurpationen und Bürgerkriegen, durch die die so genannte Soldatenkaiserzeit des dritten Jahrhunderts gekennzeichnet war, durch die Präsenz legitimer Ober- und Unterkaiser in den großen Militärbezirken des Reiches zu minimieren und eine funktionierende Nachfolgeregelung zu schaffen. Aber dieses System war von Anfang an mit einem schwerwiegenden Konstruktionsfehler behaftet. Es war vorgesehen, dass sich die Kaiserwürde nicht von dem Vater auf den Sohn vererbte, sondern dass durch gleichzeitigen Rücktritt der beiden Augusti die Caesares zu ihren Nachfolgern aufrückten und diese dann ihrerseits das Viererkollegium durch Berufung von zwei Unterkaisern aus dem Kreis der jüngeren Offiziere wieder vervollständigten. Tatsächlich bewirkte die Autorität Diokletians, dass am 1. Mai 305 der Übergang von der ersten zur zweiten Tetrarchie wie vorgesehen vollzogen werden konnte. Aber als der zum Augustus des Westens aufgerückte Constantius I. Chlorus bereits am 25. Juli 306 unerwartet in Eburacum (York) in Britannien starb, zerbrach die kunstvoll ausgeklügelte tetrarchische Ordnung an der natürlichen Macht des dynastischen Prinzips. Die Armee in Britannien rief Konstantin, der sich im Feldlager seines Vaters befand, zum Augustus aus, und damit begann eine Kette von Kompromissen und kriegerischen Konflikten, an deren Ende Konstantin im Jahre 324 die Alleinherrschaft errang und eine neue Familiendynastie begründete.
Konstantin entstammte der Verbindung seines Vaters mit Helena, einer Frau niederer Herkunft, von der dieser sich trennte, als er um das Jahr 289 die Ehe mit Theodora, der Stieftochter des Kaisers Maximian, einging. Aus dieser zweiten Ehe gingen insgesamt sechs Kinder hervor, drei Töchter und drei Söhne, diese mit Namen Flavius Dalmatius, Flavius Iulius Constantius, der Vater Julians, und Flavius Hannibalianus. Diese jüngeren Halbbrüder stellten für den aus einer eher anrüchigen Verbindung, einem Konkubinat, hervorgegangenen Konstantin eine latente Bedrohung dar; denn sie konnten mit besserem Recht den dynastischen Anspruch auf das Erbe ihres Vaters erheben. Kaiser Konstantin war denn auch vorsichtig genug, dafür zu sorgen, dass seine Halbbrüder während der Zeit seines Aufstiegs zur Alleinherrschaft den Zentren der Macht fern gehalten wurden. Julians Vater lebte, so erfahren wir, lange Zeit in einer Art Exil, zuerst in Tolosa (Toulouse), dann in Korinth.4 Julians Vettern, Dalmatius und Hannibalianus, die Söhne des Flavius Dalmatius, erhielten ihre Schulbildung ebenfalls in Tolosa bei dem bekannten Rhetor Exsuperius.5 Konstantin verfolgte seine dynastischen Pläne zunächst nur mit den eigenen Söhnen. Noch während er zusammen mit Licinius eine Doppelherrschaft im Reich ausübte, einigten sich beide Kaiser darauf, ihre Söhne zu präsumtiven Nachfolgern zu erheben. Am 1. März 317 wurden der Sohn des Licinius und die beiden ältesten des Konstantin, Crispus, geboren um 300, und Constantinus (II.), geboren am 7. August 316, in Serdica (Sofia) zu Caesares proklamiert.6 Nach Konstantins Sieg über Licinius folgte am 8. November 324 zunächst Constantius (II.), geboren am 7. August 317,7 und nachdem der aus einer nichtehelichen Verbindung seines Vaters stammende Crispus im Jahre 326 wegen angeblichen Ehebruchs mit der Kaiserin Fausta hingerichtet worden war, wurde auch noch der jüngste Sohn, Constans (I.) am 25. Dezember 333 zum Caesar erhoben.8 Aber nachdem Konstantin am 25. Juli 335 sein dreißigjähriges Regierungsjubiläum gefeiert hatte, bezog er auch die Abkömmlinge aus der Ehe seines Vaters mit Theodora in die dynastische Herrschaftsordnung seines Hauses mit ein. Er erhob Flavius Dalmatius, den Sohn seines gleichnamigen Halbbruders, am 18. September 335 in die Würde eines Caesars und wies ihm als Verwaltungssprengel Thrakien mit Konstantinopel sowie Makedonien und Griechenland zu,9 dessen Bruder Hannibalianus empfing den Königstitel mit der Bestimmung, die Klientelkönige und -stämme an der Ostgrenze des Reiches, von den Abhängen des Kaukasus bis hin zu den transtigrinitanischen Gebieten östlich des Zweistromlandes, stärker in die römische Herrschaftsordnung einzubinden und so die strategische Position Roms an der Grenze zum Sasanidenreich zu festigen.10 Auch Julians Vater kam in die Nähe des kaiserlichen Machtzentrums: Er wurde zum patricius erhoben und erhielt den Konsulat für das Jahr 335.11 Sein Bruder Flavius Dalmatius hatte sich bereits vorher in verschiedenen zivilen und militärischen Funktionen bewähren können und war im Jahre 333 mit den Ehrentiteln eines Zensors und Konsuls belohnt worden.12
Die Kaiser der ersten Tetrarchie. Porphyrgruppe in San Marco, Venedig
Die neue Herrschaftsordnung war kaum etabliert, als Kaiser Konstantin auf dem Weg zur Eröffnung des Krieges gegen die Perser am 22. Mai 337 in der Nähe von Nikomedeia in Bithynien eines unerwarteten Todes starb. Die vier Caesares waren jung (zwischen 17 und 21 Jahren alt), keiner besaß die Autorität, die der Vater besessen hatte, und wer von ihnen die Stellung eines Oberkaisers bekleiden sollte, war völlig offen. Keiner wagte es, sich zum Augustus ausrufen zu lassen. In dieser ungeklärten Lage schlug sich Julians Vater auf die Seite seiner Neffen, des Caesars Dalmatius und des „Königs“ Hannibalianus. Es heißt, dass er in Konstantinopel mit ihnen die Macht teilte.13 Aber er hatte nicht mit der Haltung der Armee des Constantius gerechnet, dem der gesamte asiatische Teil des Reiches einschließlich Ägyptens als Amtssprengel zugefallen war. Am 9. September 337 riefen die Soldaten die drei Söhne Konstantins des Großen zu Augusti aus,14 und spätestens zu Beginn des folgenden Jahres liquidierten sie neben anderen Würdenträgern den Vater Julians und dessen Neffen Flavius Dalmatius und Hannibalianus.15 Julians Halbbruder Gallus wurde verschont, weil er, wie es schien, auf den Tod erkrankt darniederlag, und der kaum siebenjährige Julian entging dem Gemetzel, weil die Soldateska mit dem verstörten Kind doch Mitleid empfand.16 Nutznießer der Mordtat waren die Söhne Konstantins, zunächst und in erster Linie Constantius II., und so liegt die Annahme nahe, dass er den Mord angestiftet hat. Julian zumindest hat ihn später offen der Tat beschuldigt.17 Andere Gewährsleute sind mit der Schuldzuweisung vorsichtiger.18 Aber gegen Constantius spricht nicht nur der Gesichtspunkt des cui bono, sondern auch die Tatsache, dass er die Morde faktisch billigte und sanktionierte. Eine Untersuchung der Vorgänge unterblieb, die Soldaten, die das Gemetzel verübt hatten, blieben unbestraft, und das Vermögen der Ermordeten zog Constantius ein, als seien sie rechtmäßig verurteilte Verbrecher.19 Julian und sein Halbbruder Gallus, der wider Erwarten genas, verloren nicht nur ihren Vater, sondern wurden auch um ihr väterliches Erbe gebracht.
Kopf der Kolossalstatue Konstantins des Großen. Rom, Palazzo dei Conservatori
Eine weitere Folge der Katastrophe war die Trennung der beiden Halbbrüder. Gallus wurde zur weiteren Schulausbildung nach Ephesos verbracht, Julian war noch so jung, dass er unter die Vormundschaft eines entfernten Verwandten seiner Mutter, des Bischofs Eusebios von Nikomedeia, gegeben wurde. Dieser war ein einflussreicher und umtriebiger Kirchenpolitiker, der in den dogmatischen Streitigkeiten, die um die Person und die Lehre des Presbyters Arius ausgetragen wurden, auf dessen Seite stand und sich im Kampf gegen den großen Gegner der Arianer, den Bischof Athanasios von Alexandreia, hervortat.20 Eusebios hatte Kaiser Konstantin auf dem Totenbett das Sakrament der Taufe gespendet und unter seinem Sohn Constantius, dem neuen Augustus des Ostreiches, gelangte er im Jahre 338 oder 339 mit der Erhebung auf den Bischofsstuhl von Konstantinopel in eine der Schlüsselstellungen der damaligen Kirchenpolitik. Der viel beschäftigte Kirchenfürst überließ die Erziehung seines Mündels einem Eunuchen namens Mardonios, der bereits bei der Erziehung der Mutter Julians die Stellung des Hauslehrers, des paidagogos, versehen hatte.21 Dieser Mardonios, seiner Herkunft nach, wie Julian sich später ausdrückte, ein Skythe, das heißt, nach dem Sprachgebrauch der Zeit zu urteilen, ein Gote, war wie die Familie, der er diente, christlichen Glaubens. Aber die Bildung, die er seinen Zöglingen vermittelte, war wie damals üblich an den großen griechischen Dichtern der heidnischen Vergangenheit ausgerichtet. Nicht die Bibel, sondern Homer und Hesiod waren die prägenden Bildungserlebnisse des Kindes, dessen Muttersprache das Griechische war.
Mardonios war offenbar ein Lehrer, der es verstand, seine Begeisterung für Homer und die Welt der klassischen Literatur auf seinen Schüler zu übertragen. Zeitlebens verfügte Julian über eine souveräne Beherrschung der homerischen Gedichte, und es gibt kaum einen antiken Autor, der so wie er seine Werke mit Zitaten und Anspielungen, die diesem Dichter entlehnt sind, überschüttet hat. Julian hat nach anfänglicher Auflehnung gegen die Strenge der Erziehungsprinzipien, denen er durch Mardonios unterworfen wurde, niemals aufgehört, seinen ersten Lehrer zu lieben. Im Jahre 359 verglich er die Gefühle, die er bei dem erzwungenen Abschied von einem ihm nahe stehenden Freund empfand, mit dem Schmerz, der ihn als Kind bei der Trennung von Mardonios getroffen hatte: „Als ich mich selbst prüfte, wie ich deine Abreise ertrage und ertragen werde, da empfand ich den gleichen Schmerz wie den, als ich zum ersten Mal meinen Lehrer bei uns zu Hause zurücklassen musste.“22 Mardonios hat die ihm gestellte Erziehungsaufgabe nicht auf die Routine bloßer Wissensvermittlung beschränkt, sondern er wollte in seinem Schüler Begeisterung für die Welt Homers wecken. Er besaß auch so viel Einsicht und Vorsicht, dass er Julian, gefährdet wie das Kind wegen seiner Herkunft war, nicht für die Stellung eines künftigen Kaisers erzog, sondern für das äußerlich bescheidene und zurückgezogene Leben eines Privatmannes, der innerlich darauf vorbereitet war, seine Erfüllung im Umgang mit der klassischen Dichtung und Philosophie der Griechen zu finden. In diesem Sinne hat Julian in einer seiner späteren Schriften gewürdigt, was er seinem ersten Lehrer zu verdanken hatte: „Er hat meine Seele geformt und ihr gleichsam die Grundsätze eingemeißelt, die ich damals gar nicht wollte, aber er war mit ganzem Eifer bei der Sache, als vollbringe er etwas besonders Schönes und Wertvolles … Glaubt es mir, bei Zeus und bei den Musen, ich war damals noch ein richtiges Kind, da sagte mein Erzieher oft zu mir ‘Lass dich von der Schar deiner Kameraden, die ständig ins Theater rennen, nicht dazu verleiten, jemals eine Leidenschaft für solche Spektakel zu entwickeln. Möchtest du gern Pferderennen erleben? Bei Homer hast du die spannendste Beschreibung. Nimm nur gleich das Buch zur Hand und lies die Schilderung von Anfang bis Ende. Du hörst die Leute von Pantomimentänzern erzählen? Lass sie ruhig gehen! Bei den Phäaken tanzen die Jünglinge so, wie es sich für Männer eher geziemt. Als Lyraspieler hast du einen Phemios und als Sänger einen Demodokos. Auch Bäume und Pflanzen gibt es bei Homer, von denen zu lesen weit anregender ist als das, was man sehen kann’ …“23 Und mit Bezug auf die Stelle in Platons Gesetzen, an der ein Privatmann, der die Regierung bei der Ahndung von Unrecht nach Kräften unterstützt, zum Sieger im Wetteifer um sittliche Tüchtigkeit (arete) erklärt wird, wird von Mardonios gesagt: „Solche Lehren gab mir mein Erzieher in der Überzeugung, ich würde ein einfacher Privatmann bleiben.“24
Mardonios’ Appell an die Fantasie seines Schülers, das bei Homer Gelesene in lebendige Vorstellung umzusetzen, traf bei Julian auf eine Empfänglichkeit, die sich aus der Sensibilität für die Schönheit der vom Sonnenlicht des Tages und vom Sternenhimmel der Nacht erleuchteten mediterranen Natur speiste. Dies war zugleich eine der Wurzeln seiner tiefen Religiosität. Später hat er zu Beginn seiner Abhandlung auf König Helios, den Sonnengott, von diesem Zusammenhang Zeugnis abgelegt: „Schon von Kindheit erfüllte mich eine Sehnsucht nach dem Glanz des göttlichen Sonnenlichts, und von meinen frühesten Jahren an war mein Sinn so ausschließlich erfüllt von dem Himmelslicht, dass ich nicht nur am Tag die Sonne immer im Blick hatte, sondern auch wenn ich nachts einmal bei wolkenlosem und klarem Wetter unterwegs war, ich alles gänzlich beiseite ließ und mein Augenmerk auf die Schönheiten des Himmels richtete und dabei nicht verstand, wenn einer zu mir etwas sagte und ich selbst nicht darauf achtete, was ich tat.“25 Der Kosmos, die Natur und die Bücher waren nach Julians Selbstzeugnis die Fixpunkte, die bereits dem Leben des sensiblen Kindes inneren Halt gaben. Aus dem Erbe seiner Großmutter mütterlicherseits, das ihm erhalten geblieben war, besaß er ein kleines Landgut am Marmarameer mit Blick auf die Prinzeninseln und Konstantinopel. Als er später in der Zeit, in der er als Mitregent Gallien regierte (355–360), diesen Besitz dem Rhetor Euagrios schenkte, da beschrieb er den Platz in liebevoller Erinnerung an die Besuche, die er dort zur Zeit der Schulferien im Sommer gemacht hatte, mit den folgenden schönen Worten: „Wenn du vom Gehöft aus auf einen Hügel steigst, siehst du die Propontis (das Marmarameer) mit den Inseln und die Stadt, die den Namen des edlen Kaisers trägt, vor dir liegen, ohne dass du auf Tang und Seemoos trittst, ohne dass der abstoßende, an Gestade und Strand geschwemmte Unrat, den man nicht einmal beim Namen nennen mag, dich stört, nein, auf Smilax tritt dein Fuß, auf Thymian und duftende Gräser. Tiefe Stille herrscht rings um den Ort, wenn du dich niederlässt, um in ein Buch zu sehen. Willst du dazwischen einmal dein Auge ausruhen lassen, so ist es überaus wohltuend, auf die Schiffe und das Meer hinauszuschauen. In meinen Kinderjahren erschien mir das als der liebste Sommeraufent-halt. Der Platz hat auch ausgezeichnete Quellen und ein recht ansprechendes Bad, einen Garten und Bäume. Als Erwachsener habe ich mich dann manches Mal nach jenem Aufenthalt von einst zurückgesehnt, und oft kam ich dahin zurück: Nie blieb unsere Wiederbegegnung ohne die Lektüre von Büchern.“26
Julian lebte unter Aufsicht seines Hauslehrers am Hof des Bischofs, zuerst kurze Zeit in Nikomedeia, dann, seit dem Jahre 338 oder 339, in Konstantinopel. Dort besuchte er auch zusammen mit anderen Kindern die Schule eines privaten Lehrers. Dem damaligen Bildungskonzept entsprechend war der Unterricht dazu bestimmt, die Schüler durch Lektüre und Redeübungen zu der Fähigkeit zu erziehen, fremde und eigene Gedanken sprachlich korrekt, wohldisponiert und in schöner, wirkungsvoller Formulierung auszudrücken, und sie so auf die Höhe der anspruchsvollen rhetorischen Kultur der Spätantike zu heben. Der berühmte Rhetor Libanios, der später in der Zeit der Alleinherrschaft Julians in enge Beziehung zu ihm trat, sah ihn in der Zeit seines ersten Aufenthalts in Konstantinopel (etwa von 340 bis 342) zum ersten Mal, wie er, von einem interessierten Publikum beobachtet, von Mardonios zur Schule geleitet wurde, und er bedauerte, dass es die Schule eines Konkurrenten war, in die der begabte Zögling ging.27 Doch schon im Jahre 342 war Julians Schulzeit zu Ende. Der Bischof Eusebios, Julians Vormund, starb in diesem Jahr, und Kaiser Constantius war durch seine Spione wohl unterrichtet von der Aufmerksamkeit, die der heranwachsende Prinz aus der Nebenlinie seines Hauses in Konstantinopel erregte. So beschloss er, ihn zusammen mit seinem Halbbruder aus dem Blickfeld der interessierten Öffentlichkeit zu entfernen. Er verfügte, dass Julian und Gallus in dem abgelegenen Kappadokien im östlichen Kleinasien auf dem kaiserlichen Landgut Macellum Aufenthalt nehmen sollten.