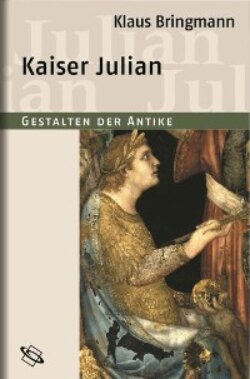Читать книгу Kaiser Julian - Klaus Bringmann - Страница 12
3. Studienjahre in Kleinasien und Athen
ОглавлениеAls ihm erlaubt wurde, das Macellum zu verlassen, ging Julian zunächst nach Konstantinopel, um in seiner Vaterstadt seine Studien fortzusetzen. Dort hatte er bereits vor der Verbannung nach Kappadokien die Schule des aus Sparta stammenden Grammatikers Nikokles, geleitet von seinem Erzieher Mardonios, in der Basilika besucht.40 Mardonios und Nikokles hatten Julian mit dem Literaturkanon vertraut gemacht, der die Grundlage der allgemeinen Bildung und die Voraussetzung des Studiums der Rhetorik bildete. Auf dem Macellum hatte Julian die dort verbrachte Zeit zu einem ausgiebigen Selbststudium genutzt, aber an dem einsamen Ort blieb ihm wohl die Möglichkeit verschlossen, seine Ausbildung zur Beherrschung der Rede in Wort und Schrift durch den üblichen mehrjährigen Unterricht bei prominenten Lehrern der Rhetorik zu vollenden. Als er dann das Macellum verlassen durfte, stimmte Constantius dem Wunsch Julians nach Fortsetzung seiner Studien zu; denn es war ihm angeblich recht, so erfahren wir, dass sich sein Vetter mit Büchern und Studieren abgab und so nicht in die Versuchung kam, aus seiner Herkunft Thronansprüche abzuleiten.41 Dennoch hielt es der Kaiser für sicherer, dass Julian, der durch seine glänzende Begabung und die Fortschritte, die er in der Rhetorik machte, öffentliches Aufsehen in der Hauptstadt erregte, wieder aus Konstantinopel entfernt wurde und mit Hekebolios, seinem christlichen Rhetoriklehrer, in das bithynische Nikomedeia übersiedelte.42 Dort lehrte auch von 344/45 bis 348/49 der aus Antiocheia am Orontes stammende Libanios, der bereits vorher, von 340 bis 342, in Konstantinopel eine Schule unterhalten hatte und während dieser Zeit den jungen Julian zum ersten Mal auf dem Weg zur Schule des Nikokles gesehen hatte. Um Schüler aus vornehmen Familien pflegten alle Lehrer heftig zu konkurrieren, und von dem berühmtesten Hochschulort Athen wird berichtet, dass Lehrer mit ihren Schülern nach dem Piräus und nach Sunion zogen, um Neuankömmlinge, die in Athen studieren wollten, in Empfang zu nehmen und mit mehr oder weniger Gewaltanwendung zum Eintritt in ihre Schule zu nötigen. Dabei kam es zu Ausschreitungen, sodass der Prokonsul von Achaia bei einer dieser Gelegenheiten von Korinth aus eingreifen und die Ruhe wiederherstellen musste.43 Ganz so schlimm war es in Nikomedeia wohl nicht. Immerhin wusste sich Hekebolios auf andere Weise vor der gefürchteten Konkurrenz seines berühmten Rivalen zu sichern. Er nahm Julian den feierlichen Eid ab, niemals Schüler des Libanios zu werden. Aber Julian fand eine Möglichkeit, den Eid zu umgehen. Wohlausgestattet mit Geld, wie er war, veranlasste er einen Mittelsmann durch reiche Geschenke, ihm Mitschriften der von Libanios gehaltenen Kollegs zu besorgen. Libanios behauptete später, dass Julian durch das Nacharbeiten dieser Mitschriften den Stil seines Vorbildes so perfekt nachahmen konnte, dass er allgemein für einen seiner Schüler gehalten wurde.44 Dieses indirekte Schülerverhältnis endete freilich schon mit dem Studienjahr 348/49. Libanios verließ Nikomedeia und nahm einen Ruf nach Konstantinopel an.45
Julian hielt sich denn auch nicht lange mit dem Studium der Rhetorik auf. Um das Jahr 349/50 wandte er sich endgültig der Philosophie zu. Seit Ciceros Zeiten war es nicht unüblich, das Studium der Rhetorik mit dem der Philosophie zu verbinden, aber es war durchaus strittig, ob die Philosophie auf die Rolle einer Dienstmagd der Rhetorik zu beschränken oder ob sie als die eigentliche Leitwissenschaft jeder höheren Bildung zu betrachten sei. Während die Rhetoren der Philosophie allenfalls eine propädeutische Funktion bei der Ausbildung zum Redner zubilligen wollten, erhoben die Philosophen nicht nur den Anspruch, die besseren Lehrer der Redekunst durch Unterweisung in Dialektik und Rhetorik zu sein, sondern vor allem eine umfassende Welterklärung zu geben und den Weg zum guten Leben zu weisen, das heißt zu einem Leben, das in Harmonie mit der natürlichen Bestimmung des Menschen stehe. Julian gehörte nicht zu denen, die in der Philosophie die Magd der Rhetorik sahen. Im Jahre 359 wies er zwei ehemalige Mitstudenten ab, die sich anboten, zu ihm nach Gallien zu kommen, und schrieb ihnen ins Stammbuch, dass es für sie besser sei, in Athen zu studieren, freilich so, dass dabei der Philosophie der Vorrang gegeben werde: „Verachtet die Redeübungen nicht, vernachlässigt nicht die Rhetorik und die Beschäftigung mit den Dichtern. Auch den exakten Wissenschaften gelte ein intensiveres Studium: Euer ganzes Streben aber richte sich auf die Kenntnis der Lehren des Aristoteles und des Platon. Das soll die Aufgabe sein, dies das Fundament, das Mauerwerk, das Dach. Die anderen Disziplinen müssen Nebenwerk bleiben, wenn sie auch von euch mit größerer Mühe bedacht werden als von manchen die eigentliche Aufgabe.“46
Die Richtung der Philosophie, die im vierten Jahrhundert zur unbestrittenen Herrschaft gelangt war, war der so genannte Neuplatonismus, und der Philosoph, der zur Zeit Julians durch seine Schüler den größten Einfluss ausübte, war der um 330 verstorbene Jamblichos aus dem syrischen Chalkis.47 Sein bedeutendster Schüler war der aus Kappadokien stammende Aidesios, der nach dem Tod des Meisters dessen Schüler übernahm und schließlich, nach einem Zwischenaufenthalt in Kappadokien, in Pergamon eine neuplatonische Philosophenschule begründete.48 Ihm wollte sich Julian anschließen, aber Aidesios zog es aus Altersgründen vor, die philosophische Ausbildung seines prominentesten Studenten seinen Schülern Chrysanthios und Eusebios von Myndos zu übertragen.49 In Pergamon wurde Julian für die Philosophie des Jamblichos für immer gewonnen, und er erkannte ihm den gleichen Rang zu wie Platon und Pythagoras, die als die großen Archegeten der neuplatonischen Philosophie verehrt wurden. Im Jahre 358 schrieb er aus Gallien an den Philosophen Priscus, den er im Spätsommer 355 in Athen kennen gelernt hatte, einen Brief, in dem er seiner Begeisterung für Jamblichos Ausdruck gibt: „Besorge mir alles, was Jamblichos über meinen Namensvetter geschrieben hat; du allein vermagst das, denn der Schwiegersohn deiner Schwester besitzt ein sorgfältig berichtigtes Exemplar … Ich bitte dich inständig, lass die Theodoreer nicht auch deine Ohren betäuben mit ihrem Geschrei, Jamblichos, der wahrhaft göttliche, der dritte Große nach Pythagoras und Platon, sei bloß ein Ehrgeizling gewesen. Wenn es vermessen ist, dir gegenüber die eigene Meinung in einer Weise kundzutun, wie sie den Enthusiasten eigen ist, so ist Nachsicht doch nicht fehl am Platz. Für meine eigene Person bin ich in der Philosophie von Jamblichos, in der Theosophie von meinem Namensvetter fasziniert; von den Übrigen glaube ich, um mit Apollodoros zu sprechen, dass sie im Vergleich mit diesen beiden überhaupt nichts bedeuten.“50
Julian nennt Jamblichos in einem Atemzug mit seinem Namensvetter Julianus, auf dessen Chaldäische Orakel Jamblichos in seinem Werk De mysteriis ausführlich eingegangen war, und er erkennt diesem Julianus in der Theosophie, dem Wissen von den Göttern einen ebenso hohen Rang zu wie Jamblichos in der Philosophie. Bei Julianus handelt es sich genau genommen um zwei Personen, Vater und Sohn gleichen Namens, die im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebten. Angeblich schrieben sie die Chaldäischen Orakel nach dem Diktat der Orakelgötter Hekate und Apollon auf.51 Der Sohn war zur Zeit Marc Aurels einer der großen Wundermänner; er begleitete den Kaiser auf seinen Feldzügen und galt als Urheber des viel beredeten Regenwunders, welches das römische Heer vor dem Verdursten gerettet hatte.52 Nach einer anderen Legende wetteiferte er mit Apollonios von Tyana und Apuleius, ebenfalls berühmten Wundertätern, um Rom von der grassierenden Pest zu befreien, und trug dabei den Sieg über seine Konkurrenten davon, indem er die Seuche mit einem einzigen Wort zum Stillstand brachte. Vater und Sohn vermochten, so wird überliefert, auch mit den Geistern der Toten zu kommunizieren, und angeblich beschwor der ältere Julianus die Seele Platons und machte sie mit seinem Sohn bekannt. Mit anderen Worten: Vater und Sohn verfügten über übernatürliche Kräfte, und sie taten Wunder kraft göttlicher Ermächtigung. Dies war Theurgie, zu Deutsch: das Wirken aus göttlicher Kraft, das, wie es hieß, auf der Wissenschaft von den Göttern, der Theosophie, beruhte. Die genannten Gottesmänner waren das heidnische Gegenstück zu Jesus und den Heiligen, die ebenfalls Wunder kraft göttlicher Ermächtigung wirkten. Theosophie und Theurgie waren, so muss betont werden, keineswegs auf kleine Konventikel abseitiger Esoteriker beschränkt, und es war auch keineswegs so, dass magische Praktiken, Träume, Vorzeichen und Astrologie zwar ihren festen Sitz im Leben hatten, aber von den Gebildeten mit Geringschätzung betrachtet und von der Philosophie verworfen worden wären. Die Zeiten, in denen die Akademie, die Schule Platons, die Götter- und Vorzeichenlehre der Stoiker einer kritischen Prüfung unterzogen hatte, waren längst vorüber. Die Neuplatoniker und insbesondere Jamblichos hatten ein enges Band zwischen Philosophie, Theosophie und Theurgie geknüpft, und in dieser Gedankenwelt fand Julian seine geistige Heimat.53
Das heißt freilich nicht, dass die Philosophie des Neuplatonismus durch das Wirken des Jamblichos und seiner Schüler in einem, wie es dem heutigen Betrachter erscheinen muss, erschreckenden Obskurantismus vollständig aufgegangen wäre. Auch sie verstanden sich, ebenso wie ihre Vorgänger und Nachfolger, in erster Linie als Ausleger der Texte eines Platon und Aristoteles. Anhand dieser Texte vollzog sich der philosophische Unterricht, und diese mündliche Unterweisung in Gestalt der Interpretation der Klassiker fand ihren literarischen Niederschlag in den zahlreichen Paraphrasen und Kommentaren der Neuplatoniker zu den Werken der alten Meisterdenker. Porphyrios, der Lehrer und Vorgänger des Jamblichos, hatte an den Anfang des Philosophiestudiums eine Einführung in die Philosophie des Aristoteles mittels ausgewählter Schriften zur Dialektik gestellt; dann folgte das Kernstück des Curriculums, die Erläuterung platonischer Dialoge, insbesondere jener, die die Grundlage der neuplatonischen Welterklärung bildeten: Timaios und Politeia, Parmenides und Phaidros, gelegentlich auch Phaidon, Philebos und Alkibiades I. Ihrem eigenen Philosophieren legten die Neuplatoniker die platonische Unterscheidung einer intellegiblen, unwandelbaren Welt der Ideen, die allein dem Denken zugänglich ist, und einer sinnlich wahrnehmbaren des Werdens und Vergehens zugrunde. Das Problem, um dessen Lösung ihr Denken kreiste, war die Frage, wie beide Welten miteinander zusammenhingen oder genauer: wie das eine aus dem jeweils anderen hervorging. Die komplizierten Einzelheiten der Lösungsversuche, mit denen sie des Problems Herr zu werden versuchten, müssen hier auf sich beruhen. Nur so viel sei hier hervorgehoben: Im Kern bestand der Lösungsversuch in einer Emanationslehre, in der die jeweils höheren Wesenheiten, das Eine, der Geist, die Seele, also die so genannten Hypostasen, die jeweils niederen aus sich entlassen und auf diese Weise zwischen dem Einen oder der Idee des Guten, die den gesamten Weltzusammenhang in sich enthält, und der Vielfalt der Erscheinungen eine unzerreißbare Kette entsteht, in der die niederen mit den höheren Wesenheiten durch Rückbindung verbunden bleiben.
Was nun die Stellung des Menschen in diesem Weltmodell anbelangt, so stand die Frage nach seiner in die niedere Welt der vergänglichen Materie versetzten Seele im Mittelpunkt des Philosophierens. Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, verwies den Menschen auf das diskursive Denken als den Königsweg zur Teilhabe am ewigen Sein der intellegiblen Welt, damit er intellektuell und moralisch der Forderung nach einer Angleichung an Gott nachkomme könne. Der letzte Schritt auf diesem Wege, die völlige Vereinigung des erkennenden Subjekts mit dem Erkannten, das heißt die unmittelbare Anschauung der höchsten Wesenheit des Einen, ist nach seiner Auffassung dem diskursiven Denken versagt. Allenfalls kann dem Weisen, wie Plotin im Anschluss an Platon lehrte, am Ende eines langen Weges angestrengten Denkens und im Vorgriff auf die durch den Tod von der Verbindung mit dem Körper befreite Seele in mystischer Schau der Akt höchster Erkenntnis, die Verschmelzung mit dem Einen, gelingen. Während Plotin diesen letzten Schritt zur Vollkommenheit nicht von der Wirkung kultischer Handlungen oder übernatürlicher Offenbarungen erwartete, sondern als mögliches Ergebnis langer intellektueller Anstrengung angesehen hat, haben seine Nachfolger, insbesondere Jamblichos und die meisten seiner Schüler, das Entscheidende in die Kommunikation mit der übernatürlichen Welt der Götter verlegt. Schon Porphyrios, der gelehrte Schüler und Nachfolger Plotins, hat es nicht verschmäht, sich auf die als göttliche Offenbarung verstandenen Chaldäischen Orakel des Julianus in seinen Werken zu beziehen. Und auf diesem Wege ist Jamblichos weiter vorangeschritten, indem er das Band zwischen neuplatonischer Welterklärung und einer mit der Theosophie verschwisterten Theurgie aufs Engste knüpfte.
Es versteht sich von selbst, dass diese Richtung des philosophischen Denkens vollständig auf dem Boden des Heidentums stand und die Vorstellung einer höchsten Gottheit mit der Verehrung der zahlreichen partikularen Götter der positiven Religionen verband. Wie anhand der späteren theosophischen Schriften Julians noch zu zeigen sein wird, kam auch die hochdifferenzierte Emanationslehre, zu der Jamblichos das neuplatonische Weltmodell ausgebaut hatte, nicht mehr ohne die Annahme eines direkten Eingreifens der Götter aus. Die neuplatonische Philosophie war auf diese Weise zu einer heidnischen Theologie geworden. Angesichts der Ausbreitung, die das Christentum seit dem dritten Jahrhundert und zumal seit seiner Begünstigung durch Kaiser Konstantin vor allem im Ostteil des Römischen Reiches genommen hatte, kann es nicht verwundern, dass die theologische Ausprägung des Neuplatonismus von Anfang an ihre Spitze gegen die neue Religion richtete, die dem traditionellen Polytheismus den Lebensraum zu entziehen drohte. Porphyrios hatte in seinem sechzehn Bücher umfassenden Werk Gegen die Christen mit großem Scharfsinn versucht zu beweisen, dass der Mythos Jesus Christus, soweit er aus dem Neuen und Alten Testament geschöpft ist, historisch unhaltbar ist, und er war wie später auch Julian der schärfste Kritiker des Apostels Paulus, in dem er den Erfinder des Christentums sah.54 Gewiss standen sich Neuplatonismus und Christentum in vielen Punkten sehr nahe, in der religiösen Weltdeutung, in der Ausprägung der Frömmigkeit und in der philosophischen Formensprache der Theologie,55 doch war im aktuellen Bewusstsein beider Seiten das Trennende weitaus stärker als das Verbindende. Vom Standpunkt der Neuplatoniker aus war das Christentum zu verwerfen, weil die Christen sowohl von der jüdischen Mutterreligion als auch von dem als überlegen begriffenen Polytheismus der griechisch-römischen Welt abgefallen waren. Sie wandten ein, dass die Christen an die Stelle der durch uralte Tradition beglaubigten Kulte die Verehrung der Leiche eines unter Kaiser Tiberius gekreuzigten Juden gesetzt hätten. Sie verwarfen die Vorstellung des Johannesevangeliums, dass der göttliche Logos in der Person Jesu Fleisch geworden sei, sowie den Glauben an eine leibliche Auferstehung, und sie belächelten von der Höhe ihres platonischen Weltmodells herab den Schöpfungsbericht des Alten Testaments als ein naives Märchen. Gerade weil sie ebenso wie die Christen von dem Motiv bestimmt waren, sich durch kultische Praxis und religiöse Lebensführung Gott anzugleichen, und sie nach der Vereinigung der Seele mit der Gottheit im Leben nach dem Tode strebten, betonten sie die Unterschiede, die sie trennten. Die neuplatonischen Intellektuellen verharrten auf dem Boden der griechischen Kultur, zu der in ihren Augen die Religion der Väter das eigentliche Kernstück war, und sie bekämpften das Christentum, das sie für eine von Menschen erfundene Afterreligion hielten und in dem sie eine Bedrohung der griechischen Kultur und Religion erblickten. Beide Seiten sahen in Zeichen und Wundern eine Bestätigung der Wahrheit ihrer religiösen Überzeugungen, und dies hat die gegenseitige Feindschaft noch zusätzlich verschärft: Den Heiligen und Märtyrern der Christen traten auf heidnischer Seite die wunderwirkenden Theurgen und Philosophen entgegen.
In Pergamon gehörte Chrysanthios, an den Aidesios Julian verwiesen hatte, zu den Neuplatonikern, die eine philosophische Welterklärung mit der Kultpraxis des Theurgen verknüpften.56 Der andere Schüler des Aidesios, bei dem Julian hörte, Eusebios, lehrte die neuplatonische Philosophie noch in ihrer älteren plotinischen Gestalt, und er hielt daran fest, dass die Seele sich selbst durch das reine Denken erlöst und weder Geisterbeschwörungen noch Mysterienkulte dazu nötig seien. Er pflegte seine Vorlesung mit der Bemerkung zu beenden, „dass die magischen Handlungen nur Täuschung der Sinne und Blendwerk seien, Zaubertricks von Wundertätern und anderen Verführern und Wahnsinnigen, mit Hilfe materieller Kräfte erzeugt“. Julian wollte unbedingt wissen, wem diese Anspielung galt. Chrysanthios ermunterte ihn, Eusebios selbst zu fragen; schließlich fasste sich Julian ein Herz und fragte. Eusebios antwortete, dass Maximus, ein anderer Schüler des Aidesios, der in Ephesos lehrte, gemeint sei. Diesem sei er einmal in das Heiligtum der Hekate gefolgt; dort habe Maximus Weihrauchkörner verbrannt, einen Hymnus angestimmt und ein Wunder bewirkt: Die Statue der Göttin habe gelächelt, und die Fackeln in ihren Händen hätten sich von selbst entzündet. Als Julian das hörte, sprang er auf und rief: „Bleibe du bei deinen Büchern, mir hast du gesagt, was ich wissen wollte“, verabschiedete sich und brach nach Ephesos auf. So erzählt die Geschichte Eunapios von Sardeis in seinen Lebensbeschreibungen der Sophisten.57 In Ephesos wurde Julian ein begeisterter Jünger des Maximus. Dieser war jedoch nicht nur ein wundertätiger Theurg, er war auch nach den Maßstäben der Zeit ein ernsthafter Philosoph, der unter anderem einen Aristoteleskommentar verfasste und als Lehrer eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen zu sein scheint. Von ihm lernte Julian, sich von den Zeichen der Götter lenken zu lassen. In dem oben zitierten Brief an den Philosophen Priscus schreibt er, nachdem er seine Hochschätzung für Jamblichos und Julianus zum Ausdruck gebracht hatte, dass ihm noch während des Schreibens ein göttliches Zeichen zuteil geworden sei. Wir werden sehen, dass Julian in den entscheidenden Punkten seines Lebens immer die Kommunikation mit den Göttern gesucht hat. Die Begegnung mit Maximus war für Julian das eigentliche Bekehrungserlebnis. Er war seitdem ein praktizierender Heide aus neuplatonischem Geist. Ohne Maximus zu nennen, hat Libanios später in der Gedenkrede auf Julian die entscheidenden Momente der Bekehrung so charakterisiert: „Julian wurde durch die Begegnung mit Menschen gerettet, die von Platons Philosophie erfüllt waren; durch sie hörte er von den Göttern und Dämonen, die in Wahrheit das Universum erschaffen haben und erhalten. Von ihnen lernte er das Wesen der Seele, ihre Herkunft und ihre Zukunft erkennen, das Gesetz ihres Sturzes und ihres Aufstiegs, was sie niederzieht und was sie erhöht, was Gefangenschaft und Befreiung für sie bedeutet, wie man die Erstere umgehen und die Letztere erwerben kann. Danach tat er alle Torheiten von sich, an die er bisher geglaubt hatte, um dafür in seiner Seele dem Licht der Wahrheit Raum zu geben, so wie man in einem großen Tempel die früher mit Schmutz besudelten Götterbilder wieder neu aufstellt.“58
Gegen Ende des Jahres 362 hat Julian in einem Brief an das Volk von Alexandreia seine Bekehrung in das Jahr 351 gesetzt,59 und gegen dieses eindeutige Selbstzeugnis kommen moderne Versuche nicht auf, Julian eine langdauernde religiöse Entwicklung zu unterstellen, die erst mit der Gewinnung der Alleinherrschaft im November 361 ihren Endpunkt, das klare Bekenntnis zum Heidentum, erreicht habe.60 Daran ist nur so viel richtig, dass Julian mit Rücksicht auf seinen Vetter, den christlichen Kaiser Constantius, und dessen christliche Umgebung gezwungen war, sein Heidentum vor der Öffentlichkeit zu verbergen. So lange lebte er nach den Worten des Libanios als hellenischer, das heißt heidnischer, Löwe in christlicher Eselshaut.61 Doch angesichts des Umgangs, den er mit den Koryphäen des heidnischen Neuplatonismus pflegte, und vielleicht auch weil Briefe an Gesinnungsfreunde, in denen er sich zu erkennen gab, nicht streng geheim gehalten wurden, konnte es nicht ausbleiben, dass er in Verdacht geriet. Jedenfalls scheint sein Halbbruder Gallus, den Constantius im Jahre 351 zum Caesar des Ostens erhoben hatte, an Julians Treue zum christlichen Glauben gezweifelt zu haben. Gallus schickte seinen engsten theologischen Berater, den aus einfachsten Verhältnissen stammenden Aëtius, der später zum Bischof aufstieg,62 aus Sorge um das Seelenheil seines Bruders zu Julian nach Kleinasien – und empfing beruhigende Nachrichten, sei es nun, dass Julian sich verstellte oder Aëtius es unterließ, den Dingen auf den Grund zu gehen. Julian bezeugte später, dass er in den Jahren, in denen Gallus den Rang eines Caesars bekleidete (351–354), mit Aëtius öfters zusammengetroffen war und er diese Begegnungen in angenehmer Erinnerung hatte.
Dafür gab es wahrscheinlich auch einen sachlichen Grund. Aëtius war der Wortführer des radikalsten Arianismus. Er hing der Lehre an, dass Jesus Gottvater nicht wesensähnlich (homoiousios) sei, wie die von Constantius begünstigte arianische Mehrheitsposition lautete, sondern wesensunähnlich (anhomoiousios). Das bedeutete, dass er das Dogma ablehnte, demzufolge Jesus Christus der inkarnierte göttliche Logos sei, von dem das Johannesevangelium spricht. Eine solche Auffassung kam Julians Überzeugungen immerhin entgegen. Nachdem Gallus im Jahre 354 hingerichtet worden war, schickte Constantius dessen theologischen Berater wegen seines radikalen Standpunkts in die Verbannung nach Phrygien. Und als Julian im November 361 zur Alleinherrschaft gelangt war und alle Bischöfe und Kleriker, die Constantius zur Durchsetzung seines kirchenpolitischen Kurses verbannt hatte, aus dem Exil zurückrief, da gewährte er Aëtius als einzigem der christlichen Kleriker durch kaiserliches Handschreiben eine Vorzugsbehandlung. Er schrieb: „Allen insgesamt, die vom seligen Constantius wegen des Wahnsinns der Galiläer in die Verbannung geschickt worden sind, habe ich die Strafe des Exils erlassen, dir aber erlasse ich sie nicht nur, sondern eingedenk unserer alten Bekanntschaft und Vertrautheit fordere ich dich auf, zu uns zu kommen. Du kannst einen Wagen der Staatspost mit einem zusätzlichen Beipferd benutzen.“63 Der arianische Kirchenhistoriker Philostorgios weiß sogar zu berichten, dass Aëtius zu denen gehörte, die der neue Kaiser reich beschenkte: Er erhielt ein prächtiges Landgut in der Nähe von Mytilene auf Lesbos.64 Ein strenger, lästiger Examinator in Glaubensfragen wird also Aëtius zu der Zeit, in der er als Mittelsmann zwischen Gallus und Julian fungiert hatte, schwerlich gewesen sein.
Kaiser Constantius hatte seine Vettern Gallus und Julian von seinem Hof und von Konstantinopel fern gehalten, und erst der Zusammenbruch des im Jahre 337 errichteten Herrschaftssystems der drei Söhne Konstantins veranlasste ihn, die beiden letzten Mitglieder der Dynastie nacheinander zur Mitherrschaft heranzuziehen. Schon im April 34065 war Constantin II., der Augustus des Westens, im Kampf gegen die Truppen seines Bruders Constans, von dem er vergeblich eine Neuregelung der Territorialverteilung in Europa verlangt hatte, bei Aquileia gefallen. Zehn Jahre später fiel dieser der am 18. Januar 350 erfolgten Usurpation eines germanischen Heermeisters namens Magnentius zum Opfer.66 Wenig später am 1. März wurde Vetranio, der Heermeister des Constans im Illyricum, in Sirmium (dem heutigen Sremska Mitrovica an der Save) ebenfalls von den Truppen zum Augustus ausgerufen.67 Constantius, der an der Ostgrenze in einen langwierigen Krieg gegen die Perser verwickelt war, sah sich gezwungen, nach Westen zu ziehen und den Kampf gegen die Usurpatoren aufzunehmen. Am 25. Dezember 350 gelang es ihm, Vetranio zum Rücktritt zu bewegen,68 und bevor er gegen Magnentius, den Mörder seines Bruders, die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchte, ließ er Gallus an sein Hoflager nach Sirmium kommen und erhob ihn am 15. März 351 zum Caesar des Ostens,69 um der Gefahr vorzubeugen, dass es während seiner Abwesenheit zu einer Usurpation im Orient komme. Constantius überwand in einem blutigen Krieg den Usurpator Magnentius, der am 10. August 353 in Lugdunum (Lyon) Selbstmord beging.70 Er wurde aber noch bis zum Jahr 359 in der europäischen Reichshälfte festgehalten, wo die römische Grenzverteidigung an Rhein und Donau in den Wirren des Bürgerkrieges zusammengebrochen war und erhebliche Anstrengungen zu ihrer Wiederherstellung notwendig waren.71
Im Osten erfüllte der Caesar Gallus die ihm zugedachte Aufgabe keineswegs zur Zufriedenheit des Constantius. Sein zu Heftigkeit und Brutalität neigendes Naturell war der delikaten Aufgabe, die kaiserliche Autorität aufrechtzuerhalten und mit den von Constantius eingesetzten hohen Zivilbeamten und Militärbefehlshabern loyal zusammenzuarbeiten, nicht gewachsen. Er geriet mit der Forderung einer Herabsetzung des Getreidepreises in einen schweren Konflikt mit dem Stadtrat von Antiocheia am Orontes, seiner Residenzstadt, ließ es zu, dass bei den darüber ausbrechenden Unruhen der Statthalter von Syrien zu Tode kam, stellte den Praetorianerpraefekten Domitianus, der ihn in schroffer Weise zur Rückkehr an das Hoflager des Constantius aufforderte, unter militärische Bewachung und ließ schließlich Domitianus und seinen eigenen Quaestor Montius, der vermitteln wollte, durch Soldaten seiner Leibgarde töten, um dann die Freunde der Getöteten mit Hochverratsprozessen zu überziehen.72 Constantius befürchtete eine Usurpation und schritt ein. Unter Vorwänden wurde Gallus an das Hoflager des Augustus beordert und unter Bruch der ihm gegebenen Versprechungen Ende des Jahres 354 auf der Insel Flamona bei Pola in Istrien umgebracht.73
Julian lief Gefahr, in die Katastrophe seines Bruders verwickelt zu werden. Auch er wurde an das Hoflager des Kaisers nach Mediolanum (Mailand) beordert, und lange Zeit war man sich dort nicht schlüssig, was mit ihm geschehen solle. Er wurde angeklagt, das Macellum ohne Genehmigung verlassen, mit seinem Bruder konspiriert und sich heimlich mit ihm in Konstantinopel getroffen zu haben, als dieser sich auf der Reise zu Constantius befand.74 Julian konnte die Anklagepunkte, die gegen ihn vorgebracht wurden, entkräften. Die Vorsicht, die er im brieflichen Verkehr mit Gallus, als dieser Caesar war, an den Tag gelegt hatte,75 rettete ihn aus der prekären Situation, in der er sich befand. Doch obwohl die Ankläger ihm nichts nachweisen konnten, wurde ihm eine Audienz bei Constantius immer wieder verweigert.76 So schwebte er sechs Monate lang in Ungewissheit über sein persönliches Schicksal, bis die Kaiserin Eusebia ihren Einfluss auf Constantius geltend machte und ihn bestimmte, seinen Vetter zu empfangen und ihm die Wiederaufnahme seiner Studien zu gestatten.77 Julian hatte gerade Mediolanum verlassen und Comum (Como) erreicht, da wurde er auf die Nachricht von der Usurpation des Silvanus in Köln und einer hochverräterischen Verschwörung im Illyricum hin erneut an den Hof des verunsicherten Constantius zitiert. Wieder kam ihm die Fürsprache der Kaiserin zu Hilfe. Er erhielt, wohl in der zweiten Augusthälfte 355, die Erlaubnis, sich an den berühmtesten Hochschulort des Reiches, nach Athen, zu begeben.78
In Athen hörte er vermutlich die beiden Lehrstuhlinhaber der Rhetorik, Prohairesios79 und Himerios.80 Der Erste war armenischer Herkunft und Christ, der Zweite, gebürtig aus Bithynien und der alten Religion verbunden, war mit dem athenischen Bürgerrecht ausgezeichnet worden und hatte sich mit seinem Sohn in die Eleusinischen Mysterien einweihen lassen. Zusammen mit Julian studierten zwei Kappadoker, die später als Kirchenväter zu großem Ruhm in der Kirche des Ostens aufstiegen, Basileios der Große und Gregor von Nazianz. Gregor rechnete nach Julians Tod mit dem Feind des Christentums in zwei Reden ab, und unter anderem zeichnete er ein wenig schmeichelhaftes Bild von der äußeren Erscheinung und dem Auftreten seines Mitstudenten. Dieses Bild ist gewiss von der Feindseligkeit gegen den ehemaligen Glaubensbruder, der vom Christentum abgefallen war, gefärbt, aber es gibt gleichwohl einen authentischen Eindruck von dem damals 24-jährigen Athener Studenten. Gregor schreibt: „Seine Ruchlosigkeit wurde der Welt erst offenbar, als er zur Macht gekommen war und nach freiem Ermessen handeln konnte; ich selbst sah sie bereits voraus, als ich ihn in Athen kennen lernte. Was mich hellsichtig machte, war die Unausgeglichenheit seines Charakters und das Übermaß seines fortwährenden Gefühlsüberschwangs. Mir ahnte nichts Gutes bei seinem Anblick: Ein Hals, der sich unaufhörlich hin- und herbewegt, Schultern, die sich gleich Schalen einer Waage hoben und senkten, unstete Augen, die er mit exaltiertem Ausdruck rollte; sein Gang zeigte Unsicherheit, sein stolz emporgerecktes Kinn und die lächerlichen Grimassen, die er schnitt, verrieten Anmaßung und Überheblichkeit. Sein Lachen war unbeherrscht und krampfhaft, er nickte oder schüttelte mit dem Kopf ohne Sinn und Verstand; seine Sprechweise war zögernd und oft wie durch Atemnot unterbrochen; seinen Fragen fehlte Ordnung und Verständnis, bei seinen Antworten überstürzte und verhaspelte er sich wie jemand ohne wirkliche Bildung.“81 An dieser Beschreibung ist so viel gewiss zutreffend, dass das äußere Erscheinungsbild Julians die Unausgeglichenheit seines Charakters widerspiegelte. Er war, wie auch Libanios berichtet, zugleich schwer gehemmt und hemmungslos begeisterungsfähig, krankhaft schüchtern und exaltiert, hochmütig abweisend und voller Überschwang in seinen Freundschaftsbezeugungen.82
Wie in Kleinasien war auch in Athen der Besuch rhetorischer Vorlesungen für Julian eher eine Pflichtübung. Seine eigentliche Leidenschaft galt der Philosophie und den Mysterien von Eleusis. In Athen begegnete er einem Schüler des Aidesios, auf den dieser ihn bereits in Pergamon hingewiesen hatte, nämlich Priscus, und mit ihm schloss er ebenso wie mit Maximus eine Freundschaft fürs Leben.83 In Eleusis ließ er sich in die uralten Mysterien der Demeter und Kore einweihen, um so ein besonderes Nahverhältnis mit den Göttern zu begründen.84 Dies geschah anlässlich der Großen Mysterien im September 355, und es wird die Erinnerung an dieses Ereignis sein, die ihn veranlasste, in einer seiner späteren theosophischen Schriften, der Abhandlung über die Große Göttermutter, über den Grund zu sprechen, dass die Großen Mysterien in der Zeit des herbstlichen Äquinoktiums gefeiert wurden: „Denn die heiligen und geheimen Mysterien der Demeter und Kore werden gefeiert im Zeichen der Waage, und dies geschieht mit gutem Grund. Denn wenn der (Sonnen-)Gott uns verlässt, müssen wir uns von neuem weihen, damit wir von der gottlosen und dunklen Gewalt, die dann die Übermacht gewinnt, nichts Schlimmes erleiden. Zweimal also feiern die Athener die Mysterien der Demeter, im Zeichen des Steinbocks die Kleinen und, wenn die Sonne im Zeichen des Krebses steht, die Großen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Die Großen und die Kleinen werden sie, glaube ich, neben anderen Ursachen vor allem deshalb genannt, weil es verständlicherweise von größerer Bedeutung ist, wenn der Gott uns verlässt, als wenn er wiederkommt.“85 Das war eine Begründung, wie sie möglicherweise Eingeweihten gegeben wurde, vor allem aber hatte sie für Julian neben der chronologischen eine tiefere, übertragene Bedeutung: Er rüstete sich durch die Mysterien für die gottlose, dunkle Zeit, in der er unter der Herrschaft des christlichen Kaisers leben musste.
In Griechenland und vor allem in Athen verehrte Julian den Ursprung und die Heimstätte von Bildung und Philosophie. Dieser Verehrung hat er beredt Ausdruck verliehen, als er später, wohl schon von Gallien aus, der Kaiserin Eusebia in einer Lobrede dafür dankte, dass er durch ihre Fürsprache Athen, das gelobte Land der Philosophie und der Bildung, kennen gelernt hatte: „Diese Gunst (in Athen studieren zu dürfen) erbat die Kaiserin für mich, weil sie erfahren hatte, dass ich bildungsbegeistert bin, und sie weiß, dass Athen die Heimat der Bildung ist … Denn wenngleich wir in Thrakien und Ionien leben, sind wir doch Söhne Griechenlands, und wer von uns nicht völlig undankbar und gefühllos ist, der sehnt sich danach, unsere Vorfahren zu begrüßen und dieses Land willkommen zu heißen.“86 Es waren freilich nur wenige Wochen, die ihm in Athen vergönnt waren. Schon im Oktober 355 wurde er erneut an den Hof nach Mediolanum gerufen. Wie er selbst sagt, verließ er die geliebte Stadt unter Tränen.87 Die Zeit des dem Studium gewidmeten Privatlebens war nun endgültig zu Ende. Constantius erhob Julian am 6. November zum Caesar und wies ihm den Westen des Reiches, die gallische Praetorianerpraefektur, als Amtssprengel zu.88
Als Julian Athen verließ, um die Stellung des Privatmannes mit der kaiserlichen Würde eines Caesars zu tauschen, hatte er innerlich längst mit dem Christentum gebrochen. Er hatte seine geistige Heimat in den intellektuellen Zirkeln gefunden, die von den Schülern und Nachfolgern des Jamblichos geprägt waren. Maximus von Ephesos und Priscus standen ihm als philosophisch-theologische Lehrer am nächsten, und sie wurden später in der Zeit seiner Alleinherrschaft seine engsten Berater. Andere Philosophen und Intellektuelle kamen hinzu. Mit dem berühmten, in Konstantinopel lehrenden Sophisten und Philosophen Themistios hatte Julian nach eigenem Zeugnis Platons Gesetze studiert,89 und die so begründete Bekanntschaft fand später ihre Fortsetzung durch den Austausch von Briefen und schriftlichen Botschaften. Auch mit Libanios blieb Julian sowohl während seiner Studentenzeit als auch von Gallien aus in brieflichem Verkehr.90 Allerdings begleitete ihn nur ein einziger der Intellektuellen, mit denen er befreundet war, nach Gallien. Dies war der auch als Verfasser medizinischer Werke hervorgetretene Arzt Oreibasios von Pergamon.91 Julians wenig gefestigte Gesundheit – eine schwere Erkrankung ist für die Zeit um das Jahr 353 bezeugt92 – bedurfte der ärztlichen Betreuung. Aber Oreibasios war mehr als nur sein Arzt – er war als sein Freund auch der engste Berater, und was besonders zählt, er war Heide und Neuplatoniker und er diente Julian als Betreuer der Bibliothek, die er mit nach Gallien nahm.93
Die Präfekturen und Diözesen in der Spätantike