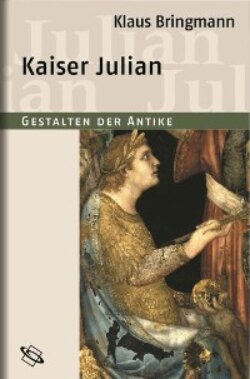Читать книгу Kaiser Julian - Klaus Bringmann - Страница 11
2. Die Jahre der Verbannung in Kappadokien
ОглавлениеDer von Kaiser Constantius angeordnete Zwangsaufenthalt auf der kaiserlichen Domäne Macellum in Kappadokien dauerte sechs Jahre, von 342 bis 348.28 Das Gut mit seinem ausgedehnten Palastbezirk, zu dem Bäder, Parkanlagen und Quellen gehörten, lag zu Füßen des Argaios, des mit fast 4000 Metern höchsten Berges in Kleinasien (heutiger Name: Erciyas Dag). Die nächstgelegene Stadt war Caesarea/Mazaka (das heutige Kayseri), Hauptstadt der Provinz Cappadocia I und Sitz eines Bischofs, der den Rang des Metropoliten innerhalb der Provinz innehatte. Stadt und Umland gehörten damals zu den am stärksten christianisierten Gebieten des Römischen Reiches,29 und so wird es kein Zufall sein, dass Julian, der nach dem Zeugnis des Gregor von Nazianz die Taufe empfangen hatte,30 in dieser Umgebung für uns als Christ unter Christen in Erscheinung tritt. Er und sein Halbbruder erhielten, so berichten übereinstimmend Gregor von Nazianz und die späteren Kirchenhistoriker, auf dem Macellum Unterweisung in der Heiligen Schrift, wurden als Lektoren sogar in den niederen Klerus aufgenommen und lasen der Gemeinde im Gottesdienst Abschnitte aus der Bibel vor. Weiterhin heißt es, dass sie Priestern und anderen frommen Christen ihre Verehrung bezeugten, Kirchen und Gedenkstätten der Märtyrer eifrig besuchten und für den Bau einer großen Kirche zu Ehren des Märtyrers Mamas erhebliche Mittel aus ihrem Vermögen bereitstellten.31
Was immer moderne Gelehrte zur Frage der Christlichkeit Julians behauptet haben32: Wir haben keine Möglichkeit zu wissen, ob sich Julian während seines Aufenthalts auf dem Macellum lediglich den Erwartungen der Aufseher, von denen der bigotte christliche Kaiser Constantius seine jungen Vettern beaufsichtigen ließ, äußerlich anpasste oder ob er sich als gläubiger Christ begriff. Er selbst hat später in seinem Brief an die Athener der in Kappadokien verbrachten Zeit mit großer Bitterkeit gedacht. Dieser autobiographische Bericht ist niedergeschrieben worden, als er mit dem Christentum innerlich schon längst gebrochen hatte, und er gehört in seine Abrechnung mit Kaiser Constantius, in dem er den Mörder seines Vaters und seiner Verwandten sah. Aber Zeitstellung und Zweck dieses Selbstzeugnisses können keinen vernünftigen Zweifel daran begründen, dass der Heranwachsende auch in der Zeit des Zwangsaufenthaltes auf dem Macellum weiterhin mit dem Trauma des schrecklichen Kindheitserlebnisses zu kämpfen hatte. Den Brüdern wurden vonseiten der Aufseher Erklärungen gegeben, die in ihrer Unbestimmtheit und Widersprüchlichkeit weder ihn noch Gallus befriedigen konnten. Er schreibt: „Das also, wie gesagt, erzählte man uns und versuchte, uns zu überzeugen, dass Constantius so gehandelt habe, weil er getäuscht worden sei – oder ein anderes Mal, weil er der Gewalt und dem Aufruhr der undisziplinierten und rebellischen Truppe habe weichen müssen. So redete man also auf uns ein auf dem Landgut in Kappadokien, wo wir festgehalten wurden, und man ließ dort niemanden zu uns, meinen Bruder hatte man aus seinem Verbannungsort geholt und mich aus der Schule gerissen, als ich noch ganz jung war. Wie soll ich diese sechs Jahre beschreiben, die wir dort verbrachten? Wir lebten dort wie auf einem fremden Gut, bewacht wie auf einer Burg bei den Persern, kein Fremder besuchte uns, und auch von den alten Bekannten durfte niemand zu uns kommen. Wir lebten abgeschlossen von allem ernsthaften Studium und freien Umgang, aufgezogen in glänzender Sklaverei, die Kameraden unserer gemeinsamer Spiele und Übungen waren unsere eigenen Sklaven: Kein Altersgenosse kam und wurde zugelassen.“33
Nur ein einziges Mal, so erfahren wir, besuchte Kaiser Constantius, offenbar auf seiner Reise durch Kleinasien im Jahre 347, seine Vettern.34 In dieser drückenden Atmosphäre der Isolation erlebte Julian die Zeit seiner Pubertät. Es gab, wie gesagt, weder freundschaftlichen Umgang mit Gleichaltrigen noch Beziehungen zu Mädchen. Wie immer Veranlagung und Lebensumstände zusammengewirkt haben mögen: Julian blieb zeitlebens ein völlig asexueller Mensch. Weder in den Jahren, in denen ihm ein Studium im westlichen Kleinasien und in Athen erlaubt war, noch als Caesar in Gallien oder als Alleinherrscher zeigte er das geringste Interesse am weiblichen Geschlecht, und andererseits weisen die zahlreichen Briefe, die er an Studien- und Gesinnungsfreunde richtete, keinerlei Spuren einer homoerotischen Neigung auf. Als Constantius ihn zum Caesar erhob, gab er ihm seine Schwester Helena zur Frau, die einige Jahre älter war als er. Er gehorchte, blieb mit ihr fünf Jahre bis zu ihrem Tod im Jahre 360 verheiratet und verlor in seinen zahlreichen autobiographischen Äußerungen nur zwei nebensächliche Worte über seine Heirat und seine Frau. Seiner Umgebung erschien er als männliche Jungfrau. Der Historiker Ammianus Marcellinus, der ihn persönlich gekannt hatte, rühmt seine „unbefleckte Keuschheit“, und er weiß zu berichten, dass er von den durch außerordentliche Schönheit ausgezeichneten Perserinnen, die ihm in Mesopotamien bei der Eroberung von Maozamalcha im Jahre 363 in die Hände fielen, keine auch nur anblickte, geschweige denn anrührte.35
Kopf der Kolossalstatue Constantius’ II. (?)
Rom, Palazzo dei Conservatori
In den Jahren der Pubertät verfestigte sich in Julian jene asketische Haltung, die ihn zeitlebens prägte, und in der inneren Vereinsamung, die er auf dem Macellum erfuhr, fand er nach seinem eigenen Zeugnis Rettung in der Philosophie und nicht im christlichen Glauben. Die Philosophie war es, die dem asketischen Zug seines Wesens das intellektuelle Fundament gab, und er bedauerte, dass sein Halbbruder zu seinem eigenen Unglück zu dieser Quelle seelischer Rettung keinen Zugang fand. Er schreibt: „Von diesem Ort (das heißt von Macellum) wurde ich, wenn auch mit Mühe, mit gutem Glück durch die Hilfe der Götter befreit, mein Bruder aber wurde am kaiserlichen Hof für ein unglückseliges Schicksal festgehalten, wie es selten eines gegeben hat. Und wenn in seinem Wesen schon ein wilder und roher Grundzug erkennbar war, so wurde er durch unsere Lebensweise in den Bergen noch zusätzlich verstärkt. So ist es, denke ich, nur gerecht, die Schuld daran dem Manne zu geben, der uns gegen unseren Willen diese Lebensweise aufgezwungen hatte. Die Götter haben es gefügt, dass ich dank der Philosophie davon keinen Schaden genommen habe und unversehrt geblieben bin, aber meinem Bruder hat dies keiner gewährt.“36 Das Studium der Philosophie wurde ihm durch die große Bibliothek des Georgios, des späteren Bischofs von Alexandreia, ermöglicht.37 Von diesem lieh er sich Bücher aus, und er erinnerte sich an dessen Bibliothek noch auf das Genaueste, als zu Beginn seiner Alleinherrschaft dieser Georgios als Bischof von Alexandreia von der Stadtbevölkerung am 24. Dezember 361 gelyncht und sein Palast geplündert worden war. Als Julian im Jahre 362 im Begriff war, eine Widerlegung des Christentums zu verfassen, befahl er den Behörden, die gestohlenen Bücher aufzuspüren und sie nach Antiocheia in Syrien, seiner damaligen Residenz, zu schicken. In den Anweisungen beschrieb er die Zusammensetzung der Bibliothek und die Umstände, unter denen er sie als Heranwachsender kennen gelernt hatte: „In seinem (Georgios’) Besitz befanden sich viele philosophische Werke, viele rhetorische Schriften und auch viele Bücher über die Lehre der gottlosen Galiläer (so bezeichnete Julian die Christen, seitdem er sich offen zum Heidentum bekannte) … Ich kenne die Bücher des Georgios, wenn auch nicht alle, so doch viele. Denn als ich in Kappadokien lebte, lieh er sie mir zur Abschrift aus, und er erhielt sie dann wieder von mir zurück.“38 Und in einem weiteren diesbezüglichen Schreiben heißt es: „Georgios besaß eine reichhaltige, bedeutende Bibliothek mit Werken verschiedener Philosophen, auch vieler Kommentatoren, nicht zuletzt auch viele und verschiedenartige Schriften der Galiläer.“39
Die Bibliothek enthielt also neben einer reichhaltigen Sammlung theologischer christlicher Literatur auch die Texte der klassischen Philosophen, vornehmlich wohl die des Platon und des Aristoteles, sowie die ihrer neuplatonischen Kommentatoren, die damals den neuesten Stand des philosophischen Denkens repräsentierten. Julian las, was immer er erhalten konnte. Er sagte von sich selbst, dass ihm von früher Jugend an ein unwiderstehlicher Drang nach Büchern innewohnte, und man wird in der Annahme nicht fehlgehen, dass er schon in Kappadokien nicht nur die Grundlage seiner vorzüglichen Bibelkenntnis legte, sondern sich auch mit der neuplatonischen Philosophie vertraut machte, die ihm später das theologische Rüstzeug für die von ihm ins Werk gesetzte Erneuerung des Heidentums lieferte. Wie er auf dem Macellum bei seiner ausgebreiteten Lektüre über das Verhältnis von Christentum und heidnisch geprägten Neuplatonismus dachte, wissen wir natürlich nicht. Dennoch erscheint so viel deutlich: Er lebte wie alle christlichen Intellektuellen jener Übergangszeit in zwei Welten, in der christlichen seiner Familie und seiner Umgebung und in der heidnisch geprägten der philosophisch-rhetorischen Bildung. Mochte er auch in Kappadokien äußerlich als Christ in Erscheinung treten: Fest verwurzelt im christlichen Glauben kann er jedenfalls kaum gewesen sein. Als er nach seiner Rückkehr aus Kappadokien die neuplatonischen Gegner des Christentums kennen lernte, ging er mit fliegenden Fahnen zu einem Heidentum über, das im programmatischen Widerspruch zum Christentum die Verehrung der traditionellen Götter auf das Fundament einer neuplatonischen Theologie und Welterklärung stellte.