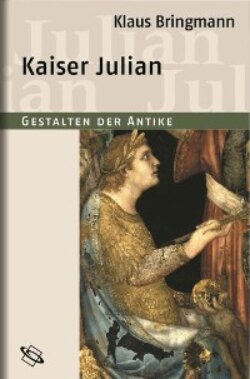Читать книгу Kaiser Julian - Klaus Bringmann - Страница 9
Einleitung
ОглавлениеDem Kaisertum des vierten Jahrhunderts war aufgegeben, auf die drei großen Herausforderungen der Zeit eine Antwort zu finden: Wie die territoriale Integrität des an allen Fronten bedrohten Reiches zu sichern und die dafür notwendigen Mittel aus den begrenzten personellen und materiellen Ressourcen zu gewinnen seien; wie die durch Usurpation und Bürgerkrieg verloren gegangene Rolle des Kaisertums als Garant des inneren und äußeren Friedens und der Wohlfahrt des Reiches zurückgewonnen und bewahrt werden könne; und wie angesichts der religiösen Spaltung, die durch die Ausbreitung des Christentums eingetreten war, die religiöse Frage zu lösen und jene göttliche Gnade zu gewinnen sei, die in der subjektiven Vorstellungswelt von Heiden und Christen die Voraussetzung des Gedeihens von Kaiser und Reich sowie des Seelenheils des Einzelnen war. In dieser Sicht kam der religiösen Frage die Schlüsselrolle schlechthin zu. Ihr galt denn auch das Hauptaugenmerk der kaiserlichen Gewalt, und auf dem Feld der Religion sind im vierten Jahrhundert Entscheidungen gefallen, deren Wirkungen über die Dauer des Römischen Reiches hinaus bis auf den heutigen Tag andauern. Am Beginn des Jahrhunderts stand die längste und brutalste staatliche Verfolgung, der das Christentum in seiner Geschichte ausgesetzt war, an seinem Ende war es Staatsreligion geworden und hatte mit Hilfe der kaiserlichen Gewalt Staat und Gesellschaft erobert. Dazwischen lagen die langwierigen innerchristlichen Auseinandersetzungen um die Definition des rechten Glaubens und der auf vielen Feldern ausgetragene Konflikt zwischen Christentum und Heidentum. Einen erheblichen Anteil am Sieg der christlichen Seite hatte das Kaisertum, das während des ganzen Jahrhunderts damit experimentierte, seine stabilisierende, die Einheit des Reichs und der Religion verbürgende Potenz in Gestalt eines Kaiserkollegiums oder der Alleinherrschaft geltend zu machen. Am Ende des Jahrhunderts zeichnete sich die faktische (nicht die rechtliche) Teilung des Reiches in eine lateinische West- und eine griechische Osthälfte ab. Diese sich aus dem Bemühen um innere und äußere Stabilisierung herleitende Differenzierung in ein östliches und westliches Kaisertum trug entscheidend dazu bei, dass die großen Anstrengungen, die im vierten Jahrhundert zur Sicherung der Reichsgrenzen unternommen wurden, letztlich in einem Misserfolg endeten. Im Jahre 378 verlor Valens, Kaiser in der östlichen Reichshälfte, bei Adrianopel im Kampf gegen die Goten Schlacht und Leben. Die Goten mussten an der unteren Donau auf Reichsboden angesiedelt werden. Die Stromgrenze stand dort nicht mehr unter direkter römischer Kontrolle. Damit war ein Dammbruch eingetreten, der nicht mehr repariert werden konnte. Die katastrophalen Folgen sollten sich freilich erst zu Beginn des fünften Jahrhunderts zeigen.
Kaiser Julian kommt ziemlich genau in die Mitte dieser Achsenzeit des Römischen Reiches zu stehen. Obwohl seine Alleinherrschaft nur anderthalb Jahre dauerte (November 361 – Juni 363) und er nicht zu den Siegern der Geschichte gehört, verdichtet sich unter seiner kurzen Regierung wie unter einem Brennspiegel die Problemlage, um deren Auflösung im vierten Jahrhundert gerungen wurde. Wie sein Onkel Konstantin der Große im ersten Drittel des Jahrhunderts und Theodosius der Große im letzten gewann auch er noch einmal die Alleinherrschaft, und wie diese setzte er die damit gewonnene Gestaltungsvollmacht in erster Linie für die Lösung der religiösen Frage ein. Aber während Konstantin und Theodosius das Bündnis mit der christlichen Kirche suchten, der eine das Christentum begünstigte und auf den Weg zur Staatsreligion brachte, der andere das auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil neuformulierte Nizänische Glaubensbekenntnis zur Grundlage der christlichen Staatskirche machte, unternahm Julian den gegenläufigen Versuch, die Vielzahl der heidnischen Kulte in einer heidnischen Staatskirche zu organisieren und das Christentum an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Auch wenn sein früher Tod den Abbruch dieses Experiments bedeutete, fand Julian begreiflicherweise bei Anhängern und Gegnern ein starkes Echo, das in der christlichen und heidnischen Überlieferung eine reiche Hinterlassenschaft gefunden hat.
Julian war, wie mit Recht gesagt worden ist, der erste Grieche auf dem römischen Kaiserthron. Obwohl er, der Neffe Kaiser Konstantins des Großen, väterlicherseits aus einer der romanisierten illyrisch-thrakischen Familien des Balkans stammte, die dem Reich seit vielen Generationen Soldaten, Generäle und Kaiser stellten, fühlte sich der im Osten aufgewachsene Julian ganz als Hellene, und dieser Name bezeichnete in einem sich damals verfestigenden Sprachgebrauch einen Menschen, der in der Tradition der griechischen Kultur und ihrer heidnischen Götterwelt sozialisiert war. Julian gehörte von Haus aus einer christlich gewordenen Familie an und war vielleicht sogar christlich getauft worden. So trug er den Gegensatz zwischen Hellenentum und Christentum in seiner eigenen Brust aus, bis er in den Konventikeln neuplatonischer Philosophen in Kleinasien und Athen seine Erweckung zum dezidierten Heiden neuplatonischer Prägung und zum glühenden Feind des Christentums erlebte. So unterstellte er sein Kaisertum, zu dem er wider Erwarten gelangt war, der Vision einer Wiederherstellung des Götterglaubens.
Aber Julian betrachtete sich nicht nur als Sachwalter hellenischer Religion und Geisteskultur, er verinnerlichte auch die Ideale und Ansprüche des römischen Kaisertums. Obwohl er nach Veranlagung und Erziehung den Typus des griechischen Intellektuellen neuplatonischer Observanz beinahe ideal repräsentierte, unterwarf er sich mit größter Selbstdisziplin den Anforderungen seiner kaiserlichen Stellung und setzte sein unvergleichliches Arbeitsethos daran, der Rolle des Feldherrn, des Administrators und des obersten Richters eines Großreiches gerecht zu werden. Seine Anfangserfolge und die ihnen gewidmete Propaganda haben großen Eindruck auf seine Zeitgenossen gemacht, aber schon zu seinen Lebzeiten wurde deutlich, dass auch dem mächtigsten Mann der römischen Welt ein enger Handlungsspielraum gesetzt war.
Julian war ein Intellektueller, den es in jeder Lebenslage drängte, sich seiner Mitwelt schriftlich mitzuteilen, und das Aufsehen, das er bei Freund und Feind erregte, hat bewirkt, dass ein erheblicher Teil seiner Briefe und Schriften unversehrt auf uns gekommen ist. Die 73 echten Stücke des Briefkorpus enthalten in gleicher Weise persönliche Mitteilungen und offizielle Schreiben; die für die Öffentlichkeit bestimmten literarischen Werke reichen von einem autobiographischen Sendschreiben über Lobreden, situationsbezogene Satiren und Kampfschriften bis hin zu grundsätzlichen philosophisch-theologischen Abhandlungen. Hinzu kommen Fragmente, die bedeutendsten stammen aus seiner umfangreichen Widerlegung des Christentums, die er unter dem Titel „Gegen die Galiläer“ verfasste. Die erhaltenen Fragmente sind dem Patriarchen Kyrillos von Alexandreia zu verdanken, der seinerseits eine Widerlegung der Widerlegung schrieb und darin aus Julians Schrift ausgiebig zitierte. Ergänzt werden die Schriften und Selbstzeugnisse durch die zahlreichen in die spätantiken Gesetzessammlungen aufgenommenen Konstitutionen Julians. Sie sind der Niederschlag seiner außergewöhnlich intensiven Regierungstätigkeit in der Zeit seiner Alleinherrschaft, für die auch die Münzprägung und zahlreiche Inschriften sprechen.1
Das Aufsehen, das er erregte, hat schon zu seinen Lebzeiten und mehr noch nach seinem frühen Tod eine Flut von literarischen Äußerungen hervorgerufen. Sie reichen von offiziösen Reden prominenter Anhänger wie die des Konsuls Claudius Mamertinus und des gefeierten Rhetors Libanios von Antiocheia über Trauer- und Totenreden, Augenzeugen- und Erlebnisberichten bis zu polemischen Abrechnungen, die von christlicher Seite in Gestalt von Gedichten, Predigten, Heiligenlegenden und Romanen gehalten wurden. Schließlich bemächtigte sich die heidnische und die christliche Geschichtsschreibung des Dramas vom Aufstieg und Sturz des Mannes, der von den einen verehrt und von den anderen als Antichrist verteufelt wurde. Die älteste und ausführlichste, vollständig erhaltene Darstellung geben die einschlägigen Bücher im Geschichtswerk des Ammianus Marcellinus, der persönlich an Julians Perserfeldzug teilgenommen hatte. Ammianus Marcellinus konnte seinerseits bereits das Geschichtswerk des Eunapios von Sardeis benutzen, für das ein enger Freund des Kaisers, der Arzt Oreibasios von Pergamon, einen ebenfalls verlorenen, auf eigenem Erleben beruhenden Bericht verfasste hatte. Neben wenigen erhaltenen Fragmenten vermittelt der Auszug, den zu Beginn des sechsten Jahrhunderts der Heide Zosimos aus dem Geschichtswerk des Eunapios anfertigte und in seine „Neue Geschichte“ einfügte, einen Eindruck von dem verlorenen Original. Auf der anderen Seite stehen die Kirchenhistoriker des fünften Jahrhunderts, Rufinus von Aquileia, Sokrates, Sozomenos, Theodoret und Philostorgios, die naturgemäß ihre Aufmerksamkeit ganz dem Abfall Julians vom Christentum und seinem letztlich gescheiterten Versuch einer Erneuerung des Götterglaubens widmen.
Somit liegt ein ungewöhnlich reiches Quellenmaterial zu Leben und Wirken des Kaisers Julian vor. Insbesondere die Werke und Selbstzeugnisse des Kaisers ermöglichen und rechtfertigen den Versuch einer Biographie. Mag auch das Material den Ansprüchen, die an Biographien von Personen der neueren und neuesten Geschichte mit Fug und Recht gestellt werden können, im Falle Julians nicht vollständig genügen: Für keinen einzigen römischen Kaiser ist das Quellenmaterial so ergiebig wie für diesen großen Feind des Christentums, der in letzter Stunde den Strom der Geschichte umkehren wollte.