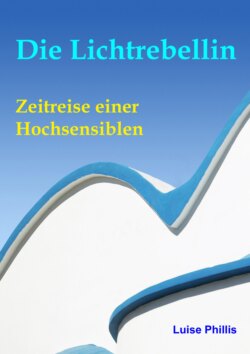Читать книгу Die Lichtrebellin - Luise Phillis - Страница 6
Am Anfang waren Licht und Schatten – die leichte Geburt und einiges davor
ОглавлениеJe mehr Du nach dem Licht jagst, desto länger wird Dein Schatten! Christiane B. Dingler
Der Geburtsvorgang als solcher bedeutet das erste Trauma für den Menschen hier auf der Erde. Durch den engen Kanal das Licht der Welt zu erblicken, das ist für jeden Menschen ein Schock. Aber mit der Geburt fängt es nicht an, da sind wir schon mittendrin im irdischen Leben mit „Raum und Zeit“!
Denn wir wissen, dass auch die Zeit vor der Geburt ziemlich wichtig ist für das weitere Leben. Darüber haben sich die Menschen nicht immer Gedanken gemacht, es gab sicherlich Zeiten, in denen sie instinktiv wussten, dass die Schwangerschaft eine heilige Zeit ist, eine Zeit des Erwachens und des Prozesses von Leben. Bereits der Akt der Zeugung prägt den Menschen: ob er in Liebe gezeugt wurde, in einer Form der Gewalt oder aus einem Zwang heraus.
Auch die Zeit vor der Zeugung soll wegweisend sein, im ursprünglichen Sinne. Wir Menschen sollen uns unsere Eltern zu der Zeit, als wir noch nicht an einen Körper gebunden und reines Bewusstsein waren, selbst ausgesucht haben, damit wir das, was wir noch zu lernen haben an Bewusstseinserweiterung erfahren können und die Auflösung von „angehäuftem Karma“ (Kausalitäten von Taten und Resultaten) ermöglicht wird. Wie es wirklich außerhalb der so genannten Stofflichkeit ist, ist nicht auf seriöse Art zu erklären, aber es ist deshalb noch lange nicht unmöglich. Im Gegenteil, das kann ein interessantes Erklärungsmodell für die häufig komplizierten Verbindungen innerhalb einer Familie sein. Falls jemand in einer Pflegefamilie aufwächst oder in einem Heim, sind die jeweiligen Bezugspersonen als Repräsentanten für die Ursprungsfamilie, für die leiblichen Eltern, zu verstehen.
Bevor ich nun von meiner Geburt berichte, erscheint es mir deshalb sinnvoll, von meinen Eltern zu erzählen. Vielleicht habe ich sie ja schon aus einem anderen Leben gekannt, das ist alles spekulativ, aber dennoch laut der Erkenntnisse der Quantenphysik nicht unmöglich.
Jedenfalls kannten sich meine Eltern schon, seit meine Mutter geboren wurde. Es war im Mai und mein Vater war damals gerade vier Jahre alt. Sie waren Nachbarskinder – das Gute liegt manchmal so nah! Er blickte, so erzählt mein Vater noch jetzt, wo er im Sterben liegt, in einen Kinderwagen und erkannte sofort, dass es sich um seine große Liebe handelte, nämlich um meine Mutter. Er war hinüber zu dem benachbarten Bauernhof gelaufen und wollte das Baby sehen, das ein paar Tage zuvor geboren worden war. Es war ein Mädchen und hieß Maria. Mein Vater war von Anfang an begeistert von ihren braunen Augen …
Die kleine Maria wurde ein tapferes Mädchen, sie bekam noch drei Geschwister, einen Bruder, der zwei Jahre jünger war, und über ein Jahrzehnt später noch eine Schwester und einen Bruder. Als Älteste von drei Geschwistern fühlte sie sich stets zuständig und wurde auch, wie es damals bei Bauern und nicht nur dort üblich war, teilweise als Ersatzmutter eingesetzt. Jedenfalls fühlte sie sich verantwortlich für die Jüngeren und den ganzen Bauernhof. Sie hatte die Rolle der „Vernünftigen“ inne, sie nähte für ihre jüngeren Geschwister und dann auch für deren Puppen und Stofftiere und kümmerte sich um deren Wohl.
Und wenn ihr selbst beim Spielen, beim Erkunden der Um- bzw. Mitwelt ein kleines Missgeschick passierte, dann hatte sie immer Schuldgefühle, ein Gefühl der Angst, nicht angenommen zu sein. Ihre Eltern waren rechtschaffene Bauern, christlich-protestantisch geprägt mit alttestamentarischen Interpretationen, d.h., im Zusammenhang mit ethischen Normen und der Welt des Guten und Bösen kam auch der Teufel vor und manchmal ein gnädiger oder aber auch ein strafender Gott.
Sie gehörten als wohlhabende westpreußische, protestantische Bauern zu einer deutschen Minderheit in Polen. Dies war immer schwierig und irgendwie auch angstbesetzt gewesen. Schließlich war Maria zwischen zwei Weltkriegen geboren. Der Erste war noch nicht überstanden, der Zweite Weltkrieg war irgendwie schon spürbar, auch wenn niemand darüber sprechen konnte, denn die Kriegsgefahr war vielen Zeitgenossen damals nicht bewusst.
Als Maria einmal als Vierjährige den Kopf durch den Zaun gesteckt hatte, weil sie, neugierig, auf diese Weise einen Perspektivenwechsel erfahren wollte, konnte sie nicht mehr zurück. Da hat ihr Vater zu den Knechten (den damaligen Mitarbeitern) gerufen: „Holt doch ´mal die Axt!“ Meine Mutter schrie sehr laut und dachte, man wollte ihr den Kopf abschlagen. Dabei ging es doch nur um die Zaunlatte! Jedenfalls war es nicht weit her mit Marias Urvertrauen!
Als sie sich vor lauter kindlicher Freude und Übermut auf dem Nachhauseweg von der Schule an den Schulranzen eines Klassenkameraden gehängt hatte, um ihrem kindlichen Gemüt Ausdruck zu verleihen, da riss der Riemen des Ranzens entzwei und der Junge verpetzte meine Mutter bei seinen Eltern, die erbost zu meinem Großvater gingen und den Ranzen ersetzt haben wollten. Marias Vater regelte das und sie hatte seitdem das Gefühl, sie dürfe nicht ausgelassen und unbeschwert sein. In ihr entwickelte sich eine schleichende, verdeckte Angst und ein Misstrauen gegen die Umwelt.
Marias Vater, also mein Großvater, den ich auch noch kennenlernen durfte, überlebte den Ersten Weltkrieg und eine hartherzige Stiefmutter, indem er als Jugendlicher in die USA auswanderte und nach eineinhalb Jahren wiederkehrte. Einer seiner vielen Brüder war ein Wanderprediger, der vor allem als Sterbebegleiter in die Familien in der westpreußisch ländlichen Region gerufen wurde. Maria sprach immer voller Achtung von Onkel Oskar und das tut sie auch heute noch.
Neben Marias ernsthaftem Dasein als Älteste der Geschwister erzählte sie mir erst kürzlich im Seniorenheim von einem herausragend lustigen Ereignis für sie. Es war die Geschichte mit ihrer Cousine, die im gleichen Alter wie meine Mutter war. Als Maria und ihre Cousine viereinhalb Jahre alt waren, erlebte Maria zusammen mit ihrer Cousine bei deren Eltern eine große „Sensation“. Marias Tante und Onkel hatten eine große Bäckerei in einem Nachbardorf und die Kinder durften dort manchmal ein paar Tage übernachten. Maria spielte gern mit ihrer Cousine und eines Tages liefen die beiden in die Backstube, in der ein großer Bottich mit Teigresten stand. Dieser war ungefähr eineinhalb Meter hoch und hatte zwei Meter Durchmesser. Jedenfalls durften die beiden Mädchen in diesen Bottich klettern, Marias Tante half ihnen dabei, und so standen sie in diesem Riesentopf in voller Lebensgröße und durften die Teigreste auslecken. Das machte den beiden einen großen Spaß, und besonders Maria erlebte eine ihr fremde Ausgelassenheit und
Leichtigkeit.
Zuhause war Maria, als sie älter wurde, immer fleißig, sie arbeitete auf dem Bauernhof, fütterte Enten, Hühner und Küken und konnte irgendwann auch Tiere schlachten, kochte wunderbar, buk Brot und Kuchen und verzierte die schönsten Torten.
Einmal, als Besuch kommen sollte, was sehr häufig und üblich in dieser östlich ländlichen Region war, hatte sie eine wohl verzierte Torte kreiert und diese zum Kühlen in den Keller getragen. Als nun der Besuch gekommen war und Maria ihr „Kunstwerk“ holen wollte und dafür eigens in den Keller ging, war die Verzierung verschwunden, die Torte war sozusagen nackt. Ihr Kater saß neben der Kellertür und leckte sich genüsslich die Schnauze. Sie konnte ihm nicht böse sein.
Maria sang im Gemeinde-Kinderchor und Gustav, mein Vater, ebenfalls. Er stand während des Probens immer hinter Maria und flüsterte ihr eines Tages während des Singens ins Ohr – Gustav war elf Jahre alt und Maria sieben: „Du oder keine!“ Und so war es denn auch.
Sie jagten sich beide im Winter auf dem Dorfteich beim Schlittschuhlaufen, Gustav übergoss Maria zu Ostern mit viel Wasser, ein österlicher Brauch der Polen, und Weihnachten sangen sie zusammen als „Engel“ im Chor im Gebetssaal des Dorfes.
Maria war befreundet mit Gustavs Schwester Frieda, die mit ihr im gleichen Alter war. Gustav war häufig dabei, denn als Nachbarskinder hatten sie es nicht schwer,
einander zu begegnen.
Als Maria und Gustav älter waren, ritten sie beide mit ihren Schwerblutpferden aus. Manchmal waren sie auch zerstritten und dann hatte Gustav andere Freundinnen und Maria andere Verehrer. Aber sie wussten genau, dass sie beide für einander bestimmt waren, also versöhnten sie sich auch immer wieder und unternahmen viel miteinander: Sie fuhren zum Beispiel mit der Kutsche in die benachbarte Stadt zu einem jüdischen Schneidermeister, der ihnen jedes Mal köstlichen Tee aus einem Samowar zubereitete. Er nahm Maß und Maria bekam die wunderschönsten Kleider genäht und Gustav brillierte mit seinen Maß geschneiderten Anzügen. Sie versuchten einander möglichst häufig zu sehen, und wenn Maria auf dem Hof arbeitete und Gustav ging vorbei, dann nahm sie ihre Schürze ab und stolzierte hin und her, damit Gustav auf sie aufmerksam würde. Und er wiederum ging möglichst oft an Marias Bauernhaus vorbei, um einen Blick von ihr zu einzufangen. Und irgendwann wurden sie ein Paar, stritten und versöhnten sich und empfanden einander als die große Liebe.
Maria besuchte eine „Höhere-Töchter-Schule“ in einer naheliegenden Stadt. Hier lernte sie, ergänzend zu ihren hervorragenden bäuerlichen Kochkünsten, die internationale Küche kennen, erfuhr, wie frau mit Säuglingen, Kindern und alten Menschen umgeht. Sie lernte nähen, was sie ja schon vorher konnte, und Benimmregeln, allerdings auch solche wie: „Eine Frau weint nicht, höchstens dann, wenn der Liebste im Krieg gefallen ist!“
Das waren die Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg und das, was mittendrin passierte. Jedenfalls war Maria irgendwann die Verlobte von Gustav. Sie liebte ihn unendlich! Das zuerst einmal zu meiner Mutter.
Und mein Vater? Gustav stammt auch aus einer protestantischen Bauernfamilie, deren Vorfahren genau wie die von Maria zu Zeiten Katharina der Großen aus Schwabenland nach Polen gekommen waren, um dort das Land urbar zu machen. Auch sie gehörten zu der deutschen Minderheit in Polen und grenzten sich mit ihrem praktizierten Protestantismus gegen die Polen ab, die alle durchweg katholisch waren. Das hatte mehr mit dem Minderheitenbewusstsein zu tun als mit einer Religionsspaltung, denn sie kamen gleichzeitig gut mit den Polen aus und waren mit vielen auch befreundet gewesen.
Gustavs Großvater war Kirchenbaumeister und hatte in der gesamten Region Ostpreußens einen außerordentlichen Ruf. Gustavs Vater war ein sehr wachsamer tüchtiger und guter Bauer und seine Mutter eine spirituelle, bescheidene, liebe Frau. Gustavs Großmutter war so etwas wie eine Heilerin gewesen, sie kannte viele Heilkräuter und Heilweisen, so dass viele Menschen, z. B. Mütter mit ihren Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Leiden und Gebrechen zu ihr kamen, und sie konnte ihnen in der Regel immer helfen.
Gustav war der Jüngste von insgesamt fünf Kindern. Er war das „geliebte Gustavchen“. Sein Bruder war der Älteste und dann hatte er noch drei Schwestern, von denen Frieda die jüngste war. Sie war es auch, die sehr eng mit Maria befreundet war. Eines Tages hatte Gustavs Großvater bei der Heuernte einen Unfall. Er fiel vom Heuwagen und hatte sich so schwer verletzt, dass er an den Folgen starb. Es lag nicht viel Zeit dazwischen, denn als Gustav sechs Jahre alt war, starb sein Vater. Die Todesursache war wohl ein Herzinfarkt. Und als Gustav zehn Jahre alt war, legte sich seine geliebte Großmutter eines Tages, als sie bereits in einem hohen Alter war, ins Bett und stand nicht mehr auf. Gustav war noch ein Schulkind und ging jeden Tag an das Bett der Großmutter. Seine Mutter und seine Geschwister standen um ihr Bett herum und sangen Kirchenlieder und beteten. Und eines Tages, es war eine lange Zeit des Wartens, starb die Großmutter in Frieden.
Hiervon hatte mein Vater häufig berichtet, auf eine irgendwie bewundernde Weise. Und heute, da er 93 Jahre alt ist, hat auch er sich ins Bett gelegt und etwas in ihm möchte sich verabschieden, sich verabschieden von allem Geliebten, von dieser Welt. Das Leben bedeutet Abschiednehmen: In jedem Moment nimmt man Abschied von dem vorhergehenden. Diese Erfahrung machten meine Eltern und deren Familien lebenslang auf sehr intensive Weise.
Bald heiratete Gustavs Mutter wieder, sein Stiefvater nahm jedoch so gut wie keinen Platz in seinem Leben ein.
Gustavchen war der zarte und hübsche Junge und alle liebten ihn. Das ist in seinem Leben so geblieben, bis zum heutigen Tag, an dem er im Sterben liegt. Er war der Schwarm aller Mädchen und Frauen, jedoch entschied er sich schon sehr früh reinen Herzens für Maria. Auch er war christlich geprägt wie Maria, stand allerdings weniger unter alttestamentarischem Einfluss. Er war sehr frei erzogen und genoss sein Leben besonders auch, als er jung war. Er fühlte sich glücklich, sang und spielte Posaune in einem Posaunenchor und stellte als Sechsjähriger einen Hasen in einem Kindertheaterstück dar und als junger Mann einen Richter. Erst als Gustav achtzig war, erzählte er mir, dass er am liebsten Schauspieler geworden wäre. Nicht alles läuft im Leben so, wie wir es planen! Auch wenn wir es gern so hätten. Wir stellen zwar ein eigenes Universum dar, sind aber gleichzeitig Teil eines Gesamtuniversums, dessen Regeln wir nicht ignorieren können und dessen Zusammenhänge wir zum größten Teil nicht kennen!
Auch Gustavs Bruder konnte nicht den Beruf ausüben, den er sich wohl immer gewünscht hatte, nämlich Hochschulprofessor für Philosophie zu werden. Das konnte er nicht verwirklichen, da er als ältester Sohn viel Verantwortung für seine Ursprungsfamilie übernehmen musste.
Eines Tages wurde eine der drei Schwestern Gustavs, die 16-jährige Lore, krank. Sie wurde in der benachbarten Stadt operiert, was jedoch nicht wirklich erfolgreich verlief. Sie hatte einen „offenen“ Bauch und wurde bettlägerig und zu Hause gepflegt. Sie würde nicht mehr lange leben, das wussten alle.
Gustav kam immer gleich nach der Schule zu ihr ans Bett und erzählte von seinen Schulerlebnissen und seinen Gedanken und das auf sehr einfühlsame Weise. Sie freute sich immer sehr über Gustav und auch sie wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Sie ging dem Tode mit frohem Herzen entgegen und erlebte ein bewusstes Sterben im Licht. Ihre Mutter betete mehrmals am Tag an ihrem Bett, sie sangen Lieder aus dem Kirchengesangbuch und auch Maria und Frieda, Ernst und die andere Schwester, Magda, saßen um die Sterbende herum und erzählten ihr etwas und sangen mit ihr. Auch Marias Eltern kamen zu Gustavs Mutter, beteten und sangen mit ihr gemeinsam am Bett der Sterbenden.
Und eines Tages erzählte Lore von einem Traum, den sie in jener letzten Nacht gehabt hatte, nämlich dass sie auf einer wunderschönen Wiese Blumen pflückte und dass alles in einem sehr hellen Licht erschien und dass sie sehr glücklich war. Am darauf folgenden Tag starb Lore im Beisein ihrer Angehörigen. Alle waren tief berührt, besonders auch Gustav, der seine Schwestern sehr liebte und zu Lore eine besonders intensive Beziehung gehabt hatte. Er weinte viel und wusste dennoch, dass sie im Licht war.
Jetzt bete ich, beten wir für Gustav, und er betet auch den ganzen Tag, denn jetzt liegt er im Sterben …
Damals, während Gustavs und Marias Jugendzeit kam alles noch ganz anders. Durch den politischen Wandel im Deutschen Staat von der Demokratie zur Diktatur wurde der Zweite Weltkrieg vorbereitet. Und eines Tages war er da und alle Männer wurden in den Kriegsdienst eingezogen. Auch mein Vater und sein Bruder und die anderen männlichen Verwandte und Freunde.
Jedenfalls begann damit eine bleierne Schwere. Es geschahen die schrecklichen Dinge, von denen wir jetzt immer mehr wissen: Damit sind nicht nur die „gefallenen“, man muss wohl eher sagen, die getöteten Soldaten an der Front gemeint, sondern auch die fehlenden Menschen überall im damaligen „Reichsdeutschland“ und in den Minderheitenregionen, also auch im damaligen Ostpreußen (heutiges Polen). Sie waren einfach weg – bestimmte Familien, Ärzte, Rechtsanwälte und Schneidermeister, wie auch der befreundete meiner Eltern und Großeltern. Auch der Arzt, der die Familienmitglieder von Maria und Gustav einfühlsam behandelt hatte, war wie vom Erdboden verschwunden, und auch Kaufleute und deren Familien, alle waren plötzlich weg.
Es hieß, sie seien verreist. Auch der alte Jude mit seinem Bauchladen, der Jiddisch sprach und im Winter in der ländlichen Region immer Quartier gesucht hatte und entweder bei Marias oder Gustavs Eltern unterkommen konnte, weil genügend Platz in den Bauernhäusern war, auch dieser liebenswerte Landstreicher war weg.
Viele kranke Menschen waren auch nicht mehr da. Dazu gehörten auch so genannte „Schwachsinnige“, die angeblich irgendwie im „Reich“ (gemeint ist das Nationalsozialistische Deutschland, ohne Gebiete im Osten) in „Anstalten“ eine „Behandlung“ erfahren sollten, aber getötet wurden. Es wurde geschwiegen, einfach nicht darüber gesprochen, es geschah im Namen der Eugenik, also der Rassenlehre Hitlers.
Ich weiß, dass mein Großvater, Marias Vater, einmal zwei Juden versteckt hatte. Es drohte eine hohe Strafe für den „Täter“ und für alle Familienangehörige: KZ-Haft und die Todesstrafe. Mein Großvater und alle anderen aus der Familie waren davongekommen, niemand hatte die Tat je entdeckt.
Ein dunkles Netz hatte nun Maria und Gustav und deren Familien eingefangen. Die männlichen Familienmitglieder waren alle „eingezogen“ worden, auch alle anderen „tauglichen“ Männer aus dem Dorf, außer Marias Vater und Gustavs Stiefvater. Die „Eingezogenen“ waren irgendwo auf der Welt stationiert: entweder an der russischen Front wie Marias Bruder Fred und Gustavs Bruder Ernst oder aber wie Gustav selbst, in Griechenland und Italien. Andere waren in Frankreich oder in Nordafrika oder an einer anderen Stelle, an der sich das „Deutsche Reich“ als „Heilversprechen“ durchsetzen sollte.
Der kleine Wahnsinnige, der eigentlich ein Stadtstreicher war, wollte die Weltherrschaft und setzte das zunächst auch „erfolgreich“ um.
Getragen waren seine Taten von den Gedanken der damals und auch schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts verbreiteten Rassentheorien.
Dabei handelte es sich um einen Sozialdarwinismus, der besagte, dass nur die Gesunden, „Erfolgreichen“, Vitalen ein Recht haben zu leben und dass es nur so möglich ist, die Welt zu erhalten und zu erneuern.
Auch Nietzsches Philosophie vom „Übermenschen“ und vom „neuen Menschen“ hatte großen Einfluss auf diese Theorien, die der Kleine mit dem schwarzen Schnurrbart leider auf die konsequenteste Weise verdrehte und missverstand und auf seine Weise in die Praxis umsetzte.
Alles andere, was diesem Vitalitätsgedanken, diesem Vitalismus nicht entsprach, sollte von Menschenhand ausgerottet werden.
Dieser Ausrottungsgedanke wurde zum Teil bereits im 1. Weltkrieg verwirklicht und ist auf subtile Art immer noch ein Thema im 21. Jahrhundert.
Die deutschen Wissenschaftler entwickelten im Ersten Weltkrieg ein Giftgas, das nicht nur in Frankreich verheerende Wirkungen hatte und unzählig viele Menschen vernichtete.
Jedenfalls sollte zur Zeit des Nationalsozialismus´ in Deutschland alles, was krank, morbide, traurig, krumm, schwarzhaarig, braunäugig, nicht sesshaft, besonders kreativ (die Expressionisten), besonders genial (Sigmund Freud), klein (Liliputaner), homosexuell, besonders gläubig und kämpferisch (Bonhoeffer), individualistisch, freiheitsliebend, kommunistisch, jüdisch oder zigeunerhaft war, ausgerottet werden – alles, was anders war, was der Norm des arisch-germanischen Menschen nicht entsprach, musste weg. Auf diese Weise, mit dieser Eugenik, würde die Welt dann besser werden, gäbe es dann den „neuen Menschen“, perfekt nach einem Maß gestaltet wie Anzüge von der Stange.
Jedenfalls diese Theorien existierten in mehr oder weniger moderaterer Form auf der ganzen Welt bis hin nach Neuseeland und sonst wo. In Deutschland waren sie am stärksten ausgeprägt und wurden auf unvorstellbar grausame Art in die Tat umgesetzt. Sechs Millionen Menschen, es waren die Juden, die Zigeuner und die Andersseienden und -denkenden, wurden nach einem „perfekt“ ausgeklügelten Plan ausgerottet.
Übrigens: der kleine Wahnsinnige war selbst klein, schwarzhaarig, braunäugig, wahrscheinlich nicht heterosexuell, sicher nicht arisch und anders denkend.
Die bekannte Psychoanalytikerin und humanistische Psychotherapeutin Alice Miller deutete diesen Irrsinn als Selbsthass Hitlers, der so groß war, dass dieser sich selbst sechs Millionen Mal umbringen ließ. Der bekannte indische Philosoph des 20. Jahrhunderts, Osho, sagte: „Im hässlichen Gesicht des anderen siehst du immer nur dein eigenes!“
In jener Zeit verbrachten Maria und Gustav ihre Jugend. Die christliche Erziehung und die Werte der Barmherzigkeit und Liebe trugen Marias und Gustavs Familie durch diese Epoche der Angst, der Verdrängung, der Todeserschrockenheit, des Todes und der Vertreibung und erhellten diese dunklen Momente zum Teil.
Maria wollte ursprünglich Diakonissin werden, und besonders dann, wenn sie sich mit Gustav gestritten hatte. Maria hatte in ihren Handlungsweisen etwas alttestamentarisch Dualistisches. Das „Gute“ wird belohnt das „Böse“ wird bestraft. Das ist eine Geisteshaltung, die viel Angst erzeugt und große Anstrengung und Kraft kostet.
Jedenfalls war da viel Angst, die vor allem auch durch ein Terror-Regime geschürt wurde, das mit KZ-Haft und Todesstrafe drohte, wenn die Normen nicht eingehalten wurden und zu denen der Nazi-Gruß, der Arier-Ausweis und das Nazi-konforme „Wohlverhalten“ zählte. Alle anders Artigen, anders Denkenden, Fühlenden und Aussehenden wurden durch das Terror-Regime diskriminiert, ausgegrenzt und denunziert…
Die Deutschen in Ostpreußen und Polen durften nun auch nicht mehr mit den polnischen Mitbürgern befreundet sein, sich nicht mit ihnen in der Öffentlichkeit treffen – mit Juden durfte das erst recht nicht geschehen, allerdings gab es dort auch kaum noch welche.
In Marias und Gustavs Familie zählten nun die christlichen Werte, also setzten sie sich über die unsinnigen Verbote hinweg und pflegten ihre Freundschaften zu den Menschen, die ihnen nahe waren, ob es sich nun um Polen, Deutsche oder Zigeuner oder sonst wen handelte.
Die Zeiten waren also unvorstellbar wirr, vielschichtig und dunkel.
Marias und Gustavs tiefe Liebe zueinander machte all das lichter und erträglicher. Aber da gab es die Angst, die über allem schwebte, den anderen nicht wiederzusehen. Meine Eltern lernten schon hier die Lektion des Abschiednehmens.
Die Verliebten warteten auf die Rückkehr ihrer Geliebten, die Ehefrauen auf die ihrer Ehemänner. Die Mütter weinten um ihre Söhne, die aus dem Krieg nicht zurückkamen, weil sie getötet wurden, oder sie bangten um die Söhne, die noch lebten und an irgendeiner Front als Soldaten eingesetzt waren, um dem „Vaterland“ mit seinen wahnsinnigen Zielen und Werten zu dienen.
So beteten Marias und Gustavs Mütter für ihre Söhne, packten Pakete und schrieben Briefe, von denen niemand wusste, ob sie jemals ankommen würden. Besonders Gustavs Mutter betete dreimal täglich und sang die Lieder, die auch meine Mutter heute wieder in ihrem kleinen Zimmer im Seniorenheim singt – die aus dem christlichen Gesangbuch.
Auch Maria schrieb Briefe, sehnsüchtige Liebesbriefe, und packte Pakete für Gustav, mit den besten Lebensmitteln, mit Schinken, Speck, Brot, Kuchen, warmen, selbst gestrickten Socken – und immer dabei waren die Sehnsucht und die bange Angst um das Wiedersehen.
In dieser Zeit war nun auch Maria gezwungen gewesen, eine BDM-Führerin zu werden, also eine leitende Funktion im Bund Deutscher Mädchen zu übernehmen. Sie wurde es nicht aus Überzeugung, sondern aus der Verpflichtung einem diktatorischen Staat gegenüber.
Der Zwang, Mädchen zu den Unwerten wie „Zucht“, „Ordnung“, Intoleranz, Ausschließlichkeit, Muttertier-Sein (falsch verstandene Mütterlichkeit) oder einem Gemeinschaftssinn, ohne den Respekt vor dem anderen, zu erziehen, fühlte sich, wenn es gegen die eigene Überzeugung war, beängstigend an und führte unweigerlich zu einem schizoiden Verhalten. Es wurde erwartet, das man etwas anderes tat und sagte, als das, was man selbst tun wollte und fühlte. Es lief alles gegen die innere Gesinnung.
Jeder Mensch in Deutschland war den Zielen des kleinen Wahnsinnigen mehr oder weniger untergeordnet …
Jedenfalls bedeutete dies einen großen Druck für Marias Seele, natürlich auch für Gustav und für all diejenigen, die diese Zeit durchlebten und die Unwerte als solche erkennen konnten.
Die, die heute noch leben, so wie Maria und Gustav, die nun in einem ländlichen Seniorenheim im Norden Deutschlands wohnen, tragen die Folgen dieser Zeit der Repressionen und Idiotien in Form von Traumata, schizoiden Verhaltensweisen, schweren Jammerdepressionen, Angst- und Panikattacken oder Demenzerkrankungen, weil die Seele sich zurückzieht, da sie so viel Unwahrhaftiges und Traumatisches nicht verkraften kann.
Jedenfalls hatte Maria damals als BDM-Führerin eine Vorgesetzte, die ein überzeugter Nazi war. Deshalb musste Maria vorsichtig mit ihren eigenen christlichen Überzeugungen sein, die denen der Nazi-Anhängerin völlig entgegengesetzt waren.
Nun war es Pflicht, dass diese Vorgesetzte an einem Sonntag zum Mittagessen eingeladen werden musste. Sie wartete im Wohnzimmer darauf zum Essen gebeten zu werden. In dieser Zeit besah sie sich ein Bild, das an einer Wand im Wohnzimmer über einem Buffet hing. Sie schwieg und wirkte nachdenklich, so erzählte mir meine Mutter, die sie zum Essen bat und sich einen Moment lang neben sie stellte. Maria meinte, ein verändertes, nachdenkliches Gesicht bemerkt zu haben. Die Nazi-Anhängerin las einige Sprüche, die in das Bild integriert waren. Es handelte sich um das Bild „Der breite und der schmale Weg“ nach einer Idee und dem Original von Charlotte Reihlen (1888) und einer Ausführung von Paul Beckmann. Es ist eines der vielen Andachtsbilder, die im Laufe der Jahrhunderte zur Illustration der christlichen Werte und des Weges in Kontemplation und der Gotteserfahrung gemalt wurden und den folgenden Vers des Neuen Testamentes, Matthäus 7, Vers 13 bis 14, anschaulich machten:
„Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden.“
Also es ist das Bild, das meine Mutter mir öfter eingehend beschrieben hat, mitsamt dieser Begebenheit ihrer Nazi-Vorgesetzten, die die integrierten Bibel-Sprüche aufmerksam gelesen hatte.
Gezeigt sind auf relativ naive Weise zwei Wege, die jeweils einen Berg hinaufführen. Der eine ist breiter und befindet sich vom Betrachter aus gesehen auf der gesamten linken Bildhälfte – und nimmt viel Platz ein. Am Anfang dieses breiten Weges wird ein großes Tor gezeigt, und zwar mit einer Willkommensheißung in die Welt des Vergnügens, der Zerstreuung und Ablenkung, weiter oben gibt es Auseinandersetzungen, Kriege, ganz oben sieht man Rauch und Feuer und Zerstörung. Diesen Weg beschreiten viele Leute. Die Kleidung und die Schauplätze entsprechen dem Zeitgeist Ende des 19. Jahrhunderts.
Der schmale Weg beginnt mit einem kleinen unscheinbaren Tor mit einer Aufschrift in kleinen Buchstaben: „Das Reich Gottes“. Dieser Weg ist schmal und schlängelt sich einen Berg hinauf. Hier ist nicht viel los. Es sind nur wenige Menschen, die auf diesem Weg wandeln. Der Weg läuft steiler empor bis auf die Bergspitze. Hier oben erstrahlt „Das Reich Gottes“ mit Engeln, eingebettet in eine lichte Wolke, diese befindet sich ganz oben rechts auf dem Bild. Begleitet werden diese beiden Wege mit Bibelsprüchen. Auf dem schmalen Weg, oben links am Bildrand, wo das Feuer mit Blitzen zu sehen ist, steht Vers 22 aus 5. Mose 32: „Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge.“
Ebenfalls ist 2. Petrus 3, Vers 10 im oberen Bildbereich erwähnt: „Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb; dann werden die Himmel zugehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.“
Auf dem Berggipfel des schmalen Weges finden sich Bibelsprüche wie die Verse 11-14 aus dem 5. Kapitel der Offenbarung: „Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her …“
Bevor sich der Mensch nun für den breiten oder den schmalen Weg entscheiden kann, bekommt er noch weitere Informationen, die am unteren Bildrand zu sehen sind: Hier gibt es Grabsteine und Gesetzestafeln, die die 10 Gebote aufzeigen und den Kreislauf von Leben und Tod durch den folgenden Bibelvers verdeutlichen:
1. Korinther 15, 22: „Denn wie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.“
Es gibt nun im 21. Jahrhundert eine aktuellere Version dieses Bildes, und zwar aus dem Jahr 2003, von Holger Klaewer, der den breiten Weg dahingehend „modernisiert“ hat, indem die räumliche Umgebung dem 21. Jahrhundert angepasst ist. Der breite Weg endet auf dieser Darstellung ebenfalls mit einem Feuer, das allerdings den Zusammenbruch des World-Trade-Centers abbildet. Am Ende des schmalen Weges sieht man die Andeutung eines Gottesreiches mit hellen Lichtstrahlen.
Die aktuellste Version dieses Bildes wäre jetzt die Illustration der Atomreaktoren in Fukushima auf dem Berggipfel des breiten Weges … Dieses Bild existiert wahrscheinlich nicht nur in meiner Vorstellung.
Jene Illustration, die helfen soll, den geeigneten Lebensweg und die entsprechende Weltanschauung zu wählen, ist also aktueller denn je und einerseits eindeutig in seiner Aussage und andererseits vielseitig interpretierbar.
Mir sind beide Wege sehr vertraut, und irgendwann wurde der schmale Weg immer schmaler …
Aber ich bin noch gar nicht dran, denn ich bin noch nicht einmal geboren.
Jetzt nach über 70 Jahren habe ich im Internet eine Version dieses Bildes gefunden und es in Form eines Plakates Maria als Geschenk zu ihrem 90. Geburtstag überreicht. Sie hat sich sehr gefreut und fühlte sich an die damalige Zeit erinnert.
Jedenfalls damals in der Bauernstube meiner Großeltern war auch die Nazi-Anhängerin irgendwie eingenommen von diesem Bild, sie wurde blass und schwieg, auch dann noch, als alle beim Mittagessen saßen.
Maria hat das irgendwie sehr beeindruckt, und gleichzeitig hatte sie Angst, zu diesem Bild und dessen Aussagen Stellung beziehen zu müssen. Aber das blieb ihr erspart.
Überhaupt blieb ihr vieles erspart, dennoch war ihr Leben neben einer starken Kraft und Vitalität von Bangigkeit, Traurigkeit und Zweifel geprägt.
Es gab schließlich genügend Gründe für Marias Gemütsverfassung. Sie war sich nicht bewusst, wie die Zeit der Ungewissheit und das Bangen um Leben und Tod an ihrer Seele nagten. Sie war nach außen hin tapfer, so tapfer wie die Soldaten an der Front.
Und Gustav? Gustav erging es nicht anders. Er besaß neben seiner hohen Sensibilität für sich selbst und seine Mitwelt die Gabe, das Gute in jeder Situation zu sehen. Ein Krieg bringt natürlich nichts Gutes, aber die Menschen bleiben Menschen, wenn sie es wollen und vor allem, wenn sie es können – wenn sie die in ihren Köpfen noch bestehenden Feindbilder abbauen, dann kann manchmal der Nährboden für Frieden entstehen.
Jedenfalls betrachtete Gustav sich nicht als „Krieger“, sondern mehr als guten Menschen, der das Leben liebte und das gleiche den Anderen zugestand. Er berichtete mir häufig, wie schön Griechenland sei und vor allem die Griechen selbst, wie gut der Kontakt gewesen sei, und ebenso sei sein Eindruck von Italien gewesen.
Dennoch war Gustav Soldat im 2. Weltkrieg und hatte die Aufgabe bei der „FLAK“ „feindliche“ Flugzeuge zu erspähen und seine Entdeckungen an die Schießkommandos weiterzugeben. Wie viele Flugzeuge er entdeckt und zum Abschuss freigegeben hatte, weiß ich nicht. Er selbst hat also nicht Auge in Auge getötet, er gehörte aber zum Tötungssystem dazu. Vielleicht hat er auch Flugzeuge übersehen, wahrscheinlich – hoffentlich viele! Darüber hat er später nicht gesprochen.
Jedenfalls wollte er nicht töten und konnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Auch er handelte gegen seine innere Überzeugung. In einem totalitären Regime ist der Mensch zu vielem gezwungen, wenn er selbst überleben will.
Gustav hatte viel Glück in einer Zeit der Idiotien und Unberechenbarkeiten. Er bekam Sonderurlaub im Sommer 1944 und durfte nach Hause, das damals noch eines war oder auch nicht. Er war zu seiner eigenen Hochzeit mit Maria gekommen.
Sie wurde allerdings auch in dieser angespannten Kriegszeit gefeiert. Mit vielen Kutschen kamen die Gäste, die vielen Verwandten, Freunde und Nachbarn angereist und wurden mit wohl schmeckenden Speisen aus der ländlichen Region beköstigt. Alle freuten sich beieinander zu sein, obwohl die Traurigkeit und die Angst als vorherrschende Stimmung an den Gesichtern der Gäste abzulesen waren. Viele der männlichen Verwandten, Freunde und Bekannten waren im Krieg und andere waren bereits tot.
So war die weiße Hochzeit auch eine schwarze und ein Schatten lag über der lichten Feier. Dennoch waren Maria und Gustav glücklich, sie waren ein wunderschönes Paar. Maria hatte schulterlange schwarze Locken, eine weibliche Figur und ein stilles wunderschönes Lächeln. Sie trug ein weißes Spitzenkleid mit einem weißen Rüschenschleier. Gustav hatte dicke schwarze Haare und wunderschöne große hellblaue Augen, er war sehr schlank und trug einen schwarzen maßgeschneiderten Anzug mit einer Fliege und einem strahlend weißen Hemd. Sie wurden in einer eindrucksvollen evangelischen Kirche in der benachbarten Stadt getraut.
Als ich noch ein Kind war, wurde ich häufig von Verwandten, die nach dem 2. Weltkrieg in die USA ausgewandert waren und die uns besucht hatten, darauf aufmerksam gemacht, was für ein außergewöhnlich schönes Paar meine Eltern bei ihrer Hochzeit und auch sonst gewesen seien.
In der Tat liebten sich Gustav und Maria sehr und sie wussten, dass Maria schwanger war. Beide bekamen viele Hochzeitsgeschenke, darunter war auch ein wunderschöner Zwerghahn mit den entsprechenden Zwerghühnern. Maria hatte sich sehr darüber gefreut.
Bereits zwei Tage nach der Hochzeit musste Gustav wieder zurück an irgendeine Kriegsfront. Der Abschied fiel ihm schwer. Die Angst, Maria und sein zu Hause nicht wiedersehen zu können, war nicht nur unterschwellig da. Aber nicht nur er hatte Angst vor einem Abschied für immer, auch seine Mutter, seine Schwestern und vor allem Maria. Sie freute sich auf ihr Kind und auf ein Wiedersehen, aber die Zweifel, ob Gustav überhaupt wieder zurückkäme, waren ebenso stark vorhanden.
Jedenfalls wurde es eine Zeit des Wartens, der Schreckensmeldungen, der Angst und der Traurigkeit, aber auch der Liebe, der Verbundenheit und Zuversicht.
Im Laufe des Jahres 1944 spitzte sich die Kriegssituation für alle Beteiligten zu und alles deutete daraufhin, dass die Ostfront immer näher rückte. Die russischen Soldaten waren im Vormarsch. Irgendwann erfuhren das über die Volksempfänger auch die Ost- und Westpreußen, die Pommern und die Schlesier, alle Deutschen, die in den Ostgebieten, im heutigen Polen lebten.
Und irgendwann war klar, dass sie weg mussten – auf die Flucht. Es wurde genäht, gestrickt, geschlachtet, Wurst gemacht, eingekocht und es wurden Lebensmittel gehortet und verpackt. Die Wagen für den Treck, der sich aus dem Dorf in Richtung Westen bewegen sollte, wurden vorbereitet. Die meisten Deutschen im Osten begaben sich bereits im Herbst 1944 auf die Flucht, so war es auch im kleinen Dorf S. Viele Nachbarn, Freunde und Bekannte waren schon weg. Maria und Gustavs Familie waren noch übrig. Maria hatte alles gepackt, ebenso ihre und Gustavs Eltern. Sie waren bereit zu fliehen.
Diese Zeit des Wartens war bereits eine Zeit der Heimatlosigkeit, des Abschiednehmens, des nicht mehr Geborgenseins, des Ungeborgenseins, des Unbeheimatetseins, der Ungewissheit, des Zweifels, der Angst und dennoch eine Zeit des Mutes, der Zuversicht in eine unbekannte Zukunft. Es sollten sich nicht alle Deutschen zugleich aufmachen, damit die Straßen und Wege nicht alle „verstopft“ wären.
Es war in dieser Situation besonders schwierig, im Hier und Jetzt zu sein, da die gepackten Taschen, Pakete und Koffer schon die geplante Flucht spüren ließen. Der Aufbruch war noch nicht möglich und das „normale“ Leben auf dem Bauernhof, das es schon längst nicht mehr gegeben hatte, gehörte der Vergangenheit an. Das Jetzt, das aus Warten bestand, war unerträglich. Die Angst - dabei handelte es sich auch um Todesangst - wurde immer schlimmer.
Maria wartete auf Gustav, hatte schon länger nichts mehr von ihm gehört, und so war sie unruhig und zweifelnd. Aber irgendeine Kraft in ihr, es war mehr als die pure Überlebensenergie, hatte alles sorgfältig und auf hoffnungsvolle Weise vorbereitet.
Für die Soldaten, die im Krieg waren, war eine totale Urlaubssperre verhängt
worden, das betraf auch Gustav. Manchmal hoffte Maria insgeheim, dass Gustav ja vielleicht doch kommen könnte, einen Sonderurlaub erhalten und zur Geburt ihres Kindes da sein würde. Manchmal war sie verzweifelt und manchmal auch zuversichtlich. So ging es wohl den meisten Deutschen und allen anderen auch, die fliehen wollten oder die bereits auf der Flucht waren. Sie hatten Angst, wussten, dass sie ihre Heimat verlassen mussten und in die Heimatlosigkeit gingen. Dennoch war irgendeine Stärke in ihnen, die an das Leben glaubte. In jedem Lebewesen, auch im verzweifelten Menschen, steckt eine erstaunliche Lebenskraft.
Jedenfalls war es bereits Dezember 1944 und immer mehr Dorfbewohner waren schon weg, auf der Flucht gen Westen. Gustavs Schwester Frieda war bereits „im Reich“, so wurde gesagt, wenn Menschen aus den östlichen Gebieten in den Westen Deutschlands gegangen waren. Sie war mit einem Berliner Geschäftsmann verheiratet, mit dem sie in eine norddeutsche Kleinstadt gegangen war.
Maria war hochschwanger. Es war Heiliger Abend und es gab immer noch keine Nachricht von Gustav.
Plötzlich traten die Wehen ein, die Hebamme aus dem Nachbardorf wurde geholt und um 20 Uhr am Heiligenabend wurde die kleine Lena geboren, die als Lichtblick das Licht und die Dunkelheit der Welt erblickte.
Allen kam es wie ein Himmelsgeschenk vor, und so war es auch.
Aber ein Schatten lag über dem lichten Weihnachtsstern: Wo war Gustav? Wo waren die Brüder Fred und Ernst?
Alle weinten, auch wenn es nicht zu sehen war. Es fand innen, ganz tief in der Seele statt. Nur Lux, Gustavs Schäferhund, weinte laut. Er jaulte fast Tag und Nacht und fraß kaum noch etwas. Und ein paar Tage nach Weihnachten fing Lux an zu winseln und laut zu jaulen, aber anders als sonst. Es war Abend und schon dunkel, und Maria sah jemanden auf den Hof kommen und konnte nur die Konturen erkennen. Sie ging vor die Tür und sah, wie Lux sich von der Kette losgerissen hatte, auf den Fremden zusprang und vor Freude winselte. Und dann kam dieser Jemand näher, und es war Gustav.
Maria hatte sich so sehr erschrocken, da sie mit ihm nicht rechnete und daher dachte, es sei ein Geist. Sie hatte sich nicht vorstellen können, dass Gustav in dieser Zeit kommen würde. Es dauerte, bis Maria sich freuen konnte, ihren Gustav in den Armen zu halten. Es war ein großes Wunder!
Gustav hatte Sonderurlaub bekommen, er konnte es selbst kaum fassen. Marias Vater hatte ein Telegramm zu Gustavs Kompanie geschickt und mitgeteilt, dass er Vater geworden ist.
Gustavs Kompaniechef hatte ihn wegen des Telegramms zu sich gebeten. Gustav hatte etwas Furchtbares erwartet, doch dann sagte sein Vorgesetzter: „Herzlichen Glückwunsch! Ihre Familie braucht Sie jetzt. Sie bekommen Sonderurlaub! Was können wir denn hier noch ausrichten!? Abtreten!“
Und nun war Gustav wieder zu Hause, das nun keines mehr war. Alle Räume waren mit Taschen, Koffern und Bündeln vollgestellt. Alle freuten sich, dass Gustav wieder da war, seine Schwester, sein Stiefvater und seine Mutter, die Bediensteten. Und dann bekam er das kleine Lenchen auf seinen Arm, er weinte vor Freude und wusste, dass dies ein Christuskind, ein Kind des Himmels ist, denn seine Geburt war der Grund für diesen wundersamen Sonderurlaub. Es waren Momente der Rührung und des Glücks und der Liebe.
Wahrhaftig empfinden können wir nur den Augenblick ohne Gestern, ohne Morgen. Wenn wir uns nicht so sehr als geschichtliche Wesen mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren würden, dann wäre das Leben wahrscheinlich erträglicher! Aber so einfach ist das nicht! Jede Tat, jede Situation ist mit vielen unterschiedlichen Gefühlen und Gedanken verbunden, sodass diese je nach Intensität im Gehirn gespeichert werden. Diese „Momentaufnahme“ kann dann je nach Inhalten in der bewussten Erinnerung oder aber auch auf der unbewussten Ebene entweder Schmerzen oder Freude bereiten.
Jedenfalls war das Glück des Wiedersehens überschattet vom nahenden Abschied. Das kleine Dorf S. war nicht mehr das, was es vorher einmal war. Es war Heimat gewesen, der Ort der Kindheit, der Vertrautheit, mit der Landschaft, mit den Häusern und Ställen, mit den Tieren und den Menschen und deren Gewohnheiten und Ritualen.
Da die meisten Dorfbewohner, darunter auch Freunde und Bekannte, schon aufgebrochen waren, war dieses Dorf nicht mehr Heimat, nicht mehr Geborgenheit. Es war wie ein Ort im Nirgendwo und eine Zeit des Nichts, und dennoch war da Hoffnung: Die kleine Lena, das Resultat von Marias und Gustavs Liebe, wies auf die Zukunft hin, egal, wo sich diese befinden würde, es würde einen Ort geben, wo sie miteinander glücklich leben könnten, auch wenn sie noch nicht wirklich wussten, wo sich dieser befand. Hier mussten sie weg, weg gen Westen, irgendwohin! Im „Reichsdeutschland“ würde es eine Möglichkeit geben, so hofften Maria und Gustav und deren Familien.
Vertreibung und Flucht stellt wohl das größte Trauma für den Menschen dar, es erinnert ihn auf der tiefsten Ebene seines Seins an die Vertreibung aus dem Paradies.
Von diesem war der Mensch besonders im 20. Jahrhundert sehr, sehr weit entfernt. Es hat wohl im Laufe der langen Menschheitsgeschichte nie so viele Massenmorde gegeben wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es waren Menschen deportiert worden: Die Polen von den Russen, die Polen und Russen waren von den Deutschen attackiert und die Deutschen waren schließlich von den Polen und Russen vertrieben worden. Es wurde gemordet, vergewaltigt, verstümmelt – alle erdenklichen Grausamkeiten wurden von Menschen an Menschen begangen, und zusätzlich gab es den zweiten unermesslich schrecklichen Genozid an den Juden, Zigeunern, Kranken und Andersdenkenden: Konzentrationslager, in denen Menschen bis zum Umfallen und Verhungern sinnlose Arbeit verrichten mussten, mit Willkür gequält und gefoltert wurden, ständiger Todesangst ausgesetzt waren und systematisch in organisierter perfekter Form mit Gift aus Duschen vergast wurden. Es ist unvorstellbar, jenseits aller Worte und Menschlichkeit.
Einen Genozid hatte es bereits früher gegeben, der während des ersten Weltkrieges zwischen 1915 und 1917 stattfand. Es waren die Armenier, die aus der Türkei deportiert worden waren.
Es gab drei hauptverantwortliche türkische Diktatoren, die Macht besessen und habgierig die Armenier berauben, vertreiben und ermorden wollten und es auch taten. Der vorgegebene scheinbare Grund hierfür war die angeblich mangelnde Solidarität einiger Armenier gegenüber dem türkischen Staat. Die Armenier, die als Christen innerhalb der Türkei lebten, und deshalb den Moslems ein Dorn im Auge waren, stellten genau wie die Juden in Deutschland einen Teil der Intellektuellen dar, die innerhalb der Gesellschaft das Know-How für damalige technische und soziale Bereiche im Staat hatten. Sie waren Techniker, Ärzte, Rechtsanwälte, Kaufleute usw. Sie waren besonders tüchtig. Da beschlossen diese 3 Diktatoren diese Menschen ihrer Existenz zu berauben und zu vertreiben. Dabei wurde das ganze Volk der Armenier mit einbezogen. Sie mussten ihr persönliches Hab und Gut abgeben und wurden „deportiert“, d. h. es wurde vorgegeben, sie bekämen irgendwo einen anderen Ort, an dem sie leben, sein könnten.
Das jedoch war eine große Lüge und diente auch außenpolitisch als Vorwand für eine Rechtfertigung für einen nicht vorstellbaren Massenmord und unendliche Grausamkeiten an unschuldigen Menschen. Vorgeworfen wurde den Armeniern, sie seien nicht konform mit der türkischen Regierung.
Als Beispiel hierfür benutzten die Diktatoren einige Wenige, die als Verräter benannt wurden und deshalb sollte das ganze Volk mit dieser „Deportation“ bestraft werden. Die Türken übernahmen das zurückgelassene Gut der Armenier. Der Wahnsinn bestand darin, dass das gesamte Armenische Volk von vornherein ausgerottet werden sollte. Es gab gar keinen Ort, wo sie hätten leben sollen und können. Sie wurden buchstäblich in die Wüste geschickt.
Und der Weg dahin war der Weg des Mordens und der unermesslichen Folterungen und Vergewaltigungen. Es war ein Weg des größten unermesslichen Leidens überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Man ließ die Menschen verhungern, Frauen, Babys, Kinder, Jugendliche und Männer. Es gab ein unvorstellbares Leiden ohne Ende, sie waren der Willkür und den Grausamkeiten der türkischen Armee ausgesetzt. Die anderen Nationen schwiegen, niemand bezog Stellung. Auch die Deutschen als Verbündete mit der Türkei sahen zu und unternahmen nichts. Nur Krankenschwestern, Ärzte und Missionare, die aus Schweden, Dänemark, Niederlande und Deutschland kamen, halfen in Waisenhäusern und auf dem Weg der Deportation. Dieses unvorstellbare Elend menschlichen Seins war nicht durch einzelne Personen ohne Lobby zu lindern! Es waren sogar noch viel mehr Menschen, die sterben mussten, als die 6 Millionen, die beim Holocaust auf die brutalste Weise in ein unerträgliches Leid, in unendlichen Schmerz und Verzweiflung getrieben worden und ausgerottet worden sind. Es gab nur wenige von den Armeniern, die diesen Genozid überlebt haben. Dieser Genozid wird noch heute zum größten Teil geleugnet!
Jedenfalls zeitlich befanden sich die beiden Familien von Maria und Gustav und die anderen übrig gebliebenen Dorfbewohner von S. und all die anderen, die sich auf die Flucht gen Westen begeben wollten oder bereits schon unterwegs waren, zwischen diesen beiden Genoziden. Es war wohl eine der dunkelsten Epochen seit Beginn der Schöpfung!
Drei Wochen nach Lenas Geburt sollte es losgehen. Mein Großvater, Marias Vater, klopfte an die Fensterscheibe von Marias und Gustavs Schlafzimmer in Gustavs Bauernhaus, das er von seiner Mutter übernommen hatte. Es war Mitte Januar 1944, sehr kalt, 25 Grad minus, verschneit und fünf Uhr morgens. Er sagte eindringlich, während er klopfte: „Kinder, es ist so weit!“
Es war das schrecklichste Klopfen, das Gustav und Maria je gehört hatten. Gustav mochte während seines späteren Lebens nicht, dass jemand an eine Scheibe klopft, er fühlte sich immer an jenes Klopfen erinnert, das das Verlassen der Heimat signalisierte.
Die beiden Familien und die anderen Dorfbewohner begaben sich mit ihren gepackten Planwagen auf die Flucht, die Pferde wurden noch getränkt, sechs von ihnen wurden vor den Planwagen gespannt, und zuletzt ließen sie die anderen Tiere auf den Bauernhöfen frei.
Und alle weinten, nicht nach außen, aber so tief in ihrem Inneren, dass dies ein Leben lang anhielt. Ihre geliebten Tiere, wie die Kühe, Ziegen, Hühner, Enten, Gänse, Katzen, Schafe und Hunde schienen diese Freiheit gar nicht zu wollen. Sie standen verloren und verunsichert herum und schienen ihren bisherigen Versorgern hinterherzuschauen. Lux, der treue Schäferhund, war bereits von Plünderern an deren Wagen gebunden worden. Er hatte gejault und war nicht mitgelaufen, sondern er hatte zurückgeschaut und sich davonschleifen lassen.
Diesen Moment hat Gustav nie vergessen. Er hatte immer Tränen in den Augen, wenn er später davon erzählte, und das hatte er sehr oft, wenn er über diese Zeit sprach.
Marias Lieblingsschafsbock blieb direkt vor dem Haus stehen, als wollte er das Haus verteidigen.
Maria weinte nach innen. Und sie weint auch heute noch tief in ihr Innerstes, allerdings nun auch nach außen, wenn sie ein Schaf sieht, sogar, wenn es nur aus Keramik ist, wie z. B. im Eingang ihres Alterswohnsitzes. Dieses Keramikschaf steht als österliche Dekoration auf einem kleinen Tisch und soll eigentlich die alten Gemüter erfreuen, löst aber bei Maria eine starke Traurigkeit aus.
Damals auf dem Hof meiner Eltern und Großeltern gab es wie selbstverständlich die artgerechte Tierhaltung und Achtung vor dem Mitgeschöpf, so wurde nur einmal in der Woche Fleisch gegessen! Die Tiere wurden geliebt, geachtet und entsprechend gut behandelt.
Heutzutage gibt es in den USA ungefähr nur 10 Schlachthöfe für das ganze Land und die Bedingungen des Schlachtens sind unvorstellbar grausam, weil es auf so massenhafte Weise innerhalb einer kurzen Zeitspanne vorgenommen wird!
Damals rollten die Wagen mit den angespannten Pferden an und eine lange kurze Reise begann. Die Straßen waren verstopft. Alle Menschen in der östlichen Region, die nicht von den russischen Truppen eingeholt werden wollten, begaben sich zu dieser Zeit auf die Wege und Straßen, mit Planwagen und mit dem mühevoll eingepackten Hab und Gut. Auch Maria hatte alles dabei, vor allem auch dicke Federdecken und -kissen gegen die Kälte, Lebensmittel und Kleidung.
Wertgegenstände waren zurückgelassen worden, aus Angst davor, ausgeplündert und ermordet zu werden.
Lenchen war fest in ein Federkissen eingepackt.
Sie kamen nur schleppend voran und waren nach einer Woche noch nicht sehr weit gekommen. Es waren Schüsse zu hören und die russischen Panzer nahten.
Die Flüchtlingswagen machten gerade Halt auf einem geplünderten Bauernhof, sonst wo, nicht weit ihrer jetzt schon Nicht-Heimat. Es kam, wie es nicht hätte kommen dürfen oder sollen: Es fuhr ein russischer Panzer auf den Hof. Das Herz schlug Maria bis zum Hals und den anderen Flüchtlingen, die sich auf diesem Hof eingefunden hatten, erging es nicht anders.
Gustav wurde von vier russischen Soldaten, die ihre Karabiner im Anschlag hatten, an die Wand gestellt, mit erhobenen Händen. Maria, ihre Eltern, ihre Geschwister, Gustavs Mutter, der Stiefvater, seine Schwester und er selbst erstarrten innerlich vor Angst. Da jedoch geschah ein Wunder, es kam gerade zu dieser Zeit Hilfe, in dieser Sekunde, eigentlich ging es um Sekunden, auch wenn es quantenphysikalisch keine Zeit und keinen Raum gibt, sondern nur ein Kontinuum von Raum und Zeit!
Jedenfalls damals in jenem Zeitkontinuum kam eine Polin zur rechten Zeit an den rechten Ort gelaufen und rief: „Nicht schießen, nicht auf den!“, und zeigte auf Gustav. „Das ist unser Junge, das ist unser Junge! Das ist ein Guter!“ Die Soldaten nahmen ihre Gewehre herunter und sprachen mit der Polin! Gustavs Leben war gerettet, zunächst einmal!
Das ist für diejenigen, denen so etwas nicht widerfahren ist, wohl kaum vorstellbar.
Die Polin war die Mutter zweier Söhne, mit denen Gustav befreundet gewesen war, und denen er treu zur Seite gestanden hatte. Hier hatte das Resonanzgesetz gewirkt: „Wie man/frau in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!“
Alle waren erleichtert, allerdings nur für den Moment. Die Angst, diese Begebenheit könne sich wiederholen, blieb und verstärkte sich noch.
Ähnliche Situationen wiederholten sich tatsächlich. Sie waren immer einzigartig in ihrer Dramatik und in ihrem Schrecken und in ihren Auswirkungen auf die bereits verängstigten Seelen. Gustav blieb tatsächlich verschont, er musste nicht sterben, er blieb unversehrt und es war jedes Mal ein Wunder.
Die Deutschen glaubten, er sei ein Deserteur, denn dass Gustav trotz einer totalen Urlaubssperre nun Sonderurlaub hatte, das war unglaubwürdig, weil zu dem Zeitpunkt damals jeder junge Deutsche Mann Soldat war.
Deshalb hätten die Deutschen einen Grund gehabt ihn zu erschießen. Für die Polen und Russen war er ein Nazi-Deutscher, der als Soldat gegen sie gekämpft hatte, deshalb war er auch von dieser Seite ständig bedroht.
Da Gustav in Zivil war, waren die russischen Soldaten zunächst zögerlicher, aber die Gefahr getötet zu werden, war für Gustav dadurch nicht gemindert. Überhaupt waren alle Deutschen, die auf der Flucht waren, vom Tode bedroht. Maria und alle anderen Familienmitglieder waren ebenfalls gefährdet. Sie hatten von Beginn der Flucht an am Wegesrand viele Tote gesehen, junge und alte, viele, die sie gekannt hatten, einige waren verblutet, verstümmelt, grausam zugerichtet. Sie konnten nicht Halt machen, niemanden beerdigen. Sie hätten selbst jederzeit dran sein können.
Jetzt waren sie alle in den Händen russischer Soldaten und wurden dazu gezwungen, zurückzufahren. Wohin zurück? In ihre Heimat! Sie waren alle irgendwie zwischen Raum und Zeit, sie mussten zurück ins Nichts!
In S. angekommen erkannten sie fast gar nichts wieder. Die Menschen und auch die Tiere waren weg. Gustavs Bauernhaus war zerschossen und geplündert! Über dem Buffet im Wohnzimmer hing das Portrait von Gustavs Vater schief nach unten und war mit Kugeln durchlöchert.
Hierher mussten sie nun zurückkehren und hatten nichts anderes als Überlebensangst. Diese Angst wurde auf tiefer Ebene Bestandteil ihres Lebens.
Jedenfalls musste auch hier das Leben weitergehen, wenn es nicht gewaltsam beendet würde. Lenchen, das Baby, hatte Hunger. Maria konnte keine Muttermilch mehr zur Verfügung stellen, da Angst und Schrecken die Quelle des Lebens versiegen ließen.
Wenn Menschen sich als Menschen fühlen, auch wenn Krieg ist, dann gibt es Frieden, Frieden im Hier und Jetzt. So war es hier geschehen. Die russischen Soldaten blieben draußen auf dem Hof. Ein hochrangiger russischer Offizier mit jüdischen Wurzeln sprach ein wenig deutsch und gab Anweisungen, eine Kuh zu besorgen, damit Lenchen nicht verhungern musste. Und eine Flasche Schnaps sollte den Kriegsabend erträglicher machen.
Marias Eltern, Gustavs Mutter, sein Stiefvater, seine Schwester Magda, alle befanden sich in Gustavs jetzt ehemaligem Vaterhaus, außer Fred, der an der russischen Front war, und Gustavs Bruder Ernst, der ebenfalls als Soldat Deutschland an der russischen Front verteidigen sollte, wo die Grenzen gar nicht hingehörten.
Maria stand in der Küche, mit Lenchen auf dem Arm. Die Angst war immer da und Entsetzen, dass dies nun ihr Zuhause gewesen sein sollte – alles war weg, nur eine Küchenuhr an der Wand gab irgendeine Zeit an.
Sie alle konnten ihre Angst nicht mehr spüren und auch nicht ihren Hunger, sie standen unter Schock und agierten nach außen wie mechanisch, als seien sie der Schatten ihrer selbst. Tatsächlich besorgten zwei russische Soldaten eine Kuh, die sie im Ortskern auf irgendeinem Hof noch gefunden hatten. Maria molk diese Kuh und irgendein Töpfchen fand sich noch in einem Hängeschrank in der Bauernküche. Die Milch wurde darin aufgekocht und für Lenchen wohltemperiert in einem Fläschchen zubereitet. Sie musste nicht hungern, nicht verhungern, wie so viele andere Babys, die mit ihren Müttern irgendwo auf der Flucht waren.
Auch die anderen konnten noch etwas essen, irgendetwas aus den Vorräten im Wagen. Was sie mühsam eingepackt hatten, davon konnten sie sich jetzt nehmen. Sie aßen aus irgendeinem Zwang heraus, aus einem Überlebensdrang heraus, nicht weil das Essen schmeckte oder irgendein Appetit sich einstellte.
Das und auch Gefühle wie Trauer, Wut, Traurigkeit und derartige Seelenzustände konnten sie nicht fühlen.
Maria freute sich über Lenchens Milch und dass es nun fest eingewickelt im Federkissen einschlafen konnte. Plötzlich traten drei russische Soldaten in die Küche und verlangten, dass Maria mit ihnen nach nebenan gehen möge. Das Herz schlug ihr bis zur Fontanelle, und als sie mit den Soldaten allein im Raum war, dachte sie an das Schlimmste, was einer Frau widerfahren kann. Die Soldaten klopften Maria ab, sie hatte eine Art Trainingsanzug an. Sie war sehr hübsch trotz ihrer zweckmäßigen Kleidung. Dennoch bedeutete das Abklopfen nichts anderes als die Gier der Soldaten nach verstecktem Schmuck. Dass die Frauen, jedenfalls Maria und ihre Mutter und Schwiegermutter, wegen möglicher Plünderungen und Raubmorde ihren gesamten Schmuck zurückgelassen hatten, kam Maria zugute.
Sie hatte nichts bei sich und die Soldaten ließen Maria wieder zu Lenchen. Sie sahen in ihr die Mutter und hatten entweder auf einer menschlichen Ebene agiert oder aber auf der Instinktebene, nämlich Mutter und Baby zu schützen. Wie auch immer, sie taten ihr und auch den anderen nichts, vielmehr waren sie höflich und verhielten sich so, als ob sie den Krieg nicht wirklich verstanden hätten. Der russische Offizier saß auf irgendeinem übrig gebliebenen Sitzmöbel und wollte mit allen Schnaps trinken. Was das bedeuten konnte, wussten Maria und auch die anderen Familienangehörigen. Russische Soldaten vergewaltigten und mordeten häufig in betrunkenem Zustand. So konnten sie sich auf animalische Weise dafür rächen, dass der Krieg von den Deutschen angezettelt worden war und auf grausame Weise ausgetragen wurde.
Jedenfalls fragte der Offizier, ob jemand mit ihm Schnaps trinken wolle. Alle verneinten, Gustav und Marias Vater konnten russisch sprechen und der russische Offizier versuchte sich in der deutschen Sprache. Gustav fühlte, dass er Ja sagen müsse, sonst würden die russischen Soldaten beleidigt sein. Er ließ sich einladen und trank mit dem Offizier und den beiden Soldaten. Der Offizier wandte sich Gustav zu, schaute auf Maria, die das Baby schaukelte, und sagte: „Trrrienken wir auf eiin neies Deitschland!“ Gustav hielt das für eine gefährliche Provokation und antwortete vorsichtig ängstlich: „Es wird kein Deutschland mehr geben!“ Der Offizier fuhr unbeirrbar in gebrochenem Deutsch fort: „Wier trienken auf eiin neies Deitschland, niecht auf Chitler, niecht auf Gebbels, nicht auf Geeerrring, aber auf ein neies Deitschland!“ Gustav trank mit ihnen bis zum Morgengrauen und fühlte sich entsprechend einem, der vogelfrei stets mit allem rechnen musste. Irgendwie haben alle in jener Nacht in irgendeiner Ecke mit irgendwelchen Decken geschlafen, in einem Haus, das einmal ein Zuhause gewesen, das jetzt nur noch eine Unterkunft war. Das Gefühl von Heimatlosigkeit war nicht zu spüren, es war gar nichts zu spüren, außer einem ungebrochenen Überlebensdrang.
Ich schreibe jetzt gegen die Zeit oder mit der Zeit, jedenfalls liegt Gustav seit mehr als einem halben Jahr im Sterben und Maria fühlt sich heimatlos, heimatloser als in jener Zeit, und empfindet eine unerträgliche Traurigkeit. Maria ist erschüttert von einer nicht auszuhaltenden Schwere im Herzen, da sie Abschied von Gustav nehmen muss, der sie 90 Jahre lang begleitet hat und für sie Heimat gewesen war. Hinzu kommen auch Gefühle von jener Traurigkeit und Heimatlosigkeit, die sie auf der Flucht hatte, die sie allerdings unterdrücken musste, um überleben zu können. Das alles überwältigt Maria und bestimmt seit dem ihr Leben.
Irgendwie weiß ich nicht genau, warum ich mir diese Eltern ausgesucht habe, in der Zeit der Feinstofflichkeit, aber irgendwie weiß ich auch genau, warum sie es waren, die meine Wahl getroffen hat.
Die Deutschen, die von den russischen Soldaten wieder in ihre Nicht-Heimat zurückgeschickt wurden, erfuhren ähnliches Leid, wie ihre Kriegsgegner es durch die Deutschen hatten erfahren müssen. Das betraf auch Maria und Gustav und deren Familienangehörige. Dennoch waren sie irgendwie noch davongekommen, sie erlitten nicht die Brutalität, die die deutsche Armee teilweise an den Russen und Polen angewandt hatte.
Gustav und Maria wurden in eine Art Lager eines benachbarten Dorfes gebracht. Dort mussten sie arbeiten und bekamen kaum etwas zu essen. In jenem Lager trafen sie auch andere Deutsche, deren Flucht missglückt war. Einige wurden geschlagen. Es waren Polen und Russen, die diese Deutschen dort in Gefangenschaft hielten. Gustavs Mutter, die ich bis zum heutigen Tage, in Gesprächen die „Kleine Oma“ nenne, weil sie im Alter sehr zierlich und klein von Statur, aber groß an menschlicher Wärme war, hatte ihr kleines Kirchengesangbuch mitgenommen, und sang leise daraus, wenn sie irgendeine kleine Ecke für sich alleine fand: „Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte: Bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt Herz und Gemüte: Bis hierher hat er mich geleit`t. Bis hierher hat er mich erfreut, bis hierher mir geholfen.“ Auch die weiteren zwei Strophen sang sie mutig, demütig und gläubig.
Dennoch musste sie viel Schwieriges in ihrem Leben erleiden, der frühe Tod ihres Mannes, ihrer Töchter. Wahrscheinlich gerade deshalb war sie so stark in ihrem Glauben und so bescheiden und voller Liebe.
Sie hatte dieses Lied auch immer gesungen, wenn sie bei uns zu Besuch war, sie blieb meistens zwei Monate bei uns und sang und betete dann jeden Morgen und Abend für alle ihre Kinder, die sie noch hatte, ihre Schwiegerkinder und Enkelkinder. Sie schlief im Zimmer neben meinem und ich konnte die Gebete immer hören. Sie zelebrierte dann eine kleine Andacht mit vielen Liedern:„Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit …“ oder „Befiehl Du Deine Wege und was Dein Herze kränkt …“
Aus jenem Gesangbuch der „kleinen, großen Oma“, das sie über die Flucht und Gefangenschaft hinaus gerettet hatte, singt jetzt täglich Maria im Seniorenheim diese Lieder und weint viel. Es sind die Tränen der Angst, Verzweiflung und Trauer, die sie damals nicht weinen konnte und es sind auch die Tränen der Sehnsucht, des Heimwehs und des Abschiednehmens von Gustav, ihrem geliebten Mann. Das klingt romantisch, ist es aber nicht, es ist erlebt, erfahren, erduldet und erlitten.
Trotz ihrer Zuversicht musste die kleine Oma damals, als sie in Gefangenschaft bei den Polen lebte, erleiden, dass ihre Tochter Magda, die auch Zwangsarbeit verrichten musste, eines Tages nicht mehr aufzufinden war. Es hieß, sie hätte eine Fischvergiftung gehabt und sei daran gestorben und deshalb sei sie sofort „separiert“ worden. Meine Großmutter hat Magdas Leiche nie gesehen. Sie war unendlich traurig und verzweifelt und dennoch weiterhin stark in ihrem Glauben und in ihrer Liebe. Sie hat mir davon erzählt, als ich 13 Jahre alt war, sie weinte und sagte: „Ich möchte nach Polen, ich möchte sie suchen!“ Ich verstand ihre Traurigkeit und konnte mitfühlen und auch diese Verzweiflung darüber, nicht einmal die Toten bestatten zu können!
Während der Gefangenschaft in Polen war es kaum erträglich für sie, die Zwangsarbeit durchzuhalten und ihr Kind jeden Tag zu vermissen und nicht zu wissen, wie Magda gestorben ist. Da Magda erst 18 Jahre alt, sehr zierlich und zerbrechlich war und harte Arbeit nicht gewohnt, war meiner Oma klar, dass sie von den Polen umgebracht worden war, weil sie für die Arbeit nicht tauglich und deshalb aus deren Sicht nur eine Belastung war.
Das alles war fürchterlich und traurig und zeigte die Idiotie, die Kriege und besonders dieser 2. Weltkrieg mit sich brachte. Den Deutschen in den russischen und polnischen Gefangenenlagern wurde genau das zugefügt, was sie den anderen Menschen angetan haben, die sie als Feinde und nicht als Menschen betrachteten. Es gab allerdings immer auch diejenigen, die sich nicht als Deutsche, Polen, Russen oder sonst wer fühlten, sie waren einfach Menschen im wahrhaftigen Sinne, voller Güte, voller Leben, voller Weitsicht wie der russische Offizier, der Lenchen zu einer Kuh verhalf, so dass sie nicht verhungern musste.
Gustav und Maria mit Lenchen erging es unter den Umständen der Zwangsarbeit auch nicht besonders. Gustav hatte bei der Zuweisung von Schlafplätzen für Maria und sich – auf einem nackten Steinfußboden einer großen Scheune inmitten einer Vielzahl von Menschen – zu den polnischen Aufsehern gesagt: „Da oben ist ein Dachboden, dort wollen meine Frau und ich schlafen, schließlich sind wir ein jung verheiratetes Paar.“ Gustav hatte dies mit so viel Überzeugung und Nachdruck gesagt, dass die beiden mit Lenchen tatsächlich für eine Nacht oder mehr dort oben schlafen konnten.
Zu essen gab es kaum etwas und Lenchen wurde zwischendurch bei ehemaligen Bekannten untergebracht, hier bekam sie ihre Fläschchen und Maria traf eine arme polnische Bäuerin, deren große Familie Marias Eltern regelmäßig mit Mehl, Brot und Fleisch unterstützt hatten. Maria denkt noch heute daran, wie sie das als Kind mitbekommen hatte, wenn diese Bäuerin die geschenkten Lebensmittelgüter entgegennahm und dann jedes Mal zu ihren Eltern sagte: „Vergelt´s euch Gott, ich werde es euch einmal zurückgeben!“ Maria hatte damals als Kind gedacht: „Wie soll das möglich sein, wie will diese arme Frau uns das jemals wiedergeben?“
Jedoch in jener Zeit der Zwangsarbeit, des Hungers und der Not kam genau jene arme Bäuerin vorbei und brachte Maria und Gustav etwas zu essen, aus tiefer Dankbarkeit und einem aufrichtigen Mitgefühl heraus. Maria konnte sich genau an die verheißenden Worte der Bäuerin erinnern.
Es geschahen immer wieder kleine und große Wunder in jener Zeit der Angst und der Not. Auch Gustav erlebte noch zweimal die Situation der akuten Todesangst. Er wurde als verdächtiger deutscher Soldat an die Wand gestellt und sollte von polnischen und russischen Soldaten erschossen werden, jedoch rettete ihn die Tatsache, dass er polnisch und russisch sprach und dass polnische Freunde sich für ihn verbürgten, er sei ein guter Mensch und gehöre zu ihnen. Es waren wohl eher riesige Wunder, die Maria und Gustav damals erfahren konnten. In jener dunklen Zeit gab es also auch immer wieder Momente des Lichts.
Die Zeit der Flucht, der Gefangenschaft, der Ungewissheit und der Todesängste ist erwähnenswert, um meine Geschichte zu verstehen.
Jedenfalls kamen Gustav, Maria und Lenchen auf einen polnischen Gutshof, der zwei Nachbardörfer weiter gelegen war. Dort waren Gustav und Maria als Zwangsarbeiter eingesetzt und sie wohnten auch dort in einer kleinen Kammer. Maria musste schon morgens um vier Uhr Kühe melken und mit Gustav zusammen auf dem Feld arbeiten. Die Arbeit war sehr schwer und beide waren unterernährt. Sie bekamen zwar zu essen, aber das war nicht genug für eine so schwere Arbeit, die sie Tag für Tag verrichten mussten. Maria war ja erst 6 Wochen nach dem Wochenbett. Sie war oftmals erschöpft, jedoch hielt sie durch, genau wie Gustav. Niemand hatte den beiden zugetraut, dass sie so hart arbeiten konnten, denn sie sahen eher aus wie ein Schauspielerpaar auf der Durchreise. Lenchen hatte es vergleichsweise gut, denn sie war in einen Kinderwagen gebettet, bekam reichlich zu trinken und zu essen und wurde zu den Zeiten, als die Töchter der Gutsherrin und des Gutsherrn in den Semesterferien auf dem Hof waren, von diesen gehütet. Allerdings war sie auch viele Stunden täglich getrennt von Mutter und Vater. Gustav und Maria waren sonst gut behandelt worden. Einmal bekam Maria in aller Frühe, als Gustav schon auf dem Felde war, von dem Gutsherren „Besuch“.
Er kam, ohne anzuklopfen, in ihre Kammer und zog ihr die Bettdecke weg. Dann schaute er in ihre ängstlichen braunen Augen und ging wieder ohne sie berührt zu haben – er hat sie nie wieder belästigt. Auch hier wirkte das Licht im Dunkel.
Gustav und Maria sehnten sich von dort weg. Sie wollten weg. Der Krieg war bereits zu Ende und sie waren immer noch Unfreie, Gefangene. Und eines Tages schmiedeten sie einen Plan. Sie hatten polnische Freunde, die ihnen dabei halfen. Einer war ein Schmied und der besorgte ihnen falsche polnische Pässe. Lenchen war bereits zwei Jahre alt und sprach ausschließlich ein „reines“ Kinderpolnisch.
An einem Sonntagmorgen gingen Gustav, Maria und Lenchen sehr früh aus dem Haus und verließen den Gutshof für immer. Sie hatten nichts mitgenommen, außer dem, was sie am Körper trugen, denn sie wollten nicht als Abreisende enttarnt werden. Also schlichen sie sich in der Morgendämmerung bis ans Ortsende, wo ihr polnischer Freund mit einem Kutschwagen wartete. Sie stiegen ein und fuhren los. Erst zwei Nachbardörfer weiter wollten sie mit dem Zug gen Westen fahren, es durfte nicht auffallen, da in diesen Dörfern jeder jeden kannte. Plötzlich kam ihnen in einer Kutsche der Gutsherr entgegen. Maria und Gustav blieb das Herz stehen, doch glücklicherweise war jener betrunken und erkannte die beiden nicht. Irgendwann, als er wieder nüchtern war, entdeckte er die leere Kammer. Zwar hatten die beiden ihre Arbeitsschuhe, Stiefel und Winterkleidung dort gelassen, aber sie waren weg und kamen nicht wieder. Zu der Zeit dieser Entdeckung waren Maria und Gustav bereits im Zug und viele, viele Kilometer weit gefahren. Der Gutsherr wollte die polnischen Dorfpolizisten verständigen, die jedoch waren auf einem Polizeiball gewesen und waren entsprechend betrunken. All das ermöglichte die ungehinderte Weiterfahrt meiner Familie.
Auch im Zug war es aufregend gewesen. Kaum waren sie eingestiegen und Gustav und Maria hatten mit Lenchen an zwei Fensterplätzen Platz genommen, da erschien ein Schaffner, der die Fahrkarten und die Pässe kontrollieren wollte. Als er bei den anderen Fahrgästen die Kontrolle begann, brabbelte Lenchen in ihrem Kinderpolnisch und zeigte auf eine Kuh. Der Schaffner war so hingerissen von Lenchens Charme, dass er ihr und auch Maria und Gustav zuzwinkerte und auf polnisch sagte: „Du bist ja ein kluges Mädchen!“ Und er vergaß die Fahrkarten und Pässe von Maria und Gustav zu kontrollieren, oder er wollte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Er verließ das Abteil und Gustav und Maria atmeten auf. Die Fahrt war lang und anstrengend und irgendwann hielt der Zug im „Westen“, also im damaligen Osten Deutschlands. Dort herrschte auch eine Hungersnot. Als Maria und Gustav mit Lenchen ausgestiegen waren, wurden sie von um Brot bettelnden deutschen Frauen und von russischen Soldaten, die mit Peitschen knallten, empfangen. Maria war entsetzt, da sie dachte, jetzt sei sie im Schlaraffenland: „daheim im Reich“, wo alles besser sein wird! Gustav und Maria hatten hier eine Adresse von ihrem polnischen Freund bekommen, wo sie übernachten konnten. Es dauerte, bis sie das Haus gefunden hatten. Hier wohnte ein Pole, der mit seiner Familie in einer geplünderten deutschen Villa wohnte. Er war bekannt als grausamer Rächer für die deutschen Gräueltaten. Gustav und Maria hatten jedoch keine andere Wahl. Gustav ging vorweg und Maria wartete mit Lenchen in einem alten Gasthof. Als Gustav das Haus, in dem dieser Pole wohnte, gefunden hatte, zögerte er dort zu klingeln, er hatte Angst, die er dann aber irgendwie überwand.
Eine Polin öffnete die Tür, sie war bereits informiert, dass Gustav, Maria und Lenchen kommen würden. Sie war sehr freundlich und sagte: „Mein Mann ist nicht hier, der kommt heute Abend. Bringen Sie Ihre Frau und Ihr Kind hierher, hier sind sie sicher!“
Es war die sowjetisch besetzte Zone und irgendwie war hier alles durcheinander. Niemand wusste, wo er hingehörte, es gab Hunger, viele Flüchtlingslager und Krankheiten und Autoritätsprobleme. Gustav war müde und er holte Maria und Lenchen.
Die Angst, die Polen könnten sich rächen, wich dem Überlebensdrang, essen und schlafen zu müssen. Als sie am Haus der Polen angekommen waren, wurden sie dort gastfreundlich empfangen. Als der polnische Hausherr dazukam und Maria und Gustav begrüßte, wurde ihnen auch von diesem ein herzliches Willkommen signalisiert.
Sie aßen, tranken und erzählten sich einiges, alles in Polnisch, und es gab erstaunlicherweise statt Feindschaft so etwas wie Freundschaft im Sinne von Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft. Und Gustav und Maria schliefen den Schlaf der Erschöpfung.
Es herrschten chaotische Zustände in jener Zeit zwischen Krieg und Frieden. Die Zuständigkeiten in der Verwaltung und Politik waren nicht wirklich geklärt. Das damalige Deutschland war in britische, amerikanische und russische Zonen eingeteilt, es war von den Alliierten besetzt.
Maria und Gustav waren in der Ostzone, die eigentlich die russische Zone war, und dennoch gab es hier auch englische Soldaten. Es gab viele Flüchtlingslager, in denen Menschen auf eine neue Heimat warteten, diese wurde ihnen zugeteilt. Gustav und Maria mussten in ein solches Lager und sich als Flüchtlinge registrieren lassen – und dort warten, bis sie irgendwann an der Reihe waren. Maria und Gustav waren geschockt, aber eigentlich auch dankbar: Der Krieg war vorbei, eine neue Ordnung noch nicht hergestellt, aber sie waren bis dorthin durchgekommen. Sie waren nicht erfroren in den extrem frostigen Wintern, sie waren nicht verhungert, nicht erschossen, gefoltert oder vergewaltigt worden. Sie lebten und sie waren zusammengeblieben.
Unzählig viele Eltern trauerten um ihre Kinder, die verhungert waren oder darum, sie verloren zu haben, in dem Getümmel der Massenflucht. Frauen trauerten um ihre Männer, die im Krieg umgekommen waren, die erschossen, gefoltert oder vermisst waren oder verstümmelt aus dem Krieg zurückkamen.
Maria, Gustav und Lenchen waren gerettet, sie waren gesund und munter, ihre Erschöpfung spürten sie nicht, da sie sich weiterhin in einem Überlebensstress befanden. In jenem Lager bekamen sie gerade einmal einen Quadratmeter zugewiesen. Dort saßen sie auf dem Steinfußboden, und dort schliefen sie auch, sofern es irgend möglich war. Lenchen schlief entweder auf dem Schoß von Maria oder Gustav und war in ein weiches Federkissen eingebettet. Die erste Hälfte der Nacht hielt Maria das eingepackte Lenchen und die zweite Gustav. Sie schliefen nicht wirklich viel, denn es ist schwierig im Sitzen zu schlafen, wenn so viele Menschen in einem Raum sind. Da waren Kinder, die weinten, Erwachsene, die schnarchten, Alte und Kranke, die röchelten. Das Essen war schlecht: Wassersuppe mit Spuren von Erbsen oder Kartoffeln. Zuerst bekam Lenchen zu essen. Dafür hatten sie einen silbernen Teelöffel noch aus S. „gerettet“. Jedenfalls existierte dieser Löffel während meiner gesamten Kindheit in unserem Haushalt und ist im Besitz von Lenchen, die jetzt 65 Jahre alt ist.
Damals im Lager aß Lenchen zuerst, damit sie gesund bleiben sollte, und Maria und Gustav teilten sich das restliche Wasser. Tagsüber spielte Lenchen mit den anderen „Lagerkindern“ und lernte Lagerdeutsch: So rief sie eines Tages Maria entgegen: „Mami, ick habb nen Puckel am Arsch!“ Was soviel bedeutet wie: „Ich habe einen Pickel am Po!“
Gustav und Maria langweilten sich tagsüber und wurden ungeduldig. Und eines Tages kratzten sich die Kinder am Kopf und dann die Erwachsenen und schließlich auch Maria, Gustav und Lenchen. Alle Lagerinsassen hatten Läuse. Einige schnitten sich die Haare ab und schoren sich selbst und die Kinder kahl. Das half aber nicht wirklich. So kamen eines Tages mehrere Lageraufseher mit einem weißen Pulver und gaben das den Geplagten, die sich das Pulver auf den Kopf und auf den ganzen Körper auftaten, und zwar in großen Mengen. Es half. Tatsächlich war das Jucken und Kratzen vorbei! Es handelte sich, so weiß man heute, um das Nervengift DDT, ein Pestizid, das erhebliche Nebenwirkungen hat!
Sanitäranlagen gab es nicht wirklich, aber Plumpsklos, das Freie und einen Raum mit Wasserhähnen – von einem Waschraum konnte man nicht sprechen. Alles war umständlich, unwirtlich, unhygienisch, eng, laut und unappetitlich, und alle hatten irgendwie immer Hunger. Es waren damals sicherlich Gefühle der Abneigung und des Ekels entstanden, besonders bei Maria. Für Frauen war diese Situation besonders beschwerlich, wenn sie ihre Periode hatten, so mussten sie sehr einfallsreich sein und improvisieren. Als Windeln nahmen die Mütter für die Babys irgendwelche Tücher, weiche Stoffe und das, was eben vorhanden war.
Übrigens vergleicht Maria ihren Aufenthalt in dem Seniorenheim jetzt mit einem Lager, in dem Nazi-Methoden angewendet würden. Sie empfindet ihr Altsein und ihre Hilfsbedürftigkeit und das Angewiesensein auf Hilfe als demütigend, würdelos und schikanös. Die Gefühle, die sie damals in dem Lager und im Krieg auf der Flucht hatte, treten jetzt in den Vordergrund und vermischen sich mit den authentischen Gefühlen des Alterns.
Maria hatte nach Kriegsende eine tiefe, verborgene Sehnsucht und gleichzeitig das konkrete Bedürfnis, das jedoch verdrängt werden musste, irgendwann einmal ein eigenes Dach über dem Kopf zu haben, eine saubere Toilette und ein Badezimmer, genügend zu essen und genügend Platz zum Schlafen.
An irgendeinem Tag, der wie gewöhnlich trist, öde und langweilig verlief, kam ein Aufseher und bat Gustav, ihm im Büro zu helfen. Das tat Gustav gern, um seine Langeweile zu vertreiben. Er erledigte vieles: heftete Papiere ab, sortierte irgendwelche Akten und erledigte andere Büroarbeiten. Dafür bekam er jeweils zwei gut bestrichene Butterbrote. Und auch Maria konnte sich nützlich machen. Eines Tages fragten Lageraufseherinnen, wer stricken könne. Darauf meldete sich Maria, und sie strickte Strümpfe, Handschuhe, Mützen und Schals. Das machte den Lageralltag erträglicher, und auch sie erhielt Butterbrote für ihr Tun, die zunächst Lenchen bekam. Diese spielte derweil im Lager mit den anderen Kindern.
Und eines Tages, nach langem Warten, die Zeit schien unendlich, ging Gustav noch einmal zu dem Polen, der sie zuvor beherbergt hatte, und bat ihn um Hilfe. Er sollte Gustav eine Möglichkeit nennen, damit er mit Maria und Lenchen eine Ausreise- und eine Zuzugsgenehmigung bekommen könnte. Sie wollten nicht länger warten, sie fühlten sich unwohl und erschöpft. Der Pole gab Gustav den Rat, sich als Facharbeiter auszugeben, damit er eine Berechtigung habe, sofort auszureisen, das wäre als Flüchtling sonst nicht möglich.
Der Pole schrieb Gustav eine Bescheinigung darüber aus und gab ihm den Namen eines Bürovorstehers, der in dieser Angelegenheit entscheidungsbefugt war. Gustav bedankte sich und ging dort hin. Er fand diesen russischen Bevollmächtigten nach intensiver Suche und häufigem Nachfragen in einem dunklen Büro mit vielen Akten und Papieren, hinter denen sich viele Schicksale verbargen. Gustav trat trotz oder gerade wegen seiner unbeheimateten Situation selbstbewusst in diesen Raum. Er hatte wohl etwas Entschlossenes und gleichzeitig Flehendes in seinen Augen. Ein großer Mann mittleren Alters saß hinter seinem Schreibtisch und zwei etwas jüngere Männer standen neben ihm. Auf die Frage, was Gustav wolle, antwortete dieser in einer nicht zögerlichen Weise: „Ich bitte um Ausreise für meine Frau, unsere kleine Tochter und mich! Ich bin Facharbeiter und habe hier als Klempner gearbeitet. Wir wollen nun weiter in die Heimat!“ Die Männer schauten erst Gustav und dann sich untereinander fragend an. „Warum wollen Sie denn weg?“ Gustav sagte: „Ich habe hier im Moment keine Arbeit mehr und bin ein heimatloser Deutscher, der kein Zuhause hat. Ich möchte in meine Heimat!“ Er glaubte wohl in diesem Moment noch, dass Heimat irgendein Ort sein könnte auf dieser Welt.
Jedenfalls sagte Gustav dies so überzeugend, wie er oft nicht nur in Grenzsituationen sein konnte, und er wirkte wohl auch anrührend, sodass der Mann hinter dem Schreibtisch die beiden anderen ansah und antwortete: „Lasst ihn doch in Gottes Namen in sein Vaterland fahren!“ Sie stellten ihm eine Ausreisegenehmigung aus und so konnten Maria, Gustav und Lenchen weiter in den Westen fahren.
Sie kamen nach Uelzen in ein Auffang- bzw. Zwischenlager, bevor sie dann nach Niedersachsen einreisen durften. Von dort aus besuchten sie Gustavs Bruder Ernst, der mit seiner Familie den Krieg überlebt hatte. Er war unversehrt von der Front zurückgekehrt und mit seiner Frau Hedwig und seinen vier Kindern, die alle um einige Jahre älter als Lenchen waren, glücklicherweise in die Nähe von Braunschweig gezogen. Dort bewohnten sie eine große Wohnung zu jener Zeit und Gustav, Maria und Lenchen waren glücklich dort zu sein. Es war ein Stück Heimat, die Verwandten wiederzusehen. Alle waren dankbar und gerührt vor Freude.
Es gab genug zu essen und selbst gebrannten Schnaps und viel zu erzählen. Die Wiedersehensfreude war groß, denn auch Gustavs Mutter und sein Stiefvater wohnten dort. Sie weinten alle vor Freude und Dankbarkeit, dass sie einander wiedersehen konnten. Die Besuche bei Onkel Ernst und seiner Familie waren auch später, als ich bereits geboren und ein Kind war, immer wieder Heimaterlebnisse.
Damals blieben Gustav, Maria und Lenchen nur eine Woche dort, dennoch war diese Woche ein Lichtblick im Dickicht und Dunkel des Flüchtlingsalltags. Ihnen wurden Lebensmittel mitgegeben. Sie fühlten sich gestärkt und so konnten sie die letzten drei Wochen im Auffanglager Uelzen noch ertragen. Sie sehnten sich so sehr nach Ankommen und Angekommensein. Und schließlich kam die Zeit näher, sodass sie dann eines Tages nach Ostfriesland weiterfahren konnten, wo sie auf einem Bauernhof wohnen sollten. Als sie auf dem Bahnhof in einer kleinen ostfriesischen Stadt angekommen waren, sollten sie abgeholt werden. Sie warteten auf einer Bank, die sich gegenüber dem Bahnhof befand. Sie waren müde, wollten irgendwo ankommen, wollten zur Ruhe kommen, irgendwo sein dürfen, wo sie nicht mehr so schnell wieder wegmussten, wo man sie nicht vertreiben konnte.
Nach langem Warten wurden sie beide von Hinnerk, dem „Knecht“ der Familie, auf deren Bauernhof sie eine Zuweisung als Flüchtlinge bekommen hatten, abgeholt. Er kam mit einer Kutsche, einem Einspanner und sie stellten sich vor. Sie fuhren mit jener Kutsche, die nicht an die erinnerte, die sie kannten, los. Sie waren schweigsam, erschlagen von den vielen Eindrücken der letzten Wochen und Monate. Was sie sahen, war flaches Land, mit Ölpumpen, die für Lenchen lange Nasen, die sich in die Erde stießen, darstellten. Gustav und Maria empfanden gar nichts oder ganz viel, es war zu der Zeit nicht spürbar, überlagert von Eindrucksüberfrachtungen und Erschöpfung. Und irgendwann waren sie dort, angekommen, zunächst einmal, nicht für immer, aber was ist schon für immer?
Jetzt waren sie hier auf einem alten Bauernhof in der Nähe der Niederländischen Grenze. Eine Allee mit altem Baumbestand führte zu dem Fachwerk-Bauernhaus. Die alte Bäuerin, Frau Sette, ihr Sohn Hannes und ihre Schwiegertochter Marike waren die Familie, und der Knecht Hinnerk gehörte auch dazu. Gustav und Maria wurden mit Skepsis betrachtet und kühl empfangen. Das war Gustav und Maria aber in dem Moment gleichgültig. Hauptsache ein Dach über dem Kopf, kein Lager mehr, keine Läuse, kein Schnarchen und Geröchel.
Sie erhielten eine kleine Kammer, in der ein altes Bett stand, das für zwei Personen an sich zu klein war. Dann gab es noch einen Tisch und drei Stühle und ein altes Chaiselongue. Das Fenster war klein und entsprach dem eines alten ländlichen Ostfrieslandhauses. Es gab draußen ein Plumpsklo und einen kleinen Raum mit kaltem Wasser zum Waschen. Die Wäsche wurde gemeinsam mit der Familie Sette in einem Waschraum gewaschen.
Gustav und Maria waren sprachlos. Hier sollten sie nun bleiben? Aber sie waren dankbar dafür, dass sie als Flüchtlinge überhaupt aufgenommen worden waren. Lenchen hatte sich derweil schon mit der ganzen Familie angefreundet und alle hatten sie sofort in ihr Herz geschlossen. Maria und Gustav wurden mit Skepsis und Distanz behandelt. Niemand traute den beiden zu, dass sie auf dem Bauernhof arbeiten konnten. Als die Familie Sette dann sah, wie fleißig Maria war, die Kühe molk, auf dem Feld und im Haus arbeitete, Brot und Kuchen buk, Wäsche wusch und sich im Bauerngarten nützlich machte – und auch dass Gustav hart und gewissenhaft auf dem Feld arbeitete, senste, pflügte und säte –, da waren sie irritiert und gleichzeitig angenehm überrascht. Als Gustav und Maria dann auch noch sonntags in die Kirche gingen und das auch noch aus Überzeugung, da war die eisige Wand geschmolzen und die Bauernfamilie begegnete auch Gustav und Maria mit großer Herzlichkeit. Und der Eindruck, dass die beiden „Filmschauspieler“ nicht in der Lage wären zu arbeiten, verblasste.
Gustav und Maria und Lenchen trugen nur das, was sie am Leibe hatten: Gustav einen hellen Sommeranzug, der seine schlanke Figur betonte, Maria trug ein interessant geschnittenes buntes Sommerkleid und Lenchen ein Kinderkleidchen mit Rüschen, das hatten sie von einem Carepaket bekommen, das Tante Frieda ihnen zugeschickt hatte. Alle drei sahen nicht wie eine Bauernfamilie aus und fielen in dem kleinen ostfriesischen Dorf sehr auf. Es begann eine glückliche Zeit für die Familie. Lenchen spielte mit den Pferden, die auf der anliegenden Koppel standen, sie tobte durch den Garten und entwickelte Fantasiespiele, die die alte Tante Sette, so wurde diese von Lenchen, Maria und Gustav genannt, sehr bewunderte. Lenchen war das Prinzesschen und alle liebten sie. Manchmal tanzte sie Samba auf dem Wohnzimmertisch und wurde dafür immer mit Pfennigen belohnt. Lenchen war häufig bei der alten Tante Sette und auch bei dem Sohn und der Schwiegertochter. Sie aß dort auch und schwärmte immer wieder davon, auch, als sie längst nicht mehr dort wohnten. Alle aßen aus einer Pfanne und stippten das Brot immer ein, um sich die Soße und den Speck aus der Pfanne zu fischen.
Maria und Gustav waren sehr verliebt. So konnten sie erst jetzt so etwas wie die nicht gelebten Flitterwochen nachholen. Ihre Zärtlichkeit und das Glücklichsein damals ist auch heute noch auf den Fotos zu bewundern, die ich für die Diamantene und die Eiserne Hochzeit in Mappen zusammengestellt habe.
Damals, in jener Zeit, war meine Seele wohl schon bereit, sich zu inkarnieren, und hatte sich diese beiden als Eltern ausgesucht.
Maria und Gustav waren glücklich und dankbar, heil durch den Krieg gekommen zu sein, am Leben und gesund zu sein. Überhaupt waren ihre Verwandten und ihre nahen Angehörigen unversehrt davongekommen: Marias Eltern und ihr jüngerer Bruder Andre waren auf der Ostfrieseninsel Juist angekommen. Sie wohnten dort in einer kleinen einfachen Wohnung. Alles verlief nach den Zuweisungen der Ämter und der besetzten Zonen durch die Alliierten. Marias Bruder Fred kam irgendwann aus der russischen Gefangenschaft ins Rheinland. Cousinen und Cousins, Onkel und Tanten von Maria und Gustav waren irgendwann nach Kanada und in die USA ausgewandert, andere waren nach Ostdeutschland gekommen, damals Ostzone genannt, und wieder andere waren im Rheinland angekommen.
Gustavs Mutter und sein Stiefvater wohnten bei seinem Bruder Ernst und seiner Frau Hedwig und den vier Kindern. Bald konnten sie sich eine kleine Kirschplantage kaufen, da sie als Flüchtlinge wegen ihres Vermögensverlustes vom Staat einen so genannten Lastenausgleich bekommen hatten.
Gustavs Schwester Frieda lebte in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein und führte mit ihrem Mann Hans ein Elektrogeschäft, das in der damaligen Zeit des Wiederaufbaus und des Nachholbedarfs florierte. Sie schickten öfter Pakete.
Sie konnten alle aufatmen und die Schatten des Krieges vertreiben.
Gustav und Maria waren dankbar, erleichtert, glücklich und noch jung. Sie gingen zum Tanzen, im Sommer, wenn das „Heideblütenfest“ in der ostfriesischen Region gefeiert wurde. Sie waren außerordentlich elegant gekleidet, da sie Carepakete von Verwandten aus den USA bekamen. Auch Lenchen hatte feine Kleidchen an und eine große Schleife im Haar. Lenchen war fast immer dabei.
Sie hatten trotz materiellen Mangels alles, was sie zum Leben brauchten: Ihre Liebe zueinander und die zu Lenchen, gutes Wasser zum Trinken und satt zu essen – ein Dach über dem Kopf und eine ländliche Umgebung, die ihnen Ruhe ermöglichte. Sie hatten sich selbst und hatten einander. Das war ein großartiges Gefühl!
Manchmal gab es natürlich die Grenzen des Alltags zu spüren und der materielle Mangel wurde auf unangenehme Weise deutlich. Es fehlte einfach vieles, das den Alltag erleichtert hätte. So hatte Maria zum Beispiel keinen Kamm für ihre schwarzen Locken. Sie war verzagt, weil ihre Haare zu verfilzen drohten und sie befürchtete, sie müsse ihre Haare abschneiden. Gustav war zuversichtlich und sagte: „Wir haben so viel überstanden und so viele Wunder erlebt, wir werden auch einen Kamm haben, alles zu seiner Zeit.“ Als er Maria das voller Überzeugung mitgeteilt hatte, spazierte er die Pappelallee entlang, bis er an den kleinen Fluss kam, der sich durch die Aue entlang schlängelte. Es war ein schöner Frühsommertag, und so setzte Gustav sich an das Flussufer, dankte Gott für sein Leben und sah plötzlich etwas aufblitzen. Er näherte sich dem und entdeckte: Es war ein Kamm. Er wusch ihn in dem Fluss, lief zu Maria und beide staunten und waren glücklich.
Maria musste ihre schwarzen Locken nicht abschneiden, sondern sie konnte sie schulterlang tragen. Sie kämmte sich nun so oft, wie sie konnte.
Und Weihnachten? Das war das wichtigste Fest, und Heiligabend war auch Lenchens Geburtstag! Maria und Gustav hatten kein Geld für Geschenke, da sie noch so viel für ihr tägliches Leben benötigten. Gustav bekam zu Weihnachten 30 Deutsche Mark von seiner Ölfirma, bei der er irgendwann zusätzlich zu arbeiten begonnen hatte, da seine Arbeit auf dem Hof nur mit Kost und Logis entlohnt wurde. Die Höhe des Lohns bei der Ölfirma war damals üblich, aber in Anbetracht dessen, dass sie fast gar nichts hatten, reichte es nicht wirklich. Maria arbeitete für Settes, buk Kuchen, schlachtete für alle eine Ente und holte einen Baum aus der Nachbarschaft. Aber was war mit Lenchen, sie musste doch etwas zu Weihnachten bekommen und zu ihrem Geburtstag. Jedenfalls gab es auch nicht viel zu kaufen, aber in einem Nachbardorf gab es einen Laden, der auch einige Spielwaren hatte, und Lenchen hatte mit Maria und Gustav dort eine wunderschöne große Puppe entdeckt, es war die größte und schönste, die sich in dem Laden befand. Die sollte nun 30 DM kosten. Es war nicht möglich, diese zu kaufen, denn das Weihnachtsgeld wurde für Küchenutensilien wie Bestecke und Geschirr benötigt.
Am Vorabend des Heiligenabends kam Gustav mit einem großen Paket nach Hause. Maria hatte schon das Essen für das Christfest vorbereitet und hoffte darauf, dass sich Geschirr oder andere praktische Alltagsnotwendigkeiten in diesem Paket befänden. Als sie das Paket mit Gustav zusammen öffnete, fand sie die schöne große Puppe darin. Und Gustav sagte: „Das Kind braucht die Puppe jetzt! Geschirr können wir später kaufen, aber Lenchen braucht die Puppe dann nicht mehr, wenn sie älter ist!“ Und Maria weinte vor Rührung, dass Gustav so ein weiser und fürsorglicher Vater war. Und Lenchen war an diesem Heiligenabend das glücklichste Kind, das es zu dieser Zeit gegeben hat. Und diese Freude war auch die von Gustav und Maria. (Und am darauf folgenden Weihnachten baute Gustav einen wunderschönen eisernen Schlitten mit einem Holzsitz, den er rot angestrichen hatte. Das war eine große Freude für Lenchen. Dieser Schlitten gab uns beiden später noch viele Winter die Möglichkeit zu wunderbaren Rodelerlebnissen.)
Eines Tages sollte ein wichtiges Fußballländerspiel im Radio übertragen werden. In ihrer früheren Heimat hatten sie einen „Volksempfänger“ gehabt und waren entsprechend informiert, wie einseitig diese Informationen auch immer gewesen waren. Nun gab es bereits richtige Radios aus Holz in unterschiedlichen Größen mit entsprechendem Empfang. So etwas hatten Maria und Gustav nicht, sie hatten kein Geschirr und keine Möbel. Außer dem kärglichen Notbestand wie Bett, Stuhl, Tisch und Chaiselongue hatten sie noch drei Trinkbecher, drei Teller sowie Bestecke wie Löffel, Gabel und Messer in dreifacher Ausführung. Sie aßen oft bei der Familie Sette. Das war für Lenchen immer lustig, denn sie war deren Prinzessin und durfte manchmal auf dem Tisch tanzen.
Gustav und Maria waren nicht die einzigen, die kein Radio hatten. Aber Gustav war sonntagnachmittags manchmal langweilig und ein wenig unzufrieden, und dieses wichtige Fußballländerspiel wollte er gern mitverfolgen. Da sagte Maria zu ihm: „Gustavchen, du sagst doch immer, wir bekommen immer das zur rechten Zeit, was wir brauchen! Also lass uns auch diesmal darauf vertrauen.“ Am nächsten Tag erhielten die beiden ein Paket. Sie waren mehr als überrascht, als sie es gemeinsam öffneten: Darin befand sich – tatsächlich – ein Radio! Es war ein großer Kasten aus Holz mit vielen Tasten und Sendern. Diesen hatten Frieda und Ihr Mann ihnen aus ihrem Elektro-Laden geschenkt. So konnte Gustav am darauf folgenden Sonntag das Fußballspiel im Radio hören. Die Freude und das Staunen waren groß! Diese Wunder geschahen und geschehen und sind laut den Erkenntnissen der Quantenphysik als zielgerichtete Energie in Form eines Wunsches oder eines Gedankens als energetische Felder, die schneller als Lichtgeschwindigkeit sind, erklärbar. Alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden und vernetzt.
Albert Einstein sagte: „Es gibt nur zwei Arten, zu leben, indem wir entweder nichts oder alles als Wunder betrachten.“
Letzteres taten Maria und Gustav damals und sie waren sehr glücklich und dankbar. Und jetzt? Jetzt müssen sie an das Wunder des Sterbens glauben, das Loslassen zulassen und sich in diesem Leben zum letzten Mal verabschieden. Keiner weiß so genau, wie das sein wird. Gustav ist noch hier und möchte die Erde doch verlassen. Er ist sogar noch auf dem Sterbebett schön. Ich habe ihm in der letzten Woche die Füße massiert, sie waren weich, warm und wohl geformt und Gustavs Gesicht glich dem eines Engels.
Maria geht am Rollator. Sie will noch nicht alles loslassen, kämpft mit sich und der Welt und übt sich im Einverstandensein trotz des Aufbäumens gegen das Endliche des menschlichen Schicksals – und schimpft weiterhin über Nazi-Methoden im Seniorenheim.
Jedenfalls damals an der holländischen Grenze war für Gustav und Maria alles gut, verheißungsvoll und erfüllt von Glück. Sie liebten sich in ihrer kleinen Kammer. Es hatte damals immer etwas Heimliches, denn sie musste immer warten, bis Lenchen draußen spielte, wenn es Sommer war, oder wenn sie im Winter bei Settes in der Bauernstube spielte. Da war immer die Angst, es könne jemand sie beide bei der Liebe stören. Daher hatte es etwas Ungeheuerliches, wenn sie sich liebkosten, wenn sie zärtlich miteinander waren und bis zur Erschöpfung die Einswerdung erprobten.
Jedoch legte sich ein Schatten auf ihr lichtes Glück, denn Maria klagte immer häufiger über diffuse Schmerzen, die einerseits nicht genau zu orten waren, aber dennoch waren es Schmerzen. Schmerzen im rechten Arm und am Rücken.
So fuhr Maria eines Tages, als sie es vor Schmerzen nicht mehr aushalten konnte, in die benachbarte Stadt und suchte dort einen Arzt auf, der keine Ursache oder Zusammenhänge für die Schmerzen diagnostizieren konnte.
Gustav, Settes und einige Nachbarn rieten Maria dazu, noch einmal schwanger zu werden. Dann würden sich die Schmerzen automatisch auflösen und sie würde sich wohler fühlen, da sie dann eine Aufgabe hätte.
Tatsächlich wünschte sich Gustav sehnlichst noch ein Kind, und auch Maria wollte noch eines, da sie Gustav so sehr liebte. Es sollte diesmal ein Junge sein, und der sollte Gustav heißen wie der Vater und der Großvater.
Nun war es nicht leicht, die Frau an Gustavs Seite zu sein. Alle Frauen, mit denen Gustav in Kontakt kam, ob jung oder alt, mochten ihn und liebten ihn irgendwie.
Jedenfalls stand er immer im Mittelpunkt, wenn sie irgendwo waren, zum Tanzen, beim Einkaufen oder sonst wo …
Maria war eifersüchtig, spürte aber Gustavs Liebe zu ihr, und so strengte sie sich an, ihn nicht zu verlieren. Sie biss die Zähne zusammen, wenn sie Schmerzen hatte und wollte nicht die klagende, jammernde Frau an seiner Seite sein. Sie schluckte all dies und ihre Schmerzen herunter, schob sie beiseite, so gut sie konnte, und wollte die tapfere, tolle Frau sein. Das war sicherlich sehr anstrengend und sollte fast 90 Jahre lang andauern.
Jetzt, wo Gustav sich ganz langsam von der Erde verabschiedet, befindet sich Maria in einer tiefen „Jammerdepression“: Alle alten negativen Gefühle und Verletzungen von damals kommen ans Licht und werfen ihre Schatten voraus und hinterher.
Damals jedenfalls wurden Marias Schmerzen immer stärker und sie hielt es nicht mehr aus. Irgendwann in jener Zeit, als Maria und Gustav einerseits so glücklich miteinander waren und als gleichzeitig der Schatten einer herannahenden Krankheit Maria verdrießlich und verzweifelt machte, in so einer Situation beschloss meine Seele zu den beiden zu wollen.
Im ekstatischen Zustand beidseitiger Liebe und Hingabe im Mai 1952 wurde ich gezeugt. Meine Seele hatte sich festgelegt für dieses Leben, diese Mutter, diesen Vater, diese Schwester. Es war keine günstige Zeit, welche Zeit ist schon günstig?
Vielleicht war sie hierher gekommen, weil sie irgendwie helfen wollte, Marias Schmerzen zu überwinden, sie ihr abzunehmen, vielleicht war sie gekommen, um Gustav, Maria und Lenchen und sonst wen glücklich zu machen?
Maria wurde nach der Zeit der Empfängnis immer schöner, die Hormone machten sie ausgeglichener, sodass ihre Schmerzen für eine Zeit in den Hintergrund traten. Und als sie definitiv wusste, dass sie schwanger war und Gustav und alle anderen, die sie gut kannten, ebenfalls Bescheid wussten, war es das Thema im Dorf: Maria war schwanger und wurde immer schöner!
Jedoch gab es für Maria nur kurze Momente der Entlastung, die Schmerzen in der Wirbelsäule nahmen zu, je mehr das Kind in ihr wuchs. Sie war unglücklich und verzweifelt und suchte unterschiedliche Ärzte in der Umgebung und darüber hinaus auf. Diese bedienten sich als moderne Mediziner der Röntgenstrahlen, die zu jener Zeit die neue wissenschaftliche Entdeckung und deshalb sehr beliebt waren. Die damalige Schulmedizin glaubte genauso wie die heutige an die Aussagen von Apparaten und komplizierten Messmethoden, ohne häufig die Nebenwirkungen genügend zu berücksichtigen bzw. diese einschätzen zu können.
Jedenfalls wurde Maria fleißig geröntgt und die Ärzte meinten, nun, da sie in den Körper hineinschauen konnten, irgendetwas zu finden, was für Marias Schmerzen hätte verantwortlich sein können.
Sie fanden nichts, und deshalb war es für sie und die anderen klar, dass Maria ein Hypochonder war. Sie sollte sich ablenken und auf das Kind freuen, dann hätte sie eine Aufgabe!
Einer der vielen Ärzte kam dann noch auf die Idee, Maria zu einem Zahnarzt zu schicken, denn kranke Zähne aufgrund von Mangelernährung – z. B. im Krieg oder auf der Flucht –, hätten auch eine Ursache für Marias Rückenschmerzen sein können. Maria konsultierte jenen Zahnarzt, und der war nicht faul und entschied, dass Maria sich fast alle Zähne ziehen lassen müsse. Sie war und ist eine willensstarke Frau, aber in jener Situation wollte sie nur, dass ihr irgendwie geholfen würde, also ließ sie das zu und bekam ein Gebiss. Sie hatte viele Plomben aus Amalgam in ihren Zähnen gehabt, ein Metallgemisch mit Quecksilber. Diese hatten sich zum Teil im Körper abgelagert und wurden nun nach der Zahnextraktion auch noch im Körper frei und durchdrangen auch die Plazenta und die Bluthirnschranke des Embryos. Das wusste damals aber niemand, bzw. die Wissenschaftler, die sich dagegen gewehrt hatten, Amalgam als Zahnfüllstoff wegen seiner Toxizität auf den Markt zu bringen, wurden nicht gehört. Es war der kostengünstigste Stoff, und er wurde bei allen Menschen eingesetzt, bei Kindern und Erwachsenen, ganz gleich, ob arm oder reich.
Maria fühlte sich verloren und verlassen, sie war verzweifelt und gab trotzdem nicht auf, auch heute gibt sie nicht auf, wo sie den längsten aller Abschiede nehmen muss.
Jedenfalls hatte damals auch Gustav sehr gelitten, er tat aus seiner Sicht alles, um Maria zufrieden und glücklich zu machen. Nichts half.
Auch er zweifelte zwischendurch daran, ob Marias Schmerzen so real waren. Er wollte sein Glücksgefühl des Jungseins und Gesundseins nicht gestört wissen und gleichzeitig litt er mit Maria.
In jener Zeit gab es in dem ostfriesischen Dorf auch aufdringliche Frauen, die Marias Schwangerschaft, ihr Kranksein und ihre Unbeweglichkeit nutzten, um mit Gustav flirten zu können. Häufig wurden Gustav und Maria zu den Nachbarn eingeladen, aber da Maria vor Schmerzen nicht mitkommen konnte, ging Gustav manchmal auch allein dorthin. Maria litt vor sich hin, auf der einen Seite hatte sie die großen Schmerzen und sorgte sich darum, ob sie für das Baby jemals da sein könnte, und auf der anderen Seite hatte sie Angst, Gustav und das gemeinsame Glück mit ihm, zu verlieren. Lenchen bekam nicht viel davon mit, denn sie spielte meistens bei Settes, und ansonsten waren ihre Eltern für sie da.
In dieser „gemütlichen Zeit“ wuchs ich im Bauch meiner Mutter heran und spürte bereits ihren Schmerz, ihr inneres Weinen, das damals schon zu meinem wurde, ihre Angst, Gustavs Liebe zu verlieren, ihre Eifersucht, ihre Angst vor Krankheit und Tod.
Irgendwann müssen Marias Schmerzen so unerträglich geworden sein, dass sie sich wünschte, ich wäre nicht da, ich würde nicht kommen.
Vielleicht war es nicht nur ihr Wunsch, sondern sie hat auch irgendetwas unternommen, ich weiß es nicht. Darüber wurde nie gesprochen, darüber, dass ich ein Wunschkind war.
Ein seriöser Astrologe sagte mir einmal: „Zuerst hatten sie Angst, dich bekommen, und dann hatten sie Angst, dich zu verlieren!“
Genau diese Ambivalenz sollte ich in diesem Leben zu spüren bekommen, zwischen Liebe und Angst, Hingabe und Verzweiflung, Zärtlichkeit und Ablehnung, Freude und Traurigkeit, Ekstase und Kontemplation, Licht und Schatten.
Und eines Tages entdeckte Lenchen, die damals sieben Jahre alt war, etwas an Marias Rücken, als sie ihr den Rücken wusch. Da Maria ihren rechten Arm vor Schmerzen nicht mehr anheben konnte, half Lenchen ihr öfter, ihren Rücken zu waschen. Dabei fühlte sie einen Huckel an Marias unterer Wirbelsäule. Maria suchte einen Orthopäden auf und der fand nun endlich heraus, dass Maria Knochentuberkulose hatte. Das war ein riesiger Schock für Maria und gleichzeitig fühlte sie sich irgendwie erleichtert, da sie nun wusste, woher ihre starken Schmerzen kamen. Sie musste sich nun nicht mehr anhören, sie stelle sich an und sie solle doch dankbar sein.
Nein, dieser Psychoterror sollte nun für sie ein Ende haben!
Gleichzeitig jedoch hatte sie Angst, Angst vor der Geburt, vor der Ankunft ihres Kindes, Angst vor der Versorgung, vor allem, wie alles werden sollte, wenn sie krank war.
Nun hatte Maria in jener Zeit eine sehr gute Freundin, die in ihrem Alter war und einen sehr netten Mann hatte. Diese hatte keine Kinder und konnte auch keine bekommen. Sie wollte Maria helfen, wenn das Baby da ist. Damals wusste man noch nicht vor der Geburt, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Jedenfalls blieb die Angst vor der Zukunft.
Knochentuberkulose? Was war die Ursache? Ist die Krankheit ansteckend? Ist sie heilbar? Viele Fragen kreisten Maria im Kopf herum, ebenso Gustav, und auch Lenchen hatte ihre Fragen.
Entstanden war Marias Krankheit im Krieg, auf der Flucht, durch die Mangelernährung und harte Arbeit auf dem polnischen Gutshof. Knochentuberkulose ist nicht ansteckend so wie Lungentuberkulose durch Tröpfcheninfektion. Sie ist grundsätzlich heilbar. Und für Maria?
So hatte der Krieg doch seine Spuren hinterlassen, die Ungeheuerlichkeiten, die geschehen waren, die Auswirkungen der Genozide wie Täter- und Opfererlebnisse und die damit verbundenen Schuldgefühle! Das alles bekamen auch viele Überlebende zu spüren, früher oder später, sichtbar oder unsichtbar, und auch die nächste Generation blieb nicht verschont!
Nun stand die Geburt bevor und es war der 6. Januar 1953. Maria bekam Wehen und Gustav und Hinnerk, der „Knecht“, fuhren Maria mit der Kutsche in eine kleine Stadt zu einem katholischen Krankenhaus.
In jener Zeit waren Hausgeburten nicht üblich, geradezu verpönt, da ein Krankenhaus Fortschritt symbolisierte, Modernität und eine medizinische Versorgung sichere und der Schwangeren die Geburt erleichtere, so glaubte man damals.
Deshalb war auch Maria in einem Krankenhaus. Sie wurde in ein Zimmer gebracht, in dem sie allein war. Die Wehen wurden immer stärker und der Arzt war noch nicht da. Die Hebamme, die für Maria zuständig war, wurde geholt. Maria lag auf dem Bett, und Gustav saß neben ihr und hielt ihre Hand …
Und plötzlich? Auf einmal war ich da, hier auf der Erde! Und ich war gesund! Es war alles da, was zu einem menschlichen Wesen gehörte.
Gustav erzählte mir davon, als er 80 Jahre alt war und er hatte Tränen in den Augen: „Und plötzlich warst du da, niemand sonst außer deiner Mutter und mir waren dabei, und du hast nicht geweint, hast sofort deine Augen geöffnet und uns so intensiv angesehen, als ob du sagen wolltest: `Ach so, Ihr seid also meine Eltern!`“ Gustav weinte vor Rührung, als er mir das vor 13 Jahren erzählte und Maria saß dabei. Wahrscheinlich war sie ebenso berührt wie Gustav, sie konnte es –wie immer– nicht wirklich zeigen.
Maria und Gustav waren bei meiner Geburt glücklich und tief berührt gewesen, denn es war eine leichte Geburt, und sie waren stolz darauf, ein Mädchen bekommen zu haben. Es war unwichtig für sie, ob sie nun einen Jungen oder ein Mädchen hatten. Nun war ich ein Mädchen und sollte Elisa heißen.
Ich war am Heiligen Dreikönigstag 1953 geboren worden, war also das zweite Christuskind in dieser Familie. Dieses Jahr war durch viele bemerkenswerte Ereignisse geprägt. So gab es z. B. viele Atomversuche und den blutig niedergeschlagenen Aufstand am 17. Juni in Berlin gegen die sowjetische Besatzung.
Dieser Tag wurde dann zum gesetzlichen Feiertag, der übrigens auch der Hochzeitstag von Gustav und Maria ist. Ich habe häufig scherzhaft gesagt: „Der Tag der Deutschen Einheit, der bis 1989 der offizielle Feiertag war, wird wegen der Hochzeit meiner Eltern gefeiert!“
Jedenfalls ein paar Tage nach meiner Geburt kam ein Pfarrer in Marias Zimmer und nahm mich auf den Arm und war tief beeindruckt und sagte: „Was ist das für ein besonderes Kind, es schaut schon so klug aus den Augen!“
Im Krankenhaus war ich meistens weit weg von meiner Mutter, wie es damals üblich war. Ich wurde in einen Baby-Saal gebracht. Hier waren viele Säuglinge, Nachkriegskinder, die dort gewickelt und gewaschen wurden. Ich kam nur zweimal am Tag zu meiner Mutter…
Jedenfalls waren meine Eltern glücklich, dass ich da war, und auch Lenchen. Endlich ein Geschwisterchen, endlich nicht mehr allein! Und dann? Dann war ich doch nicht wirklich willkommen! Wer sollte für mich sorgen, die Windeln wechseln, mir die Flasche geben und mich waschen und anziehen?
Maria war nach der Geburt so erschöpft und so krank, dass sie im Krankenhaus bleiben musste. Ich fühlte mich von Anfang an schuldig an ihren Schmerzen und ihrem Elend, obwohl ich ihr ja die Geburt so leicht gemacht hatte, wie ich nur konnte. Marias Knochentuberkulose war so weit fortgeschritten, dass ihre untere Wirbelsäule zusammengeschoben war und sie unerträgliche Schmerzen hatte. Maria wurde in eine Gipsschale gelegt und die Ärzte machten ihr klar, dass sie 12 Monate so liegen müsse. So hätte Maria eine Chance, wieder gehen zu können und nicht im Rollstuhl sitzen zu müssen. Auch das war ungewiss…
Wohin also mit mir und Lenchen? Gustav arbeitete in jener Zeit bei Wintershall, einer Ölfirma, und er hatte einmal Früh- und einmal Spätschicht. Marias Freundin, die sich so auf mich gefreut hatte und mich gern genommen hätte, starb in der der Zeit, als ich auf die Welt gekonmmen war, an einem Herzanfall.
Jedenfalls kam die kleine Oma aus Nes., einem kleinen Dorf in der Nähe von Braunschweig, zu Gustav, Lenchen und mir. Sie machte Gustav den Haushalt, half ihm, mich zu wickeln, zu waschen und zu füttern, und sie war für Lenchen da, die bereits zur Schule ging und die auch ihren regelmäßigen Tagesablauf brauchte.
Ungefähr drei Wochen lang war die kleine Oma damals da.
Vor meiner Geburt hatten Maria und Gustav angefangen, ein Haus zu bauen, ein „Nest“ für sie und die Kinder. Das war noch nicht fertig, und es gab noch viel daran zu tun. Auch sie hatten als Flüchtlinge vom Staat einen Lastenausgleich für den verlorenen Besitz in Ostpreußen bekommen und hatten sich in Mel. davon ein großes Grundstück gekauft und angefangen, in Eigenregie zu bauen. Das Haus war noch nicht fertig. Sie wohnten noch bei Settes, und es war dort sehr eng. Aber irgendwie bekamen sie es hin mit der Enge, nur nicht für längere Zeit.
Und irgendwann wurde ich getauft, auf den Namen Elisa, die Kurzform von Elisabeth, so hatte nämlich Gustavs Großmutter geheißen, die auch eine Heilerin gewesen war.
Tante Frieda und Onkel Hans kamen zu Besuch, und ihre beiden Söhne Martin, fünf Jahre alt, und Wilfried, sein Brüderchen, drei Monate alt, waren auch dabei. Irgendwie war doch genügend Platz, und meine Tante Frieda hielt mich auf dem Arm und alle bestaunten mich. Aber meine Mutter war nicht da.
So fuhr die kleine Oma bald wieder weg. Denn man hielt es für das Beste, Lenchen und mich zu Marias Eltern nach Juist zu geben. Dort konnte Lenchen mit Onkel Andre, der ein paar Jahre älter als sie war, zur Schule gehen, und die Oma konnte dort gut für mich sorgen!
Warum mich aber so weit weggeben? Ich habe doch gleich nach meiner Geburt gelächelt und mich ganz klein gemacht, damit alles leichter geht.
Es war damals nicht üblich, die Kinder im Krankenhaus bei der kranken Mutter zu lassen, nicht einmal ein Baby! Es war damals moderner, das Kind weit weg zu geben, das hatte mit dem medizinischen Fortschritt und der Modernität zu tun!
Es war die schlimmste Trennung, die ich je erlebte hatte, und alle Trennungen in meinem späteren Leben fühlten sich so an wie jene.
Heute weiß ich, dass meine Mutter damals eine schwere Schwangerschaftsdepression hatte, wie so viele Mütter, die jenen Krieg erleben und irgendwie aushalten und durchhalten mussten. Auch heute leiden viele Frauen unter einer Schwangerschaftsdepression. Nur damals wurde das nicht thematisiert. Wer soll denn eine solche haben, wenn nicht jemand wie Maria, die so viele Schmerzen hatte, so sehr krank und deshalb selbst so bedürftig war? Wie sollte sie einen bedürftigen Säugling versorgen können?
Ich war also hier auf der Erde angekommen und mir fehlte die mütterliche Fürsorge und Geborgenheit. Sie fehlt mir übrigens bis zum heutigen Tag! Heute nennt man das „Early-Life-Stress!“