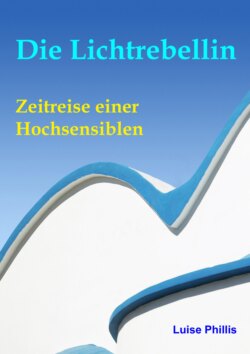Читать книгу Die Lichtrebellin - Luise Phillis - Страница 7
Die Kindheitsschatten der 1950er-Jahre –Verdrängungszeit
ОглавлениеEs gibt keinen Weg, nur Schritte ins Ungewisse.
Christiane B. Dinlger
Der Abschied damals war für alle Beteiligten fürchterlich. Für Gustav, der sich so sehr ein Kind gewünscht hatte, für meine Mutter, die ebenfalls ein Kind gewollt hatte, und wenn es um Gustavs Liebe willen war, und für Lenchen, die gern ein Zuhause mit ihren Eltern gehabt hätte.
Jetzt steht wieder ein Abschied an. Es ist ein Abschied für immer, jedenfalls für dieses Leben. Ich war gestern bei Gustav, meinem Vater, dem „besten Vati der Welt“, so hatte ich es als Kind häufig formuliert.
Jetzt sage ich das auch wieder zu ihm, und er lächelt dann und sieht aus wie ein Engel. Er wird immer schmaler und dünner und zerbrechlicher und ist seit einem halben Jahr nicht mehr aufgestanden.
Er hat einen Katheter, weil er etwas mit der Prostata hat, die Ärzte wissen nicht genau, ob es sich dabei um Krebs handelt. Sie hatten ihm vor einem halben Jahr, als die Schmerzen so stark waren, und er nicht mehr aufstehen konnte und wollte, ein morphiumähnliches Medikament gegeben, das erhebliche Nebenwirkungen hatte. Z. B. verspürte er große Übelkeit und aß und trank nichts mehr. Er war am Verhungern und Verdursten.
Als ich ihn mit Danno, meinem Mann, besuchte, bat er uns, ihn zu retten. Es war so schwierig, das zu entscheiden – ob es Sinn machte, dass er ins Krankenhaus kam oder nicht. Ich sorgte für einen Notarzt. Das war vom Heimpersonal gar nicht erwünscht. Gustav bekam eine Infusion. Ich erkundigte mich hartnäckig bei seinem Hausarzt, ob er denn wirklich Krebs hätte und dieses morphiumähnliche Medikament benötige. Da hieß es, dass er kein Karzinom hätte, die Schmerzen kämen von seiner Arthrose.
Und wegen meines eindringlichen Nachfragens wurde dieses Morphiumpflaster endlich abgesetzt und Gustav erholte sich ein wenig. Er aß ein wenig, sprach wieder klar und sein Gebiss passte auch wieder.
Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand stirbt, ich war noch nie dabei, jedenfalls nicht in diesem Leben. Es sah schon im vergangenen Herbst so aus, als würde er sterben. Die Trauer fing schon an, jedenfalls bei mir, aber auch bei Lenchen. Maria trauerte und weinte und versuchte tapfer, diese Zeit durchzustehen.
Es gelingt ihr bis heute nicht wirklich.
Ich habe mich damit beschäftigt. Ich möchte alles richtig machen! Wir feierten vor zwei Monaten, im Mai, Marias 90. Geburtstag – bei Gustav in seinem Krankenzimmer. Ich habe eine Mappe mit Fotos, Liedtexten und einer Rede zusammengestellt, die die Höhepunkte aus Marias Leben betonte. Diese habe ich dann auch vorgelesen. Und dann haben wir die Lieder, die meine kleine Oma gesungen hat, selbst gesungen.
Wir, das waren Lenchen, ihr Mann Max, Danno, Maria und ich. Auch Gustav hatte mitgesungen. Er hat immer gern gesungen: zu Weihnachten, wenn im Radio Weihnachtlieder zu hören waren, die zweite Stimme. Ich habe das immer bewundert und genossen …
Maria, das Geburtstagskind, die so gebückt vor Trauer, Last und Schmerzen das Zimmer betreten hatte, bekam einen anderen, lichteren Gesichtsausdruck, als sie meine Rede hörte. Gustav war ganz fein angezogen, wie immer in seinem Leben. Er trug ein wunderschönes weißes Hemd und eine Anzughose.
Das muss sehr anstrengend für ihn gewesen sein, sich überhaupt so anzuziehen, er bedurfte zwar der Hilfe, aber immerhin, er sah äußerst würdevoll aus.
Er konnte aber vor Schwäche nicht aufstehen.
Jetzt bekommt Gustav wieder dieses morphiumähnliche Pflaster. Ich fragte den Arzt. Es soll nun doch ein Karzinom sein. Er ist jetzt angeblich schmerzfrei. Er isst nun fast gar nichts mehr und trinkt auch kaum etwas, da dieses Pflaster eine große Übelkeit hervorruft. Er ist nun tatsächlich am Verhungern und am Verdursten.
Gustav hat Ängste und Panikattacken, davon spricht er manchmal. Auch bei ihm kommen alte Traumata hoch, die sich jetzt ihren Weg bahnen.
Es ist wichtig aufzupassen, was geschieht. Ich traue den Schulmedizinern nicht. Ich finde, dass es gar kein Sterbebett gibt, sondern nur ein Lebensbett. Der Abschied von diesem Leben dient dem Leben, diesem und dann vielleicht, wenn man daran glaubt, ebenfalls einem anderen.
Jedenfalls denke ich, dass das Leben nicht künstlich verlängert werden sollte, aber genauso wenig sollte es künstlich verkürzt werden. Genau hier fängt es an, schwierig zu werden. Die Schulmediziner sprechen von Linderung. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr vorsichtig. Ich kann die Sprüche nicht vertragen, die da lauten: „Er ist ja schon 93, da ist das kein Wunder. Ich wünsche ihm, dass er erlöst wird von dem Leiden!“ Diese Erlösungswünsche fühlen sich für mich sehr unbehaglich an! Wer weiß denn wirklich, wann ein Leben nicht mehr lebenswert ist!? Diese Frage mit der entsprechenden Antwort hatten wir doch schon in der deutschen Geschichte! Vielleicht nimmt Gustav Abschied, vielleicht wird er aber auch zu aktiv verabschiedet, und er hat gar keine Chance mehr zu entscheiden. Es ist die göttliche Kraft, die wirken muss, die menschliche darf hier allerdings nicht eingreifen, nur lindernd, so empfinde ich das. Wo hört die Linderung auf und wo fängt die Lebensverkürzung an? Wissen kann ich das nicht, niemand kann es wissen. Aber es ist die Einstellung, zum Leben, zur Energie, die Lebensbejahung, die Energiebejahung, so lange noch ein Atemzug getan wird. Alles andere ist Mord, was Wilhelm Reich in seiner gleichnamigen Schrift als Christusmord bezeichnet, alles das, was unbedingt leben will, was Energie ist, was Freude und Barmherzigkeit ist, wird zerstört, soll zerstört werden, von der Gegenenergie, von der Gegenwahrheit, wie Wilhelm Reich das nennt, die zu jener natürlichen Kraft des Lebens keinen Zugang hat und auch nicht weiß, wie sie einen bekommen kann und sie deshalb zerstören will.
„Gesundes, gutes Leben ist dagegen in der Lage, Bäume schneller wachsen zu lassen, und es kann aus Fischen Vögel und aus Affen Menschen machen. Genau das ist die Tragödie des kranken und das große Glück des gesunden Lebens. Das kranke Leben weiß dies und weidet sich deshalb daran, das gesunde Leben zu töten und zu verfolgen, wo es nur kann.“ (W. Reich aus seinem Buch „Christusmord“)
Gustav also liegt seit nun mehr als neun Monaten „im Sterben“. Dabei will noch so viel in ihm leben, seine Hände sind gut durchblutet, seine Füße ebenfalls, dennoch hat etwas in ihm beschlossen, zu sterben! Ich stelle mir die Frage, ob ich, ob wir, Maria, Lenchen und ich, genügend gezeigt haben, vorgelebt haben, dass auch sein Leben von 93 Jahren noch lebenswert sein kann, noch lebenswert ist, dass wir uns freuen, dass er noch da ist, hier ist, und mit uns den Eingang ins Wassermannzeitalter erlebt – 2012 als Fixum, das viele als den Dreh- und Angelpunkt in ein neues Zeitalter des Wandels vom aufrechten zum aufrichtigen Menschen ansehen!?
Haben wir es genügend gezeigt? Gustav war als Mann, als Mensch, seiner Zeit voraus. Er war nie autoritär, immer dankbar und ein Liebender, einer, der das Leben liebte, die Sonne, den Mond, die Pflanzen, Tiere und Menschen und Gott. Das zeichnete ihn aus. Er tanzte so gern, er sang so gern. Er war so gern hier auf der Welt. Ich habe es versucht, ich meine, ihm zu zeigen, dass es schön ist, wenn er noch hier ist. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Jedenfalls isst er nichts mehr und hält Maria für mich … Er fragte Lenchen an einem schönen Julitag, ob es draußen schneit. Gustav verabschiedet sich!
Als ich sein Zimmer vor zwei Tagen verließ und mich von ihm verabschiedete, da sagte er mit viel Mühe und mit einer nachdrücklichen Langsamkeit: „Komm gut nach Hause! Komm gut nach Hause! Komm gut nach Hause!” Und dann sagte er noch einmal das gleiche zu Maria und mir: „Kommt gut nach Hause, kommt gut nach Hause, kommt gut nach Hause von dieser Welt!“
Er will also endlich nach Hause, nach so vielen Jahren in seine richtige Heimat kommen. Ich glaube, dass er immer auf der Suche war nach dieser Heimat. Ich meine jetzt zu wissen, warum ich keine örtliche Heimat finden kann. Diese Sehnsucht habe ich mit Gustav gemeinsam.
Jedenfalls war ich traurig und ich schreibe jetzt noch mehr gegen die Zeit, im Zeit- und Raumkontinuum, als könnte ich hiermit etwas bewirken im Hinblick auf Klärung, Verstehen und Loslassen!
Und ich? Für mich ist es schwierig, obwohl ich so viel darüber weiß, über das Leben und Sterben, aus Büchern und vielleicht aus alten Leben!
Jedenfalls bin ich an dieser Stelle des Romans erst geboren, befinde mich im ersten Jahr meines Lebens. Es war damals kein Abschied, keine Trennung für immer, aber ein Baby weiß das nicht. Irgendwie ist es mir bis heute nicht klar, aber irgendwie auch doch, warum ich damals weg musste mit Lenchen. Es war wohl das damalige Bewusstsein: „Das Kind kann ruhig weit weg von der Mutter sein. Das macht gar nichts, wenn eine Oma dann als Ersatzmutter fungiert, ist es für alle Beteiligten die beste Lösung! Für das Baby ist es sowieso nicht so schlimm, das merkt das noch nicht und kann sich nicht erinnern! Für Lenchen könnte es da vielleicht etwas problematischer sein, aber auch das ist nicht so schlimm!“
Dabei ist das Gegenteil der Fall: Ein Baby erträgt die Trennung nicht oder viel schlechter als ein achtjähriges Kind wie Lenchen.
Lenchen und ich waren auf Juist bei unseren Großeltern und Onkel Andre. Lenchen ging dort zur Schule, musste umgeschult werden, da sie ja zwei Jahre zuvor in dem Dorf an der holländischen Grenze eingeschult worden war. Onkel Andre brachte sie dorthin. Er war sieben Jahre älter als sie und damals 15 Jahre alt, und Lenchen sollte sich bei ihm auf dem Schulweg immer einhaken, so wollten es unsere Großeltern. Sie wollte das nicht und schämte sich. Lenchen vermisste ihre Eltern, sie fühlte sich verlassen.
Meine Großeltern machten alles so gut, wie sie es konnten in ihrem Alter, mit ihrer eigenen Geschichte, zwei Weltkriege hinter sich gebracht zu haben, die Flucht, ein Neuanfang ohne Haus und Hof, Gesinde und Tiere!
Fürsorge wurde mir nach dem Prinzip „sauber, satt und trocken“ zuteil. Und sonst? Es gab nicht viel darüber hinaus. Ich war verloren ohne meine Mutter, ohne meinen Vater. Jede einzelne Körperzelle schrie nach ihnen.
Ich hatte sie mir doch als meine Eltern ausgesucht! Ich wollte doch bei ihnen sein!
Damals auf Juist wurde ich im Kinderwagen ausgefahren. Auf dieser Nordseeinsel waren neben den Flüchtlingen auch Urlauber, die sich auch zu jener Zeit Ferien vom Alltag leisten konnten. Reiche Menschen gab es immer, auch nach dem Zweiten Weltkrieg.
Da ich ein außergewöhnlich hübsches Baby war, das bereits viele Haare hatte und große dunkle Augen, wurde ich häufig angelacht, von Spaziergängern, Urlaubern, von Nachbarn, Familienangehörigen, von Alt und Jung. Und ich lächelte zurück. Ich war hier auf diese Welt gekommen, um zu lächeln, um zu geben und etwas abzugeben – das war mein Gefühl, seit ich denken kann.
Und irgendwann hatte ich dann dieses Lächeln verloren, aber das war viel später und ist noch nicht dran. Es war damals kein gequältes Lächeln, vielmehr war es ein Lächeln des Lebens, des Lebenwollens, der Offenheit, die pure Lebensenergie, der „ungepanzerte Mensch“, nach W. Reich.
Damals auf der Insel Juist fing also mein Leben an. Es hört sich so nach Ferien, Relaxen und Entspannung an. Das Leben auf einer Nordseeinsel, mit Sonne, Wind und Ruhe. Aber es war eher ungeordnet, nicht geplant, ich sollte doch eigentlich bei meinen Eltern sein, jedenfalls hätte ich das gern gewollt, aber es war so, wie es war. Das fühlte sich für alle Beteiligten schwierig an. Also lächelte ich noch mehr und war das entsprechende Wonnebaby. Ich kannte auch damals schon das Gefühl von Dankbarkeit und Dankbarsein, dass ich überhaupt hier sein darf.
Ich wurde gut gefüttert, mit fetter Kuhmilch, Karotten- und Haferbrei.
Und um nicht aufzufallen, aß und trank ich alles, was mir als Brei oder in Form eines Fläschchens bereitet wurde, ohne dass etwas übrig blieb. Ich war also das artige, problemlose, hübsche Baby, das alle liebten, so schien es zumindest. Nur meine Eltern waren sehr weit weg.
Alle waren froh, dass die Zeit des Hungerns, der Ungewissheit und der Todesangst vorbei war. Und fast alle taten alles, um nicht an die Zeit der Entbehrungen, des Leidens und der Ängste erinnert zu werden. Insofern war dies eine glückliche Zeit im Hinblick auf den wirtschaftlichen Aufschwung.
Das Bewusstsein verlagerte sich auf den Konsum, alles musste neu aufgebaut werden, dafür brauchte man alles an materiellen Gütern, was man herstellen und beschaffen konnte. Es begann eine Zeit des Neuanfangs, des Nachholens, des Verdrängens, und dennoch machten es alle so gut, wie sie es nur konnten!
Häufig wurde ich nicht von meiner Großmutter ausgefahren, sondern von einem engagierten Mädchen, das nur etwas älter als Lenchen war.
Deshalb war Lenchen oft traurig, weil sie mich ausfahren wollte, das aber nicht durfte, weil sie noch zu jung sei, so meinten meine Großeltern.
Eines Tages, als sie draußen mit anderen Kindern spielte, sah sie plötzlich den Kinderwagen, in dem ich gelegen hatte, einfach unter einem Baum abgestellt, und von dem Babysitter-Mädchen war nichts zu sehen.
Lenchen hatte das sehr wehgetan, denn sie sah mich dort allein gelassen und fühlte sich für mich verantwortlich, was sie auch später mir gegenüber meistens empfand – ein außergewöhnliches Verantwortungsbewusstsein.
Das wurde viele, viele Jahre später geradezu aufgedeckt, als sie Schulleiterin war und wegen ihres Hyper-Verantwortungsbewusstseins, unter dem sie selbst, aber auch andere immer irgendwie gelitten hatten, eine Supervision durchführen ließ.
Auch ich wurde später, als erwachsene Frau, an jene Situation erinnert, natürlich aus meiner Sicht, nämlich, als ich ein „Rebirthing-Wochenende“ mitmachte, an dem ich durch Hyperatmung an dieses frühkindliche Alleingelassensein in meinem Kinderwagen herangekommen war, und ich von Weinkrämpfen geschüttelt wurde.
Danach fühlte ich mich erleichtert.
Ja, das war damals eine schwierige Zeit für alle in dieser Familie und für die meisten im Nachkriegsdeutschland. Es wurden die sichtbaren und unsichtbaren Wunden gesalbt und gepflastert. Wirkliche Heilung gibt es erst jetzt, im neuen Jahrtausend!
In unserer Familie wusste damals niemand genau, ob Maria jemals wieder würde gehen können. Sie lag in der Gipsschale, ganz tapfer! Sie hatte höllische Schmerzen, dachte an ihre Kinder und konnte es nicht aushalten, diesen Seelenschmerz, aber sie wollte wieder gesund werden, ihr Leben mit Gustav leben können und mit ihren Kindern.
Und Gustav? Gustav war natürlich auch unglücklich … Er hatte so viel durchgestanden, war heil davongekommen. Er hatte jetzt eine Familie und war doch allein! Er konnte Maria die Schmerzen nicht abnehmen und auch nicht die Ungewissheit darüber, ob sie jemals wieder würde gehen können. Er war traurig und betete um ihr aller Wohl, so wie die kleine Oma das besonders auch während des Krieges getan hatte und es weiterhin tat.
Und da waren nun auch noch die Frauen, die Gustav so gern hatten, es waren nicht nur Frauen, alle Menschen mochten ihn, wenn sie nicht der „Gegenenergie“ angehörten und neidisch auf ihn waren. Alle, die dem natürlichen Leben zugänglich waren, liebten Gustav. Er sah nicht nur sehr gut aus, sondern er war auch äußerst feinsinnig in seiner Art, überhaupt nicht autoritär, weil er das nicht nötig hatte, und sehr offen, gefühlsbetont und herzlich, was in seiner Männergeneration nicht häufig vorkam. Somit war er der Zeit voraus. Er war der Gentleman, der sich selbst und das Leben liebte. Wie sehr er den Frauen und deren Annäherungen widerstanden hatte, das weiß ich nicht, das weiß keiner so genau. Jedenfalls war er immer ein guter Vater gewesen und war sehr lieb zu Maria. Was er selbst in dieser Zeit durchgemacht hat, das hat er nie erzählt.
Es war die Zeit des Getrenntseins, es war irgendwann ein Jahr vorbei. Es muss Anfang 1954 gewesen sein. Auch für Lenchen war es eine schwierige Zeit gewesen: Sie fühlte sich benachteiligt und hörte so ungeschickte und kinderseelenfeindliche Worte von unseren Großeltern wie diese: „So, nun bist du nicht mehr die alleinige Prinzessin, du wirst jetzt nicht mehr so viele schöne Kleider haben wie bisher, die musst du nun mit deiner Schwester teilen!“
Und eines Tages konnten wir zurück zu unseren Eltern. Und wir hatten ein eigenes Zuhause! Für eine Zeit lang. Es gab einen Ort der Zugehörigkeit für eine Zeit, so wie vielleicht alles nur für eine bestimmte Zeit und nichts von Dauer ist.
Maria durfte nun das Krankenhaus verlassen und war mit Gustav zusammen in das neue Haus in Mel. gezogen. Das Wiedersehen war freudig, mit dem Beigeschmack des Verlustes, den alle ein Jahr lang hinnehmen und erdulden mussten, jeder so, wie er es konnte.
Maria war noch bettlägerig, aber die Chancen, dass sie wieder würde gehen können, standen gut.
Die kleine Oma war nun zu Besuch und half im Haushalt. Maria musste noch im Bett liegen, aber es ging ihr besser. Sie bekam ein festes Korsett und begann, das Gehen zu üben. Ich war in einem Kinderwagen festgeschnallt, damit ich nichts „Schlimmes“ anrichten konnte. Abends wollte ich nicht schlafen, dann habe ich den Wagen mit meinem Körper so bewegt, dass er an den Küchenschrank rollte, da habe ich dann eine Schublade ausgeräumt. Jedenfalls habe ich abends erst geschlafen, wenn meine Mutter sich mit viel Umständlichkeiten aus dem Bett bemüht und über meinen Kinderwagen gebeugt hatte. Übrigens hatte ich fast nie geweint oder geschrien!
Eines Tages konnte sie wieder gehen, und wir waren eine richtige Familie!
Und die kleine Oma konnte wieder nach Hause fahren, in ihr damaliges zu Hause in Nes. bei Onkel Ernst.
Darüber waren alle wirklich froh und glücklich, so war oder so schien es. Es war die Zeit des Nachholens. Dabei galt es wirklich, alles nachzuholen, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht möglich ist, irgendetwas nachzuholen.
Jedenfalls war es damals wichtig, sich neu einzurichten, sich gut zu kleiden, gut zu essen und zu trinken und alles Gewesene möglichst zu vergessen. Es war die Zeit der äußerlichen Freuden. Heute gibt es Menschen, die nach der inneren Freude suchen und nach innen gehen und sogar viel Geld für z. B. Heilfasten und Schweigen ausgeben, damals ging es vor allem darum, die äußeren Lebensumstände zu bewältigen.
Gustav arbeitete immer noch bei der Ölfirma Wintershall und Maria war zu Hause.
Es war ein großes Grundstück, auf dem unser damaliges Haus gebaut worden war, und es wurden Obstbäume und Sträucher angepflanzt. Und dann hatten wir Hühner. Maria und Gustav wollten irgendwann einmal eine Hühnerfarm eröffnen. Nun waren es zunächst einmal viele Hühner, die im Garten herumliefen, ein paar Enten und Gänse. Aus heutiger Sicht handelte es sich um artgerechte Tierhaltung.
Und Maria wurde gesünder, sie konnte wunderbar gehen und sie wollte vollständig gesund sein. Sie hatte häufig Schmerzen und konnte ihren rechten Arm nicht mehr ganz gerade machen, das ist bis zum heutigen Tage so geblieben, aber es ging ihr immer besser, und sie wollte nie wieder krank sein oder an dieses eine oder überhaupt ein Krankenhaus erinnert werden.
Und ich sollte eines Tages wohl „behütet“ werden, indem Gustav und Maria einen Laufstall für mich gekauft hatten. Es war ein Gitter, das relativ weitläufig im Wohnzimmer um mich herumgestellt worden war. Und ich wurde mit meinem Teddy da hineingesetzt und sollte dort spielen. Ich fühlte mich derart beengt, eingesperrt und ausgesetzt, dass ich, anstatt zu spielen, anfing zu schreien und zu weinen, und zwar mit so einer Heftigkeit, dass Gustav und Maria mich dort sofort herausholten und das Laufgitter abbauten und nie wieder aufstellten. Was Maria und Gustav so erschüttert hatte, war, dass ich ja sonst nicht geschrien oder geweint hatte. Es ist bis zum heutigen Tage so geblieben, dass ich mich nicht eingeengt, nicht eingesperrt und nicht unfrei fühlen mag – und das auf allen Ebenen, besonders auch nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ich wuchs heran und lernte, mithilfe eines großen Balles zu laufen. Dann begann ich zu sprechen und sagte zu mir selbst: „Sali“ statt „Elisa“, „Klingsire“ statt „Rasierklinge“, „Kuschlade“ statt „Schublade“ usw. Und dann sagte ich zu Maria „Mammi“ und zu ihren Brüsten „Füchse“ und zu Gustav „Papi“. Ich habe ihn nur einmal nackt gesehen. Wir hatten kein richtiges Badezimmer. Alle wuschen sich in der Küche in einer Schüssel, so auch Gustav. Und ich saß in einem Schaukelpferd mit Sitz, hatte die Augen zu und schaute Gustav zwischendurch an.
Und eines Tages konnte ich „Ich“ sagen statt „Sali“. Von Lenchen und den Erwachsenen wurde ich weiterhin „Sali“ genannt. Ich sah mich bewusst im Spiegel und fühlte ein Ich.
Wahrscheinlich war das Fühlen dieses Ichs damals bis heute nicht ausgeprägt genug, da ich durch die frühkindliche Trennung von meiner Mutter nicht die Geborgenheit, nicht die Stärke der Vertrautheit und Verbundenheit erfahren konnte. Also war es zwangsläufig auch nicht möglich für mich, eine Trennung zu vollziehen, die ein kräftiges Ich benötigt. Mein Ich war und ist bis zum heutigen Tage durchlässig mit der Welt verbunden. Nach Albert Einstein und der Quantentheorie macht genau das das wahrhaftige Sein und Werden des Menschen aus, wenn die Trennung zwischen Ich und Du aufgehoben ist. Also das machte mich damals bereits aus und hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Für meine Umgebung war diese Verhaltensweise angenehm und hilfreich, für mich selbst war diese Nicht-Ich-Werdung lebenslang sehr anstrengend. Meine Mitmenschen zeigten alle ein ausgeprägtes Ich und konnten sich im Gegensatz zu mir gut gegen alles andere abgrenzen, was ich aber erst viele, viele Jahre später, als ich krank geworden bin, herausgefunden habe.
Alles ging damals ruhig und friedlich zu, jedenfalls das, was sich im Äußeren abspielte. Wir hatten ein eigenes Haus und ein großes Grundstück.
Ab und zu wurde ein Schwein geschlachtet, das eigens dafür angeschafft worden war. Maria hatte einen Fleischwolf und es wurde Wurst selbst gemacht. Maria schlachtete auch Hühner, je nach Bedarf. Es wurde nicht viel Fleisch gegessen, aber irgendwie auch doch, es gab in der Regel nur sonntags welches. Das Bewusstsein, vegetarisch zu leben, existierte damals in unserer Familie noch nicht, obwohl viele der Vorfahren der kleinen Oma vegetarisch lebten und einige von ihnen so etwas wie Mönchskutten trugen, obwohl sie keine Ordensleute waren.
Jedenfalls durfte ich damals nicht beim Schlachten zuschauen und wurde ins Haus geschickt. Dort sah ich heimlich aus dem Fenster, was geschah, aber nur von weitem. Ich hatte das nicht verstanden, nicht wirklich, aber ich fand den Vorgang, der sich hier abspielte, ungeheuerlich, nicht richtig, das konnte nicht richtig sein!
Ich konnte keinem Grashalm etwas zu Leide tun! Über meine Empfindungen sprach ich mit niemandem. Ich nahm das wahr, was um mich herum geschah, und ich war dankbar dafür, dass ich da sein durfte – überhaupt sein durfte.
Das Haus war geräumig und mit neuen Möbeln eingerichtet, die dem 50er-Jahre-Stil entsprachen. Eine Küche mit einem alten Küchenschrank, einem Tisch mit ausziehbaren Waschschüsseln, den ich in den 1970er-Jahren während der Studentenzeit in meiner Wohngemeinschaft in die Küche stellte, weil es keine Einbauküche und auch keine Spüle gab. Er leistete dort gute Dienste und passte hervorragend in die Subkultur der 1970er-Studentenjahre oder auch nicht.
Damals in Mel. gab es zu dem Tisch noch braune Stühle, die eines Tages weiß angestrichen wurden, und dann kam unangemeldet ein Schornsteinfeger in die Küche. Auf den frisch gestrichenen weißen Stühlen lag Ruß und der Schornsteinfeger bückte sich und war entsetzt, pustete über die Stühle, was nichts nützte, und entschuldigte sich bei Maria.
Im Wohnzimmer standen ein kleiner Rauchtisch und zwei Sessel mit einer Stehlampe, an der Seite des Raums befand sich ein großer ausziehbarer Esstisch mit vier Stühlen. Ebenso gab es ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer, das weit vom Elternschlafzimmer entfernt war. Dort standen zwei Kinderbetten, für Lenchen und mich. Viele Pflanzen hatte Maria im ganzen Haus verteilt, wie z. B. Grünlilien, und wir hatten Gardinen und ein Plumpsklo neben dem Stall.
Ich weiß nicht, warum wir noch keine Wassertoilette hatten, aber es war damals in ländlichen Gegenden noch nicht so üblich.
Mel. war ein kleines Dorf sehr nah an der holländischen Grenze. Es war einsam gelegen und außer einem Einkaufsladen, der damals Konsum genannte wurde, gab es dort nicht viel. Und neben an, nicht weit entfernt, standen Baracken. Dort wohnten ehemalige Flüchtlinge aus dem Osten, die sehr arm waren. Dort bin ich manchmal zum Spielen hingelaufen.
Ein Nachbarmädchen in meinem Alter, die Bärbel hieß, wurde meine Freundin.
Darüber hinaus gab es viel auf unserem Grundstück zu entdecken. Im Sommer wurden die reifen Johannisbeeren gepflückt und die leckeren Himbeeren und Brombeeren. Ich war auch immer dabei. Die wurden dann mit Milch und Zucker gegessen oder als Marmelade eingekocht. Es gab auch Pflaumen, aus denen wir Mus kochten, auch viele, viele Jahre später, als wir schon längst woanders wohnten. Die Erdbeeren im Garten und auch den Rhabarber empfand ich immer als viel zu sauer. Frische Radieschen und viele unterschiedliche Kräuter, hübsche, bunte Blumen und auch Kartoffeln waren im Garten zu bewundern.
Einmal gab es im Sommer eine Kartoffelkäfer-Plage, und alle aus dem Dorf halfen sich gegenseitig, diese auf den Feldern abzusammeln. Auch ich habe dabei geholfen. Pestizide hatte man damals deswegen noch nicht gesprüht.
Gustav senste das hohe Gras im Garten und ich pflückte Blumen. Essen und Trinken spielte in den Nachkriegsjahren eine besonders wichtige Rolle, und so war es auch in unserer Familie. Es wurde gekocht, eingekocht, gebrutzelt, gebraten und gebacken. Nudeln machte Maria selbst. Es wurde Teig ausgerollt und dann wurde dieser in kleinste Streifen geschnitten. Da mochte ich gern zusehen. Und es wurde Kuchen gebacken und Buttercremetorten mit feinster Buttercreme verziert. Ich durfte immer die Schüsseln auslecken, wenn noch kein Mehl im Teig war. Maria schlug Eier mit Zucker und Butter schaumig, das schmeckte lecker.
Und es gab sonntags richtigen Bohnenkaffee, der in einer Kaffeemühle gemahlen wurde, was Gustav sonntags immer tat. Er saß auf einem Küchenstuhl neben dem Küchenschrank und hatte die Kaffeemühle auf dem Schoß und drehte an einer Kurbel. Das war ein wohlig kratzendes Geräusch, und es duftete angenehm. Maria verzierte derweil die Torte mit Creme oder Sahne oder beidem.
Maria und Gustav genossen den Bohnenkaffee und wir Kinder tranken Kakao oder Caro-Kaffee.
Jedenfalls war alles sonntäglich aufgeräumt. Maria hatte ein hübsches Kleid an, das sie selbst genäht hatte, Gustav eine Anzughose mit weißem Hemd, und wir Kinder hatten Schleifen im Haar und waren auch fein mit selbst genähten Kleidern angezogen. Alle hatten ein Gefühl von Behaglichkeit, Geborgenheit und Glücklichsein. Es wurde geschlemmt, und all das wurde nach der Zeit der Entbehrung als wahrer Luxus empfunden.
Vor dem Kaffeetrinken hatte es einen richtigen Sonntagsbraten gegeben. Im Ofen gebackenes Rindfleisch, Kartoffeln und feinstes Gemüse. Die sonntägliche Mahlzeit begann mit einer Vorsuppe, einer Rinderbrühe oder Tomatensuppe, einer Rote- Beete-Suppe oder einer „Weißen Suppe“, die aus einer Brühe von geräuchertem Fleisch hergestellt und mit Sahne, Zitrone, Majoran und Nudeln versehen wurde. Diese war immer meine Lieblingssuppe gewesen, und ich liebe Suppen bis zum heutigen Tag.
Während Maria sonntags in der Küche mit dem Sonntagsbraten beschäftigt war, lag Gustav häufig auf der Chaiselongue und hörte im Radio klassische Musik. Bei Opernduetten summte er mit, schloss die Augen und entspannte sich. Ich mochte das gern, nur nicht, wenn Gustav die Augen schloss, dann fühlte ich mich irgendwie allein.
Ich höre heute auch gern klassische Musik im Radio, genau wie Gustav.
Im Sommer gab es damals häufig Sauerampfersuppe und vor Weihnachten wurde „Schwarz-Sauer“ zubereitet und gegessen. Dieses Gericht wurde aus einer Entenbrühe gekocht, dann Backobst hineingegeben und das Ganze mit Entenblut angerührt und auch mit Majoran abgeschmeckt, dazu gab es selbst gemachte Nudeln.
Das konnte ich nicht essen, und ich musste es auch nicht. Überhaupt wurden wir Kinder nicht zum Essen gezwungen. Es wurde vielmehr mit positiven Verstärkern gearbeitet: Als Lenchen drei Jahre alt war und häufig nicht essen wollte, hatte Gustav ihr meistens 50 Pfennig angeboten (das war damals viel Geld), die sie dann bekam, wenn sie alles aufgegessen hatte. Bei mir war das nicht nötig, da ich artig immer alles aufgegessen habe.
Man war allerdings gut angesehen in der Familie, wenn man alles aß. Ich mochte nur das „Schwarz-Sauer“ nicht, dafür die Entenbrühe, jedenfalls, solange ich noch ein Kind war.
Häufig las Gustav mir sonntags, während Maria kochte, etwas vor. Es waren Mecki-Geschichten, mit einer Komikfigur aus einer damals beliebten deutschen Zeitschrift, die es auch heute noch als Fernsehzeitung gibt. Mecki war ein anthropomorpher Igel, der viele Abenteuer erlebte und große Herausforderungen bestand. Ich saß dann bei Gustav auf dem Schoß und genoss seine väterliche Liebe.
Und während des Sonntagsessens machte Gustav manchmal kleine Scherzchen mit mir. Ich liebte die kleine Maggi-Flasche auf dem Tisch und wollte mir wahrscheinlich etwas zu viel davon in den Teller tropfen. Dann hat Gustav das übernommen und mit großen Bewegungen die Flasche ganz stark geschüttelt und vorgegeben, mir viel von der dunklen salzigen Flüssigkeit in meinen Teller zu gießen. Da es aber nur vorgetäuscht war und ich das nicht wirklich bemerkte, lachten alle am Tisch und ich freute mich, dass die anderen lachten, und lachte mit.
Auch im Erwachsenenalter liebe ich Maggi als Gewürz besonders.
Wir lebten mit den Jahreszeiten und den christlichen Feiertagen. Zu Weihnachten wurde alles besonders schön gemacht, das war in meiner Familie immer so gewesen. Alles wurde aufgeräumt, sauber gemacht und dann wurden in der Adventszeit Enten und zu Weihnachten eine Gans geschlachtet. Alles und alle wurden hübsch gemacht, auch wir Kinder. Und es kam immer ein Weihnachtsmann. Ich habe nicht gemerkt, dass es Gustav war. Ich habe brav an den Weihnachtsmann geglaubt. Er drohte einmal mit dem Stock, das hat Gustav sonst nie getan, und sagte: „Du darfst keine Spucke mehr machen, sonst bekommst du keine Geschenke!“ Das war eine Angewohnheit von mir, wie ein Baby meine Spucke durch die Zähne vor meine Lippen zu schieben, was gar nicht weiter schlimm war, es sah nur etwas dümmlich und unästhetisch aus! Jedenfalls hatte seine „Drohung“ die gewünschte Wirkung, ich bekam meine Geschenke vom Weihnachtsmann und unterließ diese alberne Angewohnheit.
Und einmal bekamen wir zu Weihnachten Besuch. Meine Großeltern, die nun nicht mehr auf Juist wohnten, sondern eine Zuzugsgenehmigung in D., im Rheinland, bekommen hatten, kamen mit Onkel Andre und Onkel Fred und Tante Lotti, Marias jüngerer Schwester, zu Besuch. Sie waren bereits kurz vor Weihnachten angekommen und übernachteten alle in unserem Haus. Das war üblich bei meinen Familienmitgliedern, die aus dem Osten kamen! Es wurden immer viele Verwandte beherbergt und verköstigt, über all die Jahrzehnte hinweg.
Übrigens bin ich dieser Sitte auch in den wilden 1970ern, in meiner Studentenzeit, nachgekommen. Es übernachteten häufig viele Menschen bei mir, und ich kochte auch für alle, wie Maria das immer für ihre vielen Gäste getan hatte, nur war bei mir alles improvisierter und lockerer und doch irgendwie perfekt.
Jedenfalls war damals, Weihnachten 1956, das Haus voll von Verwandten, Marias Verwandten. Und am Heiligen Abend war ich aufgeregt, denn der Weihnachtsmann sollte wieder einmal kommen, und alle sprachen davon. Ich war sehr gespannt, freute mich aber auch darauf.
Im Kerzenschein kam dann der Weihnachtsmann, nach dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern – einen Plattenspieler hatten wir damals noch nicht – und einem wunderbaren Essen
Es war Gustav, aber ich hatte ihn als treu glaubendes Kind wieder nicht erkannt. Lenchen hingegen hatte ihn, als sie vier Jahre alt war und alle bei Settes Weihnachten gefeiert hatten, erkannt. Sie hatte seine großen strahlend hellen Augen entdeckt und gesagt: „Das bist du ja, Vati!“
Ich jedenfalls erkannte meinen Vater nicht, sondern glaubte fest an den Weihnachtsmann. Ich glaubte damals an alles, was die Erwachsenen mir vorlebten, ich hinterfragte nichts, schließlich empfand ich mein Ich nicht wirklich getrennt von der Welt und meinen Mitmenschen.
Ich war sehr entsetzt, als Onkel Fred und Onkel Andre Gustav, den Weihnachtsmann, neckten und ärgerten. Sie hatten den Sack mit den Geschenken versteckt und ihn an seinen Socken gezupft. Er hatte seine schweren Stiefel draußen gelassen, so erzählte er mir, weil er keinen Schmutz hineintragen wollte. Alle lachten, und ich verstand die anderen nicht, mir hat der Weihnachtsmann leid getan. Ich fühlte immer mit den anderen, den Leidtragenden, das war nun diesmal der Weihnachtsmann, ob es nun tatsächlich angebracht war oder nicht. Aber wer wusste und weiß das schon.
Es war trotzdem schön mit den Verwandten, damals zu Weihnachten. Die Erleichterung und Dankbarkeit war spürbar, den Krieg hinter sich gelassen zu haben, und das Leben oder das, was man dafür hielt, irgendwie spüren zu können. Während der Weihnachtszeit drohten die Kriegserinnerungen immer besonders aufzusteigen, und so wurde alles so gestaltet, dass diese nicht übermächtig werden konnte.
Damals, als so viele Verwandte in unserem Haus übernachteten, wurde ich von allen bewundert, denn sie sagten, dass ich so einfühlsam und rücksichtsvoll sei. Als ich nachts einmal Pipi machen musste, habe ich niemanden gerufen. Ich bin im Dunkeln aufgestanden, habe mein Töpfchen unter meinem Bett hervorgeholt und habe alles allein gemacht. Das stimmt, ich habe nie gerufen. Ich wollte es meiner kranken Mutter – ich sagte jetzt „Mutti“ und „Vati“ statt „Mami“ und „Papi“ – das Leben leicht machen, es auf keinen Fall irgendwie erschweren! Das ist bis zum heutigen Tage so geblieben.
Maria hatte immer gestrickt, und zwar für uns alle und für die kalte Jahreszeit. Damals haben fast alle Mütter gestrickt, so also auch Maria: Hosen, Röcke, Pullover, Schals, Mützen, Handschuhe und sonst noch was. Und eines Tages wollte Maria auch noch Geld dazuverdienen und sie verkaufte mit Gustav nebenbei „Strickapparate“.
Überhaupt war Maria sehr fleißig, umtriebig und aktiv, besonders, was die Tätigkeiten im und um das Haus betrafen – und dann auch um das Haushaltsgeld aufzubessern. Eigentlich war Maria nach ihrer schweren Erkrankung nur 50% arbeitsfähig, und sie bekam einen Schwerbehindertenausweis. Allerdings oder vielleicht deshalb wollte sie sich selbst und allen anderen beweisen, dass sie vollkommen gesund sei. Und so kam es, dass sie in ihrem Leben viel mehr arbeitete als andere Frauen, die gesund waren. Sie war so emsig, dass sie immer in Aktion war und selten zur Ruhe kam, wenn überhaupt. Sie stand wohl unter einer Art Dauerschock oder so.
Um die Kunden erreichen zu können, brauchte Gustav ein Fahrzeug. Da Maria und Gustav die Strickapparate den Kunden vorführen mussten, wenn sie sie verkaufen wollten, hatte Maria selbst einen zu Hause und produzierte nun mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit auf diesem länglichen Apparat, der ein wenig wie eine Klaviertastatur aussah, alles mögliche an Strickwaren. Man musste einen Hebel immer hin- und herschieben, und dann entstanden irgendwie die Maschen. Abschließend wurden noch längliche, schwere graue Eier mit kleinen Haken an das Gestrickte gehängt, damit das Produkt sich nicht verziehen konnte.
Nun war es so, dass ich als Kind schon Wolle irgendwie nicht vertragen konnte. Es bestand damals leider fast alles Tragbare aus Wolle: die Strumpfhosen, die Strümpfe, die Unterhemden und Unterhosen, die Hosen und die Pullover.
Jedenfalls als gutes, angepasstes Kind hätte ich auch das still ertragen müssen, so verhielt es sich aber nicht. Um meinem Unbehagen Ausdruck zu verleihen, streckte ich meine Extremitäten von mir und saß ganz steif in der Ecke. Es fühlte sich scheußlich an und es sträubten sich nicht nur meine Nackenhaare, sondern ich bekam eine Gänsehaut, obwohl ich gar nicht fror.
Meine Mutter hatte sofort Erbarmen mit mir und ich wurde von der Wolle befreit und somit auch von dem Unwohlsein. Die gesamte damalige Bundesrepublik wurde bestrickt, das bedeutete, die Frauen waren fast alle für ihre Kinder am Stricken, da es noch nicht so viel zu kaufen gab, und falls doch, konnten es sich die meisten nicht leisten.
Überhaupt war damals alles auf das Stoffliche ausgerichtet, vielmehr auf das Grobstoffliche. Heute machen sich die Menschen Gedanken und stellen Fragen wie: Aus welchem Land kommt die Wolle, ist sie mit Mottengift behandelt?
Viele Menschen reagieren allergisch auf irgendwelche Stoffe, auch auf Wolle. Jedoch gibt es auch heute noch viele Institutionen und Lobbyisten, die diese Tatsachen leugnen und sich in der gleichen naiven Weise verhalten wie die Menschen in den 1950er-Jahren oder die mit bewusster Verschlagenheit die Wahrheit zu verschleiern suchen.
Jedenfalls damals, als Gustav und Maria bei Kunden waren, um ihnen Strickapparate zu verkaufen, bekamen sie bei einer Familie ordentlich Schnaps zu trinken. Alle feierten irgendwie immer noch, dass der Krieg vorbei war.
Das Leugnen der Wahrheit, der schrecklichen Dinge, die im vorherigen Jahrzehnt und davor passiert waren, lag wie ein Schleier auf den meisten Gemütern. Jener Zustand und der des Verdrängens entsprachen dem Seelenzustand der 1. Phase der Trauer, wie sie heute in der Psychologie erfasst ist. In Zeiten der Trauer durchlebt der Mensch vier Phasen. Die erste Phase, die sich durch das Nicht-Wahrhaben-Wollen zeigt, wird begleitet durch Gefühle von Leere, Hohlheit, Empfindungslosigkeit, Betäubung und Chaos. Ja, so schien das damals gewesen zu sein.
All das war im Äußeren nicht wirklich sichtbar. Es schien, als ob im Äußeren eine Ordnung geschaffen würde, die im Inneren der Gemüter eine Leere, eine Hohlheit hinterließ. Das alles wurde gern betäubt, um die innere Leere und das, was tief dahinter an Gefühlen tobte, aushalten zu können.
Ja, damals setzten sich Maria und Gustav in angetrunkenem Zustand auf Gustavs Motorrad und fuhren mit einem langen Strickapparat auf dem Gepäckträger direkt in den Graben. Ihnen passierte nichts. Es gab in der Zeit nur wenige Autos. Das Motorrad, das verbeult war, mussten sie noch kilometerweit schieben.
Zu Silvester buk Maria immer Berliner, noch bis zu der Zeit, als sie bereits weit jenseits der 80 war. Auch dort in Mel. gab es „Rummelpottläufer“, Kinder, die an die Tür klopften und sangen, und Maria packte dann Berliner in ihre Taschen. Es war damals etwas Besonderes, Berliner zu essen, denn Essen und Trinken überhaupt spielten eine große Rolle in jener Zeit. Neben den familiären Festen, bei denen es gut zu essen und zu trinken gab, wurden auch Trinkfeste mit Freunden gefeiert. Hierfür wurde von Gustav und Maria eigens Schnaps selbst gebrannt. Und einmal war ein guter Freund zu Besuch, der „probierte“ mit Maria und Gustav den Schnaps bis zum Morgengrauen, und da das Gesöff so gut schmeckte, holte jener noch eine Flasche aus der Speisekammer und schenkte sich noch ein Glas ein, schüttelte sich dann und sagte: „Ist der aber stark!“ Gustav und Maria stellten dann fest, dass er die Essigflasche genommen und diese für die Schnapsflasche gehalten hatte. Sie lachten vor Schadenfreude und aus reiner Lebenslust heraus. Jedenfalls ging es sehr fröhlich und erdhaft zu.
Ich schreibe hier über das Essen und Trinken und die damalige Fröhlichkeit und jetzt? Jetzt ist das Gegen-die-Zeit-Anschreiben nicht mehr möglich: Gustav ist gestorben! Ich beschreibe, wie mein Leben angefangen hat, und Gustavs ist nun zu Ende, jedenfalls für dieses Zeitkontinuum.
Gustav ist nicht verhungert, so wie ich angenommen hatte, Wir hätten sein Nicht-Essen- wollen verhindern können, hatte ich gedacht. Er ist nicht verhungert, das weiß ich jetzt, oder auch nicht, wer weiß schon Bescheid über etwas so Komplexes wie das Leben und Sterben und den Tod. Ich bin jetzt mit Danno in einer Kurklinik zum Fasten. Die Beerdigung ist jetzt drei Tage her. Ich war ein paar Tage vor Gustavs Tod noch bei ihm gewesen. Er war sehr schwach. Ich wusste irgendwie, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sehe – so, wie er sich in diesem Leben gezeigt hatte. Er hat mich sofort erkannt. Er freute sich so sehr. Seine Seele war schon dabei, sich zu verabschieden. Ich fragte ihn, ob er Schmerzen habe. Er sagte: „Nein!“ Er war sehr schwach und atmete schwer und tief. Er sprach ganz langsam.
Ich sagte ihm, dass ich ihn sehr, sehr liebe, und er antwortete langsam und schwach und dennoch sehr klar: „Ich lieb dich auch so sehr.“ Weiterhin gab ich ihm zu verstehen, dass er der beste Vater der Welt sei. Dann fragte er mich schwach atmend, langsam und dennoch sehr bestimmt: „Worauf führst du das zurück?“ Ich antwortete: „Du warst und bist der liebevollste, großartigste, großzügigste und gütigste Vater, den ich mir vorstellen kann und auch für Lenchen. Und Mutti liebt dich auch so sehr.“ Gustav antwortete sehr tapfer und schwer atmend: „Ich lieb euch alle auch so sehr! Ich lieb euch alle auch so sehr!“
Ich nahm seine Hand, sowie ich es immer tat, wenn ich ihn besuchte und dann legte ich eine Hand auf seine Brust auf Lungenhöhe, weil er so schwer atmete. Er war sehr dünn, seine Arme waren so dünn, als würden sie durchbrechen und seine Hand war warm und stark, wie sie mir seit meiner Kindheit vertraut war. Dann nahm Gustav sehr langsam und vorsichtig meine Hand, die auf der Brust lag, und führte sie an sein Gesicht, mit sehr viel Sorgfalt und Zärtlichkeit. Ich sagte ihm, dass wir uns alle wiedersehen werden, und ich saß noch einige Zeit bei ihm, dann verabschiedete ich mich von ihm und er winkte noch – und ich winkte zurück und wusste irgendwie in diesem Moment um den Abschied für immer, jedenfalls für dieses Leben.
Als ich die Tür hinter mir zumachte, war ich sehr traurig. Dann ging ich hoch zu Maria, die ihr Zimmer direkt über Gustavs hat. Ihr ging es schlecht, sie konnte sich Gustavs Zustand nicht ansehen und die Angst vor dem Verlust nicht aushalten. Ihre schwere Depression ließ ihre frühere Stärke, mit dem Leben umzugehen und es zu meistern, schwinden. Sie war jetzt tatsächlich nicht stark genug für die Konfrontation mit Gustavs nahendem Tod. Sie betete und las christliche Texte, weinte viel und war und ist trotzdem nicht in ihrer Mitte. Das ist zu harmlos ausgedrückt. Sie ist heimatlos, ratlos, rastlos und verzweifelt. Ich gab ihr eine Metamorphosen-Reflexzonenmassage, und es ging ihr dann etwas besser. Trotzdem wollte sie nicht mit hinuntergehen, weil sie es nicht konnte. Sie wäre wohl total zusammengebrochen. Nach zwei Stunden verabschiedete ich mich von ihr, und ich fühlte mich traurig, dennoch wusste ich, dass es richtig war, gekommen zu sein. Es war Dienstagnachmittag und eigentlich hatte ich viel zu tun, aber was gab es Wichtigeres als diesen Besuch!
Wie oft hatte ich gedacht, es wäre das letzte Mal. Das war seit neun Monaten so, und ich war immer sehr traurig, wenn ich Gustav und Maria besucht hatte und wieder wegfuhr. Diesmal war es anders. Ich war zwar sehr unglücklich, aber ich war irgendwie auch ruhig. Am nächsten Tag hatte ich eine Unruhe in mir, und ich telefonierte mit Lenchen und sagte, dass ich nicht wollte, dass unser Vater verhungerte. Es musste doch eine andere Möglichkeit geben! Aber wir hatten keine! Und ich betete für ihn, jeden Abend und auch tagsüber. Lenchen besuchte Gustav am folgenden Mittwoch und Maria war am Freitag bei ihm, nicht allein, sondern mit einer jungen Frau vom Hospiz, die Gustav und sie wenige Wochen zuvor begleitet hatte. An jenem Freitag war ich unruhig, hatte viel zu tun und musste an Gustav denken, und ich wollte am nächsten Tag zu ihm fahren und mich auch um Maria kümmern. Am Freitagabend sagte Danno zu mir: „Die Seele deines Vaters ist dabei, sich abzulösen vom Körper, du musst dich morgen nur um ihn kümmern, nicht um deine Mutter, nur um deinen Vater, der ist jetzt der einzig Wichtige!“ Diese Worte beruhigten mich und ich fühlte, wie nah mein Vater mir war, und Danno erzählte mir von Rudolf Steiners Auffassung vom Leben nach dem Tod.
Dann klingelte das Telefon und Lenchen war am Apparat und teilte mir mit, dass Gustav vor einer Stunde gestorben sei. Ich weiß nicht mehr, was sie sagte, ich war sprachlos. Diesen Augenblick hatte ich, so glaube ich, am meisten gefürchtet in meinem Leben, den Tod Gustavs. Dennoch war ich ganz ruhig. Danno war sehr einfühlsam, wir waren beide traurig und gleichzeitig fühlten wir uns sehr verbunden mit Gustav. Ich erzählte Danno von einem Foto, das ich aus meinem Fotoalbum heraussuchte. Es zeigt Gustav mit mir, als ich knapp drei Jahre alt war. Es stammt aus jener Zeit in Mel., die ich gerade begonnen habe, zu beschreiben. Auf dem Foto sieht man Gustav in der Hocke. Er befindet sich also mit mir in Augenhöhe, er hält meine Hand und strahlt mich an. So habe ich ihn mein Leben lang empfunden. Auf Augenhöhe, nicht autoritär, sondern weit im Fühlen und Denken, großzügig, warmherzig und liebevoll. Dieses Foto trage ich seit dem in meinem Portemonnaie.
Lenchen hat noch einmal nachts angerufen und mir mitgeteilt, dass Gustav sehr friedlich aussähe und er wohl sanft eingeschlafen sei. Er ist allein gestorben, ganz tapfer, er ist ganz allein von dieser Welt gegangen!
Am nächsten Morgen sind Danno und ich in das Seniorenheim gefahren und haben Abschied genommen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Toten gesehen. Ich war sehr gefasst. Danno hatte mir noch einmal bestätigt, was für ein heiliger Moment das ist, wenn eine Seele den Körper verlässt. Ich verspürte eine tiefe Ruhe und ich fühlte die kalten Hände von Gustav, und ich empfand ganz klar, dass Gustav nicht mehr in diesem Körper war. Es war nicht Gustav, es war sein altes, vertrautes Kleid, das er nun abgelegt hatte. Ich konnte nun wahrhaftig das nachempfinden, was uns das Christentum und die alten Weisen wie die alten Philosophen gelehrt hatten.
Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, im Grab ist er nicht zu suchen. Und Platon sagte über das Sterben, dass der Mensch nur ein Kleid ablegte, die Seele sei unsterblich!
Ich konnte es fühlen, es war nur Gustavs altes, wunderschönes Kleid. Jetzt ist seine Seele noch weiter und feiner als vorher. Ich spürte sie im Raum, und ich betete mit Danno ein Vaterunser. Ich betete auch laut ein freies Gebet. Wir gingen hinaus und Lenchen und Max kamen und wir gingen dann zu viert ins Zimmer. Das war nun ein anderes Gefühl als das, das Danno und ich zuvor gehabt hatten, als wir allein mit Gustavs Seele gewesen waren.
Lenchen und ich gingen zu Maria, die noch klein und gebückt unter der Dusche stand, und teilten ihr mit, dass Gustav gestorben sei. Sie schien einigermaßen gefasst, was aber nur ein Schutz ihrer Seele war, für sie war es ein Schock, eine Katastrophe … Lenchen und ich halfen ihr beim Anziehen. Maria trug schwarz, genau wie ich. Wir gingen dann gemeinsam mit Danno und Max in Gustavs Zimmer. Maria weinte und weinte. Lenchen stützte sie und ich betete noch ein Vaterunser und ein freies Gebet und ermunterte die anderen, auch ein Gebet vorzutragen. Ich blieb die Einzige. Wir verließen dann Gustav, d. h. sein Kleid, das er nun abgelegt hatte, und fühlten den Abschied und brachten Maria in ihr Zimmer. Ich kümmerte mich darum, dass sie gleich Besuch von der jungen Frau vom Hospiz bekam und rief Tante Lotti an, dass sie doch schon vor der Beerdigung kommen möge, was sie dann auch tat.
Danno und ich fuhren zurück nach S. Wir waren ganz erschöpft und wir brauchten beide Ruhe, da wir die ganze Nacht nicht geschlafen hatten. Ich spürte Gustavs Energie bei mir und war ganz ruhig. Ich hatte die Kraft, die Kinder von Onkel Ernst anzurufen. Onkel Ernst war schon vor zehn Jahren gestorben. Er war damals 90 Jahre alt.
Lenchen und Max wollten nur eine Beerdigung im kleinsten Kreis, warum auch immer. Für mich, aber auch für Danno war klar, dass es eine angemessene Beerdigung für Gustav geben müsse.
Wir setzten uns dafür ein. Das war sehr anstrengend. Es brachen alte Familiensystemmuster hervor, die Danno und ich als so Kräfte zehrend empfanden, dass wir uns jetzt auf der Kur noch nicht davon erholt haben.
Tante Lotti kam drei Tage vor der Beerdigung und quartierte sich im Seniorenheim bei Maria ein und sorgte für sie. In der Zeit konnte ich mich um die Beerdigung kümmern und Lenchen machte ihren Teil.
Am Tag der Beerdigung war Maria aufgeregt und irgendwie sehr wach und doch auch weit weg. Sie stand unter Schock. 90 Jahre war Gustav an ihrer Seite gewesen, als Kinder mal mehr, mal weniger, aber irgendwann waren die beiden nur noch zusammen, sie waren nie wirklich getrennt.
Gustav wurde noch einmal in der Kirche aufgebart, nur für uns, für Maria, Danno und mich.
Danno und ich hatten Rosen aus unserem Garten mitgebracht, um sie Gustav in den Sarg zu legen. Gustav hatte einen dunklen Anzug an und ein weißes Hemd mit Krawatte. Danno sagte anschließend zu mir: „Gustav hat das Gesicht eines wirklich außergewöhnlichen Weisen. Es ist ein hoch durchgeistigtes Gesicht!“ Ich konnte allerdings schon ein wenig den Verwesungsprozess erkennen, da die Beerdigung eine Woche nach Gustavs Tod stattfand. Ich fühlte sehr deutlich, dass seine Seele sich befreit hatte. Gustav war anwesend, als sehr intensive Kraft.
Jedenfalls kamen viele Leute auf die Beerdigung, Cousinen und Cousins ersten und zweiten Grades. Es war ein Wiedersehen, eine tiefe Verneigung vor Gustav, seinem Leben und Wirken.
Es kamen auch Valentins, die Eltern von Frederik, und er selbst. Er war meine intensive Jugendbeziehung gewesen. Ich wusste zu der Zeit, als ich die Nachricht von Gustavs Tod und seiner Beerdigung versendete, nicht, ob Frederiks Eltern noch leben. Aber sie kamen und auch Frederik, darüber freute ich mich. An Gustavs Grab hat Frederik so sehr geweint, dass ich glaubte, er fiele in das Grab. Ich war tief berührt, denn irgendwie wusste ich, dass auch ich gemeint war, dass das Weinen auch mir galt, denn er hatte mich so sehr geliebt, und ich hatte ihn verlassen.
Es war eine für Gustav würdige Beerdigung, obwohl ich gern noch viel mehr getan hätte, ich hätte gern eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben, sodass viele Menschen, die Gustav und Maria aus früheren Jahren und auch besonders aus der Geschäftszeit kannten, die Möglichkeit gehabt hätten, sich still von Gustav zu verabschieden oder aber zur Beerdigung zu kommen. Aber vielleicht war das gar nicht nötig! Ich weiß das nicht.
Maria hielt tapfer durch, bis spät abends. Die Schockwirkung von Gustavs Tod hielt noch lange an …
Danno und ich überlegen, ob wir Maria zu uns holen sollten, d.h. in ein Seniorenheim in S. Da könnten wir uns besser um sie kümmern, da wir nicht die lange Autofahrt hätten. Ich versuche, zur Ruhe zu kommen, und ich werde jetzt weiter gegen die Zeit anschreiben, mit dem Zeit- und Raumkontinuum, jenseits von Zeit und Raum, dennoch mit qualitativer Zeit und einem besonderen Raumbewusstsein …
Nun geht es weiter mit meiner Kindheitsgeschichte in Mel. Gustav war also schon damals mit mir auf Augenhöhe. Ich durfte, genau wie Lenchen es getan hat, als sie noch jünger war, so drei Jahre alt, Gustavs Haare kämmen, die sehr fein, aber sehr üppig und etwas lockig waren. Das machte mir einen Riesenspaß und Gustav auch, denn ich band ihm Schleifen ins Haar und Maria lachte.
Und einmal hatte Maria mich auf ihren Schoß genommen, sie hatte ein ockergelbes Strickkleid an, das kratzte. Sie hielt mich auf dem Schoß und sang mir ein Lied. Mehr war wohl nicht möglich aufgrund der Starre und des Schocks, die sich besonders in ihrem Gemüt als Antwort auf ihre Schreckenserlebnisse im Krieg und durch die Knochentuberkulose breit gemacht hatten. An mehr Zärtlichkeit kann ich mich nicht erinnern und die hatte auch nicht stattgefunden. Maria konnte ihre Kinder nicht streicheln.
Ich hatte einen Teddy, mit dem ich am liebsten spielte und mit dem ich zärtlich war.
Besonders liebte ich einen alten kaputten Regenschirm. Zu dem sagte ich „Lu-Lu“ und ich baute mir mit diesem Schirm irgendwie eine Höhle und fühlte mich unter ihm geborgen. Ich hatte kleine Hausschuhe mit Entchen aus Stoff darauf, die trug ich besonders gern.
Und einmal, als Lenchen in der Schule war, sie besuchte nun das Gymnasium in einer nahe gelegenen Kleinstadt, nahm ich ihre Puppe, die hatte weiße Zähne und lachte. Ich hatte die Idee, sie müsste die Zähne geputzt bekommen. Ich holte meine Zahnbürste und scheuerte auf den Zähnen der Puppe herum. Das Ergebnis war, dass sie nun fast zahnlos dreinschaute. Ich hatte mit viel Geschick die Zähne abgebrochen. Das tat mir leid. Lenchen war natürlich traurig darüber oder ärgerlich oder beides, was ich auch verstanden hatte. Von da an wusste ich, dass man Puppen nicht die Zähne putzen darf!
Wenn ich also manchmal etwas getan hatte, von dem meine Mutter meinte, dass es nicht recht sei, dann bin ich zu ihr hingelaufen und habe gesagt: „Mutti, hau, aber nicht so doll!“ Das hat Maria oft voller Rührung erzählt.
Ich bin weder geschlagen noch sind mir Schläge angedroht worden. Maria wusste also nicht, warum ich das tat. Ich denke, es wusste in mir damals schon, warum ich das sagte und warum ich hier war, mich hier inkarniert hatte. Es war mir natürlich nicht bewusst. Es war, als ob ich irgendetwas büßen, wieder gut machen müsste, was lange her war, lange vor diesem Leben oder was weiß ich!? - Vielleicht war es der Hang dazu, eine Art Märtyrer zu werden oder sonst etwas? Lenchen ärgerte mich manchmal. Sie brachte mir häufig ihr nicht aufgegessenes Brot mit und tat so, als ob sie mir ein großes Geschenk mitgebracht hätte. „Ich hab was ganz Besonderes für dich“, sagte sie mit leuchtenden Augen zu mir. Und ich freute mich reinen Herzens und fragte: „Was denn?“ –„Hasenbrot“, antwortete sie. „Das ist was ganz Feines!“ Dann gab sie mir ihre alten Butterbrote, und ich war irgendwie enttäuscht, aß das Brot dennoch vollständig auf, im Glauben, dass das etwas Besonderes sei!
Abends hielt sie mir manchmal statt ihrer Hand zum Einschlafen, unsere Betten standen über Kopf dicht beieinander, ihren Fuß hin, und lachte dann, und ich lachte auch.
Und einmal saß ich mit der kleinen Bärbel, die in der Nachbarschaft in der Baracke wohnte, unter dem Küchentisch in unserer Küche und sie hatte ihr Höschen ausgezogen. Es war Herbst und im Halbdunkel schauten wir uns alles an. Da kam Maria herein und machte Licht an und wir schämten uns, ich weiß gar nicht wirklich, warum. Maria hatte nichts dazu gesagt, aber auch nichts erklärt.
Nur einmal hatte sie zu mir gesagt, dass man sich nicht unbedeckt zeigt, ich solle mich nur „Mutti und dem Arzt gegenüber“ nackt zeigen. Seitdem war ich der Überzeugung, dass körperliche Nacktheit möglichst vermieden werden müsste. Erst als ich sie in den 70er-Jahren, während meiner wilden Studentenzeit, fragte, warum sie das in jener Zeit meiner Kindheit zu mir gesagt hatte, da antwortete sie mir: „Ich wollte nicht, dass du falsch angefasst wurdest, dass jemand auf die Idee hätte kommen können, dich zu missbrauchen, dich falsch zu berühren! Das kam in unserem Dorf häufig vor, im Krieg und auch sonst in der Welt.“
Diese Antwort war eine mehr als hinreichende Erklärung für mich, und mir wurde klar, dass Maria sich viel dabei gedacht hatte, und ich war nicht nur einsichtig, sondern ich konnte Ihre Handlungsmaxime sogar verstehen.
Wir hatten viele Hühner, die frei herumliefen und eines Tages eingezäunt werden mussten, da ein jähzorniger Hahn auf diese aufpasste und jeden Menschen, der in seine Nähe kam, anfiel, also auch mich. Nun gab es einen Maschendrahtzaun, und ich hatte mir dort eine Kuhle gemacht und mich da hineingesetzt, von außen. Auch da kam der Hahn gelaufen und hackte in meinen dicken Mantel, aber es war nichts passiert.
Als Gustav eines Tages die Hühner füttern wollte, da flog der Hahn auf seinen Rücken, als er sich gebückt hatte, und hackte auf ihn ein. Darauf wurde dieser Hahn geschlachtet.
Mit dem Tod war ich das erste Mal konfrontiert, als sich eines Tages eine junge Dohle in unser Haus verirrte. Wir fütterten sie, und ich war glücklich darüber, dass sie nun in unserem Haus wohnte. Eines Morgens war sie jedoch in eine Zinkwanne mit Wasser gefallen und war ertrunken. Sie war tot. Ich konnte das nicht verstehen. Ich hatte mich so darüber gefreut, dass sie nun zu uns gehörte und wir uns um sie kümmern konnten. Jetzt war sie nicht mehr da.
Ich sah heimlich zu, wie und wo Maria die Dohle im Garten vergrub. Und als ich am selben Nachmittag mit der kleinen Bärbel bei uns im Garten spielte, fiel mir ein, dass ich mit dieser Dohle spielen wollte. Ich ging an die Stelle, an der Maria sie vergraben hatte und grub sie wieder aus. Ich stellte die Dohle an die Wand des Stalles, zog ihr die Augenlider wieder auseinander und wollte sie wieder lebendig haben. Ich dachte, so wäre das möglich. Dann kam Gustav und sagte mir in klaren Worten, dass die Dohle wieder begraben werden müsse, sie sei tot und mit toten Tieren könne man nicht spielen.
Ich akzeptierte das, es war mir aber irgendwie schwer ums Herz.
Und einmal musste Maria in die Stadt fahren, und Lenchen war in der Schule. Sie brachte mich zu den alten Nachbarn, die gegenüber in einem kleinen Häuschen wohnten. Es war ein altes Ehepaar mit weißen Haaren.
Damit ich nicht hinauslaufen konnte, schlossen sie die Haustür ab. Und sie hatten Süßigkeiten für mich, die irgendwie alt schmeckten. Als ich mich an einem Bonbon verschluckt hatte, bekam ich Weißbrot zu essen und mir wurde auf den Rücken geklopft. Ich fühlte mich heimatlos! Wo waren meine Eltern?! Maria holte mich zwar später wieder ab, trotzdem war es für mich ein schwieriger Tag gewesen.
Und zu Ostern bekamen wir Besuch von Tante Frieda, Onkel Hans und ihren beiden Söhnen Martin und Wilfried. Wilfried war so alt wie ich, d. h. er war drei Monate älter, und als er gewaschen wurde, sah ich, dass es bei ihm anders aussah als bei mir –und ich schaute abends bei mir nach und hoffte und dachte, dass bei mir auch noch etwas wächst, weil ich wusste, dass ich jünger war. Vielleicht ist ja doch etwas an Freuds Penisneid dran, aber ich war nicht neidisch, nur unwissend.
Jedenfalls war das lustig zu Ostern, wir Kinder suchten Eier im Garten. Auf dem Rasen konnte ich die roten Eier nicht sehen, warum auch immer, aber alle lachten. Und für einen Tag fuhren wir nach Holland. Dort gab es die Tulpenblüte. Damals sah ich den ersten „Neger“ in meinem Leben, das war der damalige Sprachgebrauch.
Einmal ging Maria mit mir in den Zirkus, mitten in der Woche, nur sie und ich. Da gab es zwei Clowns, die fand ich so bunt und irgendwie lustig. Als aber einer den anderen neckte und ärgerte und Maria lachte, da habe ich ihr Lachen nicht verstanden und habe sie in die Seite geboxt, da ich es für ungerecht hielt, dass einer den anderen ärgert und die Leute lachten, auch Maria!
Und als der eine Clown noch von einem Pferd geschupst wurde, da war ich richtig unglücklich. Ich wollte nicht, dass man lacht, wenn einer leidet. Ja, so habe ich damals empfunden, und irgendwie hat sich meine Einstellung diesbezüglich nicht verändert.
Und dann waren Maria, Gustav und ich auf einer Kirmes, und ich bekam ein kleines Pfefferkuchenherz und ein Eis von Gustav.
Maria setzte mich in ein Kinderkarussell, und als sich das drehte und so viele Menschen darum herumstanden, versuchte ich die ganze Zeit immer nur, Maria in der Menge zu entdecken, und ich war froh, als die Karussellrunden vorbei waren.
Inzwischen hatten sich Gustav und Maria ein Auto gekauft, einen VW-Käfer. Wir fuhren dann sonntags zusammen über Land und besuchten Freunde von Gustav und Maria. Ich saß hinten und sah die Ölpumpen und Felder und Wiesen und sagte zu braunen Kühen „verrostete Kühe!“ Und wenn Gustav abbiegen musste, dann kam ein Winker heraus, im 90 Grad-Winkel zum Auto. Für mich war das ein kleiner Arm.
Diese Ausfahrten fand ich immer irgendwie spannend.
Und wenn Onkel Fred und Onkel Andre zu Besuch waren, dann wollten sie
immer mit mir „Einen trinken gehen“ und fuhren mit mir zur nächsten Stadt, und ich bekam eine Orangenlimonade, das gefiel mir sehr gut. Ich gehe bis zum heutigen Tag gern „Einen trinken“, das bedeutet ich gehe gern essen und trinken.
Jedenfalls sollte ich damals in einen Kindergarten in Mel. Lenchen brachte mich dort hin. Sie übernahm viele Tätigkeiten im Haushalt und passte auf mich auf, so wie Maria das als junges Mädchen getan hatte: Sie hatte ja auf dem Bauernhof gearbeitet und ihre Geschwister hüten müssen.
Jedenfalls hat Lenchen mich in den Kindergarten gebracht und ich sollte dort einmal „zur Probe“ sein. Da gab es eine Rutsche, und ich sollte dort herunterrutschen, und dort waren Kinder, die älter waren als ich und die tobten, und ich war sehr unglücklich dort, ich wollte zu Maria. Aber ich blieb dort – irgendwie. Zum Frühstück durfte man nichts trinken. Erst dann, wenn alles aufgegessen war, durfte man eine kleine Tüte Milch trinken. Ich war nicht gern dort, fühlte mich fremd und im Stich gelassen.
Wir fuhren auch nach Düsseldorf, dort wohnten jetzt Marias Eltern, die sind mit Onkel Andre dorthin gezogen. Onkel Fred und Tante Lotti waren auch dort. Meine Großeltern wohnten dort in einem Hochhausviertel Parterre. Gustav und Maria wollten sich verändern, sie wollten in die USA auswandern, weil dort bereits viele Verwandte hingegangen waren, auch nach Kanada. Die Ausreisepapiere hatten sie schon fast vollständig. Aber dann wollten sie nach Düsseldorf, weil sie dachten, dort könnten sie sich eher eine Existenz aufbauen. Dort lernten Gustav und Maria ein Ehepaar kennen, das teure Kinderkleidung verkaufte und Modenschauen inszenierte. Die wollten unbedingt, dass ich dort mitmachte, ein Kindermodel sein sollte, weil ich so auffallend hübsch war. Daraus wurde nichts, da Maria und Gustav sich gegen Düsseldorf entschieden und wir so vorerst noch in Mel. blieben.
Bei meinen Großeltern gab es immer Hühnerbrühe und Hühnerfleisch mit Kartoffeln und Gemüse, wenn wir dorthin kamen. Und irgendwie waren mir meine Großeltern schon vertraut.
Als ich damals in Düsseldorf mit Tante Lotti und Onkel Fred spazieren ging, da kam ein kleiner Junge auf mich zu, strahlte mich an und wollte nicht mehr von meiner Seite weichen. Davon gibt es noch ein Foto. Ereignisse dieser Art begleiten mein Leben, es gibt bis zum heutigen Tag immer irgendwelche männlichen Wesen, die nicht von meiner Seite weichen möchten – neben meinem Ehemann Danno.
Jedenfalls wollten Gustav und Maria sich verändern, sie wollten nicht an der holländischen Grenze bleiben, sie hatten dort zwar Freunde gefunden und ein eigenes Haus mit Grundstück, aber die Gegend war ihnen fremd und sie hatten keine wirkliche Existenz im Sinne von Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Vielleicht wäre es besser gewesen, dort zu bleiben, im eigenen Haus, mit eigenem Garten und Lenchen hätte dort weiterhin zum Gymnasium in der kleinen Stadt gehen und dort ihr Abitur machen können. Auch ich wäre dann dort zur Schule gegangen und wir hätten ganz ruhig und bescheiden an diesem Platz gelebt.
Aber so ist es nicht gewesen, Gustav und Maria wollten sich verändern, wollten sich irgendwie ein Geschäft aufbauen und hatten ein Angebot von Tante Frieda und Onkel Hans. So verkauften sie eines Tages das Haus mit Garten und zogen nach Ho., eine Kleinstadt im Norden Deutschlands.
Lenchen und ich kamen natürlich mit. Lenchen musste ihre Freundinnen aufgeben und das Gymnasium verlassen.
Wir wohnten in einer großen Wohnung bei Onkel Hans und Tante Frieda. Wir schliefen zu viert in einem Zimmer. Ja, so war das. Ich fühlte damals wie eigentlich von Anfang an in meinem Leben, als ob ich in einer „Dauer-Hab-Acht-Stellung“ sei: Wenn man irgendwo ankommt, dann muss man auch wieder weg.
Also eigentlich waren wir gerade erst in Mel. angekommen, hatten uns irgendwie eingelebt, aber dann mussten wir wieder weg von dort, weil Gustav und Maria es so entschieden hatten. Oder es war vielleicht auch gar keine Entscheidung, da sie vielleicht auf unbewusste Weise ihre Flucht im Sinne eines freiwilligen Weggehens, das sich mehrmals wiederholen sollte, verarbeiteten.
Irgendwie waren Gustav und Maria nicht zur Ruhe gekommen, sie fühlten sich nicht angekommen, obwohl wir jetzt eine vollständige Familie waren. Einerseits waren sie glücklich darüber, aber andererseits wollten sie beruflich etwas anderes machen. Gustav hatte zwar bei der Ölfirma Wintershall eine „saubere“ Arbeit, er war kein Ölarbeiter mehr gewesen, da ihn seine Vorgesetzten zu sich gebeten und zu ihm gesagt hatten: „Sie sind doch kein Arbeiter! Sie können doch etwas ganz anderes. Sie werden jetzt im Büro arbeiten und bekommen auch ein höheres Gehalt!“ Gustav war von ungefähr einhundert Mitarbeitern der Einzige, dem so etwas widerfahren war. Er war dankbar dafür gewesen, denn durch seine Arbeit auf dem Ölfeld war er immer mit Öl verschmutzt gewesen, und er konnte es nur sehr schwer durch gründliches Waschen abbekommen. Ja, er war sehr dankbar für die neue Arbeitsaufgabe gewesen, aber dennoch war es nicht das Richtige für ihn. Er wollte selbständig arbeiten, kein Lohnempfänger sein, das war ihm klar und Maria wollte das auch.
Die Wohnung von Tante Frieda und Onkel Hans in Ho. war groß, sie hatte sieben Zimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine große Küche, ein Kinderzimmer, zwei Schlafzimmer und ein Zimmer, das an eine alte Dame, Fräulein Scharlach, vermietet war, sie hatte einen Wellensittich.
Tante Frieda und Onkel Hans ging es für die damaligen Verhältnisse nach dem Krieg verhältnismäßig gut. Sie hatten einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ein Radio, einen Plattenspieler und Schallplatten. Wir, Maria, Gustav, Lenchen und ich konnten die ganze Wohnung mitbenutzen. Wir aßen mit acht Leuten zusammen im Esszimmer oder im Alltag in der großen Küche. Martin und Wilfried hatten viele Spielsachen, Legosteine und eine Eisenbahn. Das erste Weihnachten in Ho. war sehr ungewohnt. Es gab keinen Weihnachtsmann, mein Cousin Wilfried erzählte mir, dass es gar keinen gibt. Ich hatte mir eine Puppe und ein Himmelbett gewünscht. Ich bekam eine Puppe und ein Himmelbett in einer Miniaturausgabe, da wir natürlich keinen Platz für eine größere Ausgabe gehabt hätten.
Maria besuchte Schreibmaschinen- und Buchhaltungskurse an der Volkshochschule, und Gustav kaufte sich einen kleinen Bus von der Marke Ford, der vorn einen Reifen auf der Kühlerhaube hatte. Der hatte in drei Reihen Sitze, die am Sonntagabend herausgenommen wurden, da der Bus mit Teppichen beladen wurde.
Gustav und Maria hatten entschieden, sich mit Textilien selbständig zu machen. Also hatten sie ihr Geld, das sie für das Haus bekommen hatten, in die Ware investiert. Gustav fuhr in der Woche über Land, in die Städte Schleswig-Holsteins und machte Verkaufsausstellungen in Hotels. Das war damals möglich und üblich, da die Bevölkerung in Deutschland alles neu aufgebaut hatte und der Bedarf, sich einzurichten, sehr groß war.
Am Wochenende, wenn Gustav wieder da war, wurde das Auto wieder ausgeräumt. Die Textilwaren kamen in den Keller und die Sitze wurden eingebaut und wir machten dann zu acht kleine Ausflüge. Im Sommer, wenn schönes Wetter war, fuhren wir immer an die Ostsee nach E.
Da wurden am Abend vorher Frikadellen gebraten, Kartoffelsalat zubereitet und Brote geschmiert, und es gab für uns Kinder gelbe Limonade. Das war immer schön. Gustav fuhr und Onkel Hans saß neben ihm. Hinter den beiden saßen Maria und Tante Frieda, in der dritten Reihe saßen Lenchen und Martin, und Wilfried und ich saßen bzw. lagen dann hinten, wo das Gepäck verstaut war.
Als wir am Strand in E. ankamen, wurde alles ausgepackt. Und wir hatten zwei große Decken, auf denen wir uns ausbreiten konnten, eine für die Erwachsenen und eine für die Kinder. Es gab zu essen und zu trinken und es schmeckte alles fantastisch.
Dann badeten wir Kinder in der Ostsee.
Ich hatte einen Schwimmring aus Plastik und eine Badekappe. Ich war immer gern im Wasser, mochte allerdings nicht gern, wenn mein Kopf unter Wasser war. Das ist bis zum heutigen Tage so. Einmal forderte Onkel Hans Gustav zu einem Wettlauf heraus, bei dem er sich seinen Fuß verstauchte. Nach einem langen Badetag fuhren wir zurück, und wir waren abends alle müde.
Wilfried und ich gingen zusammen in einen evangelischen Kindergarten, der ungefähr 150 Meter von der Wohnung entfernt in dem Gemeindehaus war, das auf der gleichen Straßenseite lag. Viele Stufen führten links und rechts zum Eingang. Wir hatten beide kleine Lederumhängetaschen und gingen morgens dorthin, manchmal Hand in Hand.
Tante Lieselotte war unsere Kindergärtnerin, eine junge Frau mit dunklen, lockigen Haaren, die sehr nett sein konnte. Hier gefiel es mir. Wilfried und ich verstanden uns gut.
Leider ist er vor eineinhalb Jahren gestorben, und sein Bruder Martin, dessen Frau und seine Eltern haben schon lange vor ihm diese Welt verlassen.
Wir sangen den Jahreszeiten entsprechende Lieder wie „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt …“ oder „Bunt sind schon die Wälder … oder „Schneeflöckchen Weißröckchen … und zu Weihnachten viele Weihnachtslieder. Das mochte ich gern. Wir konnten mit Knetgummi Gegenstände herstellen. Ich knetete ein kleines Puppengeschirr: Teller und Tassen … Dabei hatte ich viel Spaß. Wir bastelten auch kleine Kästchen aus Papier. Dann machten wir häufig Kreisspiele, dabei wurde gesungen und im Kreis gegangen, das fand ich am schönsten. Und dann frühstückten wir irgendwann am Vormittag alle gemeinsam und aßen unser mitgebrachtes Brot und bekamen kleine Milchtüten, aus denen wir zum Essen trinken durften.
Und dann hatten wir, als wir schon fast fünf Jahre alt waren, abwechselnd Tischdienst und mussten den Tisch abwischen.
Tante Lieselotte holte mich manchmal zwischendurch in ihr Zimmer, das sie im Gemeindehaus bewohnte. Sie war unverheiratet und war mir irgendwie zugetan. Da ich mittlerweile lange dicke Haare hatte, die zu einem Pferdschwanz gebunden waren, kämmte sie mir dann die Haare. So genau wusste ich damals gar nicht, was das bedeutete, aber sie machte das.
Und dann gab es kleine Theateraufführungen, im Frühjahr und zu Weihnachten, und ich spielte immer die Hauptrolle. Ich war eine Schlüsselblume und war hübsch gelb angezogen.
Und zu Weihnachten spielte ich „Die arme Marie“ und musste einen alten Rock tragen und war etwas traurig, weil andere einen Engel darstellen durften, mit weißen Gewändern und goldenen Flügeln. Wilfried war ein Schneeflöckchen und sah lustig aus, ganz in weiß mit einem weißen Hütchen und einem weißen Bommel. Und da war da noch der Sohn des Pastors, der war sehr angetan von mir, und er war im Theaterstück mein Auserwählter. Wir mussten auch beide zusammen singen und tanzen. Das war wirklich schön. Und die Mütter schauten alle zu, auch Maria und Tante Frieda und Lenchen. Sie waren begeistert.
Und als ich am 6. Januar Geburtstag hatte und wir nur mit der Familie feierten, da klingelte es an der Tür. Günther, der Pastorensohn, stand mit einem Geschenk vor mir. Ich hatte ihn gar nicht eingeladen, aber er wollte zu mir. Er hatte mir ein Glockenspiel geschenkt und ich freute mich darüber. Seit dem wollte er immer mein Freund sein.
Und einmal im Kindergarten war ich sehr übermütig. Ein etwas jüngerer Junge saß neben mir beim Frühstück und neckte mich. Ich fand das lustig und ich wollte ihm mit einer leeren Milchtüte auf den Kopf pusten. Da sich darin aber noch Restbestände von Milch befanden, tropfte ihm etwas weiße Flüssigkeit auf den Kopf. Das hatte ich gar nicht gewollt, das tat mir leid. Aber danach wurde ich von Tante Lieselotte nicht gefragt. Sie bestrafte mich damit, dass ich in der Ecke stehen musste und mich schämen sollte, und gleichzeitig durften die anderen Kinder alle bei dem für mich so beliebten Kreisspiel mitmachen. Das war das Allerschlimmste für mich, dass ich davon ausgeschlossen worden war.
Ein Kind wurde damals noch zur Scham erzogen, und zwar zur Scham im Sinne des Sich-schuldig- Fühlens. Heute müssen die Menschen, die damals so erzogen wurden, von den Schuld- und Schamgefühlen mit einem großen Aufwand, nämlich mit vielseitigen Methoden der Psychologie, befreit werden, um sich gesund zu fühlen.
Dennoch bin ich immer gern in den Kindergarten gegangen. Nachmittags spielten Wilfried und ich manchmal mit Lenchen und Martin, aber meistens wurden wir von den Älteren geärgert.
So gab Lenchen uns einen Groschen, das war damals viel für ein Kind, und sie und Martin schickten uns in ein kleines Süßwarengeschäft direkt gegenüber von unserer Wohnung. Wir sollten sagen: „Wir möchten für 10 Pfennig `Haumichblau`!“ Gutgläubig wie wir beide waren, haben wir das getan und haben das gar nicht verstanden. Die ältere Dame in dem Laden hatte das auch nicht verstanden und gab jedem von uns zwei Himbeerbonbons. Martin und Lenchen standen vor dem Schaufenster und lachten.
Manchmal spielten wir mit anderen Kindern, die auch in unserem Haus wohnten.
Da nun das Haus direkt an einem kleinen Fluss lag, sah ich eines Tages, wie Erwachsene winzig kleine Katzen in ein Tuch legten, dieses oben zubanden und dann einen Stein daran hängten und den Sack ins Wasser warfen. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe auch niemanden gefragt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man Kätzchen ertränkt.
Abends betete ich mit Lenchen und Maria oder nur mit einer von beiden „Ich bin klein, mein Herz ist rein, lass niemand drin wohnen, als Jesus allein!“ Und wir sangen Lieder wie: „Müde bin ich, geh zur Ruh´, schließe beide Äuglein zu, Vater lass die Augen dein, über meinem Bettchen sein!“ oder „Breit aus die Flügel beide, oh Jesu, meine Freude und nimm dein Küchlein ein …!“
Und einmal haben Wilfried und ich gewetteifert, wessen Vater wohl die meisten Verwundungen aus dem Krieg mitgebracht hätte. Wilfrieds Vater hatte immerhin einen zerschossenen Finger und Gustav hatte gar nichts. In dem Moment hatte ich mich darüber geärgert, dass mein Vater unversehrt geblieben war und Wilfried aus diesem Wettkampf als „Sieger“ hervorging. Das war auch eine Art „Kriegsbewältigung“, wenn auch eine makabere.
Wenn man in jener Zeit tagsüber durch die Straßen ging, dann sah man sehr häufig Männer an Krücken mit nur einem Bein oder eineinhalb Beinen, das leere Hosenbein umgeschlagen. Das fand ich traurig und wusste, dass das Leid bedeutete und mit dem Krieg zusammenhing.
Und wenn ich einen Polizisten sah, wenn ich zum Beispiel aus dem Kindergarten kam, dann machte ich einen großen Bogen um den, weil ich dachte, dass Polizisten jeden einsperren. Als ich einmal einen Polizisten mit einer Frau sprechen sah, tat sie mir leid, weil ich dachte, dass sie gleich eingesperrt würde.
Das war ja nun damals noch nicht lange her gewesen, dass es in Deutschland üblich gewesen war, dass Menschen willkürlich verhaftet wurden und keiner wusste warum. Und in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Menschen auch einfach festgenommen, weil sie gegen Ungerechtigkeit demonstrierten oder gegen Atomkraftwerke …
Nicht nur für uns Kinder war es wunderbar, dass Tante Frieda und Onkel Hans einen Fernseher hatten. Den hatte damals nicht jeder. Es gab nur ein Programm, alles war schwarz-weiß, nicht nur optisch. Vieles wirkte eindimensional und engstirnig. Was über die kleine eigene Welt hinausging, das wurde nicht erwähnt. Über Lyriker wie zum Beispiel Paul Celan, der als einziger deutschsprachiger Schriftsteller vermochte, den Holocaust und die Todeslager in eine authentische poetisch berührende Form zu bringen und eine Poetik einer Holocaust-Lyrik zu schaffen, erfuhr man damals im Fernsehen nichts. Er hat in seinen Gedichten auf so gefühlvolle und authentische Weise der Ungeheuerlichkeit und dem Irrsinn des zweiten Weltkrieges mit seinen Gräueltaten der Nazis in den Konzentrationslagern Ausdruck verliehen, dass viele Menschen von diesen Gedichten berührt und auch viele abgeschreckt waren. Vor dem Hintergrund von Thoedor W. Adornos Aussage „nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ wurde besonders Paul Celans Gedicht „Todesfuge“ kontrovers diskutiert. Paul Celan wurde während seiner Dichterlesung in Schleswig-Holstein von der „Gruppe 47“ ausgelacht, die seit 1947 und gerade auch in den 1950er-Jahren eine Plattform zur Erneuerung der deutschen Literatur nach dem zweiten Weltkrieg darstellen wollte. Von den Mitgliedern dieser Literaturgruppe wurde er in seiner Hochsensibilität, Betroffenheit, Authentizität und Kompetenz als Holocaust-Lyriker offensichtlich verkannt. Darüber erfuhr man in jener Zeit im Fernsehen nichts, erst 60 Jahre später.
Für uns Kinder war das Fernsehen damals natürlich eine Sensation und wir sahen das Kinderprogramm wie z. B. „10 Minuten mit Adelbert Dickhut!“ Das war eine Sendung mit einem Turnlehrer und dessen beiden Söhnen, die turnten mit halblangen, sehr weiten Turnhosen etwas vor, und danach gab es eine Sendung „Zwei aus einer Klasse“ – hier wurden zwei Schüler befragt, und wer die Fragen schneller beantworten konnte, bekam eine Tafel Schokolade, was damals etwas ganz Kostbares war. Aus heutiger Sicht war das damals alles etwas tumpig, aber das erkannten wir Kinder natürlich nicht.
Manchmal sahen wir Kinder auch Programme für Erwachsene, das war für die Eltern ganz praktisch, da wir dann ruhig waren.
Und manchmal gab es am Samstagnachmittag die Sendung „Luis Trenker erzählt“: Der österreichische Bergsteiger berichtete auf sehr langweilige Art und Weise von seinen Bergbesteigungen. Und danach gab es meistens einen Spielfilm. Und einmal sahen wir den Kinderfilm „Der kleine Muck“. Dieser Film hat mich bis zum heutigen Tag sehr beeindruckt. Abends um halb acht gab es ein Werbeprogramm, das „Seepferdchen“ hieß. Das war sehr lustig. Und samstagabends um halb acht gab es dann „Die aktuelle Schaubude“, das war eine Life-Sendung aus Hamburg, in einem gläsernen Studio, in dem prominente Leute interviewt wurden und Sänger und Musiker auftraten. Um Volksnähe zu zeigen, standen Menschen auf der Straße und konnten in das gläserne Studio hineinsehen. Da das Fernsehen damals noch eine Sensation war, winkten sie mit platt gedrückten Nasen in ihren langen großen Mänteln und mit ihren weitkrempigen Hüten der Kamera zu. Nach dieser Samstagssendung gab es immer Kartoffelsalat mit Würstchen und Orangenlimonade, „gelbe Brause“ genannt, das mochten wir Kinder gern. Und um 20 Uhr gab es die „Tagesschau“ – wie heute auch.
In dieser Zeit lief auch die sechsteilige Serie „So weit die Füße tragen“. Wohl jeder, der in der damaligen Bundesrepublik einen Fernseher hatte, hat sich diesen Film angesehen. Wir Kinder durften mit dabei sein. Die Erwachsenen hatten sich gar nichts dabei gedacht, ob es wohl für Kinder geeignet war oder nicht.
Jedenfalls handelte der Film von einem deutschen Kriegsgefangenen mit Namen Forel (der Name des Schauspielers ist Heinz Weiß, der vor einigen Jahren gestorben ist), der sich in russischer Gefangenschaft befand. Die furchtbaren Lebens- bzw. Überlebensbedingungen dort brachten ihn dazu zu fliehen. Leider wurde er erwischt, und da seine Mitgefangenen wegen seiner Flucht nichts zu Essen bekommen hatten und sowieso fast am Verhungern waren, schlugen sie ihn mit Stöcken. Das fand ich furchtbar. Und dann floh Forel mit der Unterstützung eines alten deutschen Arztes, der selbst vorgehabt hatte, zu fliehen, das aber unterließ, da er Krebs hatte, ein zweites Mal. Damals lernte ich, dass Krebs eine tödliche Krankheit ist, was sich heute so allerdings nicht mehr unterschreiben lässt.
Auf der zweiten Flucht begegneten ihm unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Gefahren, das ließ alle Zuschauer den Atem anhalten. Und dann in der sechsten Folge schließlich kam Forel völlig erschöpft nach zweijähriger Flucht mehr oder weniger zu Fuß in Deutschland an. Heute gibt es Remakes dazu, die dem Original nicht annähernd nahekommen. Dieser Film beschäftigte mich sehr lange, aber letztlich auch die Erwachsenen damals.
Jedenfalls war die Angst vor Krieg und Schrecken noch lange nicht vorbei. Die größte Angst war die, dass „die Russen kommen“ könnten!“ Die Kriegserlebnisse waren geistig-seelisch nicht verarbeitet worden, und so wurde eine Angst aufgebaut, die trotz oder gerade wegen der Ablenkung und Verdrängung immer irgendwie präsent war, und gleichzeitig wuchs ein Feindbild in den Köpfen der Menschen: „die bösen Russen“.
Lenchen ging zum Gymnasium und hatte viele Freundinnen. Ihre beste Freundin hieß Petty, und die wohnte mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern direkt an dem kleinen Flüsschen in einem winzig kleinen Arbeiterhaus. Die Mutter war immer Zuhause. Und da gab es noch einen Bruder, Beppo genannt, den Lenchen gern mochte und umgekehrt. Manchmal ruderten Lenchen, Petty und ihr Bruder auf dem kleinen Flüsschen, obwohl es wegen unberechenbarer Strömungen verboten war. Maria und Gustav hatten es Lenchen verboten. Sie wird sich allerdings nicht davon abgehalten lassen haben.
Im Sommer fuhren wir häufiger zu Onkel Ernst und Tante Magda und der kleinen Oma. Dafür wurden dann wieder die Teppiche aus dem Bus herausgenommen. Die Taschen mit Butterbroten und Frikadellen und Getränken waren gepackt, und wir fuhren dann die Bundesstraße in Richtung Nes., das hinter Braunschweig am Elm, einem bewaldeten Mittelgebirgszug, liegt.
Wilfried und ich als die Jüngsten saßen ganz hinten und konnten die hinter uns fahrenden Autos und Autofahrer sehen und ihnen zuwinken. Wir freuten uns auf die kleine Oma und auf Onkel Ernst, Tante Magda und unsere beiden Cousinen und unsere beiden Cousins.
Unterwegs machten wir eine Essenspause und fuhren dann gemütlich weiter. Wir kamen Freitagabend in Nes. an. Dort wurden wir herzlich empfangen und bewirtet. Onkel Ernst und Tante Magda wohnten in einem kleinen Haus inmitten einer großen Kirschplantage, wo wir im Sommer immer Kirschen pflückten. Sie hatten einige Kühe im Stall, einen Hofhund, der Rolf hieß, Enten, Hühner und Katzen.
Ich fand es wunderbar dort und fühlte mich wohl. Alle, meine Cousins, meine Cousinen, Tante Magda und Onkel Ernst und die kleine Oma kamen heraus und begrüßten uns. Dann setzten sich die Männer in das kleine Wohnzimmer, in dem immer so viel Raum war für Gespräche und Austausch. Die Frauen waren in der Küche. Ich lief immer hin und her und genoss beide Welten.
Im Wohnzimmer wurde über Politik gesprochen, es wurden Bier und Schnaps serviert. Onkel Ernst sprach damals bereits über die Kirlian-Fotografie, die von dem russischen Elektronikingenieur Semjon Kirlian und dessen Frau Walentina 1939 entwickelt worden war. Das war damals neu, unglaublich und Bahn brechend. Darüber wurde in alltäglichen Zeitungen, im Radio oder im Fernsehen nicht berichtet. Kirlian hatte eine spezielle Kamera entwickelt, die die Energie, die durch den menschlichen Körper, aber auch durch Gegenstände, Tiere und Pflanzen ausgestrahlt wird, messen d. h. sichtbar machen kann. Die Aura eines Menschen konnte also fotografiert, d. h. tatsächlich sichtbar werden. Onkel Ernst, der auch sehr gern in Öl malte und alte Meister interpretierte, erklärte damit die Heiligenscheine, die typisch für die religiöse Malerei seien und dass die Aura zu jedem Menschen gehöre und aus Lichtpartikeln bestünde. Damals galt diese neue Methode als osteuropäische wissenschaftliche Forschung paranormaler Phänomene, d. h. es wurde im Westen zunächst als „Humbug“ abgetan.
Heute sind die Erkenntnisse der Quantenphysik immer weiter verbreitet und beweisen, dass alles Energie ist und dass es keine Trennung von Geist und Materie gibt. So war das damals noch nicht. Die Menschen wussten etwas von Atomphysik, von kleinsten Teilchen, die dann in der Explosion einer Atombombe sichtbar würden. Ja, Onkel Ernst war der Philosoph in der Familie und sprach damals bereits über Auramessung und Homöopathie, was damals nicht üblich war, da gerade der Fortschritt der Schulmedizin die Modernität jener Zeit bewies. Mithilfe der Kilian-Fotografie kann man heutzutage z. B. Krankheitsdiagnosen sowohl physischer als auch psychischer Natur erstellen, und mit homöopathischen Mitteln kann man z. B. Umweltgifte aus dem Körper ausleiten. Ja, es war damals spannend zuzuhören und die erhitzten Gemüter bei diesen Gesprächsthemen zu beobachten. Es war sensationell und dem damaligen Zeitgeist weit voraus.
In der Küche sprachen Tante Magda, Tante Frieda und Maria über ihr Befinden, über ihre Kinder und bereiteten das Essen zu. Meine Cousinen Nora und Ilse halfen, sie waren schon erwachsen. Wir Kinder, Lenchen, Martin, Wilfried und ich, spielten draußen, obwohl Lenchen auch schon meistens bei den Erwachsenen war.
Mein Cousin Bastian war noch ein Teenager, mochte Lenchen gern und sah wie ein Cowboy aus. Er hatte schwarzes dichtes Haar und große blaue Augen. Er war der Liebling aller, da er eine besonders herzliche Ausstrahlung hatte.
Sein älterer Bruder Emil saß bei Onkel Ernst, Onkel Hans und Gustav. Emil hatte bereits eine Verlobte, Felicitas, und meine Cousine Nora hatte einen Verlobten, der Bernhard hieß.
Jedenfalls war das Haus voll von wunderbaren Menschen. Ich spielte draußen und war im Kuhstall bei den Kühen. Ich sah zu, wie Tante Magda noch vor dem Abendessen herauskam und die Kühe molk. Ich liebte das und besonders die Tiere selbst. Ich wollte damals gern Bäuerin werden, als ich jedoch erfuhr, dass man dann Kühe zum Schlachten bringen muss, wollte ich das nicht mehr.
Dass der Hofhund Rolf, der ein Mischling von mittlerer Größe war, an einer langen Kette lag, gefiel mir nicht. Ich durfte ihn dann auch losmachen und mit ihm spielen. Und als ich dann eine kleine Wunde auf dem Kopf von Rolf entdeckte, wurde ich sehr traurig und fühlte mich, als wäre ich selbst verwundet.
Martin, Wilfried und Lenchen durften in einem Zelt auf dem Rasen vor dem Haus schlafen. Das fanden sie natürlich toll, aber ich sollte im Haus schlafen, mit Ilse und Nora in einem Zimmer, weil es dort am Wald Wildschweine gab und das zu gefährlich und ich zu klein sei! Ich war ein wenig traurig und enttäuscht, aber die Tiere auf der Plantage von Onkel Ernst glichen das aus und ich war dennoch sehr glücklich.
Wir aßen alle zusammen an einem langen Tisch und es wurde gefeiert. Was wurde gefeiert? Das Leben!
Ich empfand es als schön, dass die Erwachsenen sich so gut verstanden und wohlfühlten. Ich schlief immer wunderbar und morgens krähte der Hahn. Dann gab es eine lange Frühstückstafel, und wir Kinder durften frühzeitig aufstehen und draußen herumtoben. Die Erwachsenen gingen dann zum Kirschenpflücken mit großen Eimern zu den Kirschbäumen. Ich durfte auch ein bisschen dabei helfen, spielte dann aber lieber mit den Katzen und war im Kuhstall. Ich liebte es, den Kühen meine langen Ärmel von meinem Pullover zum Lutschen zu geben.
Ein Kälbchen stand auf dem Rasen und die kleine Oma hatte Lupinen ausgesät. Da nun das Kälbchen in der Nähe dieser Blumen stand und vor sich hingraste und auch die Lupinen ins Visier nahm, sagte die kleine Oma mit ihrem ostpreußischen Dialekt: „Oh, Kuhchen wird Blumchen abfressen!“ Wir mussten alle lachen.
Dann gab es ein wunderschönes Mittagessen, das die Frauen in der kleinen Küche zubereitet hatten, in der so viel Platz für Gespräche und Austausch der Frauen möglich war…Nachmittags gab es selbst gebackenen Kuchen mit Schlagsahne und Kaffee, und für uns Kinder gab es Milch. So ging es zweieinhalb Tage zu, und es war wie ein Paradies für mich, für uns alle.
Am Sonntag gegen Abend fuhren wir dann wieder nach Hause, nachdem wir uns alle mit großer Herzlichkeit verabschiedet hatten.
Wir waren immer glücklich, dort gewesen zu sein.
Und eines Tages heiratete meine Cousine Nora Bernhard, den lustigen Schneidermeister und Postbeamten, vielleicht schien es auch nur so, dass Bernhard lustig war, so genau weiß ich das nicht.
Onkel Ernst hatte eine Kuh verkauft und hatte dann genügend Geld, eine große Hochzeit auszurichten.
Wir waren natürlich alle eingeladen und fuhren schon einen Tag vor dem Polterabend dorthin. Es war ein buntes Durcheinander. Viele Gäste und Verwandte waren bereits dort eingetroffen und alle schliefen in dem kleinen Häuschen oder einige bei Nachbarn. Irgendwie kamen alle unter, und die Stimmung war fröhlich und ausgelassen. Lenchen und ich schliefen z. B. in einem Bett, anders ging das nicht.
Ich sollte Blumen streuen und freute mich darauf.
Die Hochzeit selbst war feierlich und die Trauung fand in der Dorfkirche statt, alle waren sehr fein angezogen. Gefeiert wurde in der Dorfgaststätte in einem großen Saal. Es waren insgesamt etwa hundert Hochzeitsgäste, die großzügig mit Essen und Trinken bewirtet wurden. Das hatte damals noch eine besondere Bedeutung, diese Üppigkeit des Essens und Trinkens.
Es gab Musik und es wurde getanzt. Einige Männer hatten ihre großen Fotoapparate mit riesigen Blitzlichtaufsätzen dabei, wie sie damals üblich waren, und schossen Fotos.
Wir Kinder durften alle solange aufbleiben, wie wir wollten, wir durften auch mittanzen und an der Freude der Erwachsenen teilhaben. Das war lustig. Gefeiert wurde bis zum Morgengrauen. Und am nächsten Morgen ging es weiter. Fast alle Gäste, einige fuhren morgens nach Hause, saßen wieder bei Onkel Ernst im kleinen Häuschen und frühstückten, tranken Schnaps und feierten weiter. Wir bekamen einen leckeren Sonntagsbraten zum Mittagessen und alle waren fröhlich, und irgendwann fuhren wir dann auch nach Hause.
Das war dort in Nes. irgendwie immer ein Stück Heimat gewesen, für uns alle.
Eines Tages fuhren wir in die „Ostzone“, so wurde die von den Russen organisierte Zone im Osten Deutschlands nach dem Krieg genannt. Dort, in Thüringen, lebten einige von Marias Verwandten, denen Maria oft Pakete mit Lebensmitteln geschickt hatte. Es waren die sogenannten „Ostzonen-Pakete“. Zwei von Marias jüngeren Cousinen heirateten, die eine der beiden, meine Tante Lucia, wurde die Frau von Onkel Fred. Es war eine Doppelhochzeit. Ich sollte auch hier Blumen streuen und ein Gedicht aufsagen, das Maria mit mir einstudiert hatte. Es handelte irgendwie von Zwergen und Riesen, die zur Hochzeit gratulieren wollen.
Wir fuhren frühmorgens los und kamen irgendwann nachmittags in Ostberlin an, wo wir bei irgendwelchen Verwandten übernachteten. Von dort aus fuhren wir morgens um fünf Uhr weiter, und wir wurden von dunklen Männern in Uniformen kontrolliert. Es war eine gespenstische Angst, die ich damals empfand, die sich von Gustav und Maria auf mich übertragen hatte.
Maria hatte vieles zu den Verwandten in die Ostzone mitgenommen: Kleidung und Lebensmittel, da die Bevölkerung dort nach dem Krieg und viele Jahre danach schlechter mit allem versorgt war als in den britisch, amerikanisch und französisch besetzten Zonen.
Als wir noch in Mel. wohnten, hatte Maria oft Pakete mit geschlachteten Hühnern, Eiern, selbst gestrickten Pullovern usw. zu den Verwandten in die Ostzone geschickt, wir wussten nicht genau, ob die Pakete alle angekommen waren.
Jetzt fuhren wir also selbst dorthin. Als wir ankamen, da war schon ein langer Tisch mit einer weißen Tischdecke bezogen. Und wir bekamen Abendbrot, und die Hochzeitsgäste trafen alle nach und nach ein. Die Hochzeit sollte am nächsten Tag stattfinden.
Jedenfalls bekam ich einen Schlafanzug an, weil ich abends rechtzeitig schlafen sollte, und saß an dieser langen Tafel. Und dann schrie ich: „Au!“ Hatte mir doch ein kleiner Cousin, der unter den Tisch gekrabbelt war, in meinen Zeh gebissen. Das tat wirklich weh!
Und dann wurde ich von jemandem gefragt: „Wen magst du lieber, Vati oder Mutti?“ Und ich habe wie ein Schaf prompt geantwortet: „Vati!“ Maria schaute etwas verlegen und erstaunt, und ich wusste, dass ich etwas Falsches gesagt hatte, und es tat mir aufrichtig leid, weil ich schon immer für Ausgewogenheit und Gerechtigkeit war. Allerdings war Gustav mir tatsächlich von allen Familienmitgliedern am seelenverwandtesten gewesen.
Zur Hochzeitsfeier trug ich ein wunderschönes blaues Samtkleid mit weißem Kragen und ich streute die Blumen.
Auf meiner Hochzeit streute niemand Blumen! Nun habe ich auch immer ein ambivalentes Gefühl zu Hochzeiten und deren Feiern gehabt und bei diesem Thema eher an Bertolt Brechts Kleinbürgerhochzeit gedacht. In den 1950er-Jahren wurde das allerdings noch anders erlebt, es hatte etwas scheinbar Authentisches und gehörte dazu, das Heiraten und eine Hochzeitsfeier. Heute im 21. Jahrhundert ist das Heiraten mit einer entsprechend großen Hochzeit nicht nur üblich, sondern fast en vogue. Ich weiß nicht, ob das fort- oder rückschrittlich ist, nach allem, was in den letzten 50 Jahren im Hinblick auf das Vermeiden bürgerlicher Scheinheiligkeit, was Hochzeitsfeiern betrifft, propagiert wurde. So entspricht der Trend, aufwendige Hochzeiten auszustatten, eigentlich eher dem Leben und den Weltanschauungen des Kaiserreichs. .
Als ich damals dann vor dem Festessen das Gedicht aufsagen sollte, fing ich an und dann blieb ich stecken. Alle fanden das niedlich, aber ich hatte mich geschämt und fühlte mich seit dem nicht mehr wohl. Von diesem Moment an mochte ich nicht mehr gern Gedichte aufsagen, vielmehr fing ich sehr früh an, selbst zu dichten.
Und als es Sommer in Ho. war, da gab es einmal einen extrem warmen Sommerregen und wir Kinder durften nachmittags Badeanzüge bzw. Badehosen anziehen und draußen in den entstandenen Pfützen plantschen und die warme Dusche von oben genießen.
Irgendwann einmal mussten Wilfried und ich und auch die anderen Kinder den Kindergarten frühzeitig verlassen, die meisten Kinder wurden von ihren aufgeregten Müttern abgeholt. Eine rief sehr hektisch: „Schnell, mein Kind! Ich will Adenauer sehen!“
Jedenfalls trotteten Wilfried und ich in gewohnter Weise zusammen nach Hause, und dabei sahen wir viele Menschen, die sich auf dem Marktplatz gegenüber unserer Wohnung versammelt hatten. Zu Hause angekommen hatten unsere Mütter bereits das Wohnzimmerfenster geöffnet, das den direkten Blick auf den Marktplatz ermöglichte. Wir Kinder durften nach vorn, ich sah gar nichts außer viele Menschen und jemanden in ein Mikrofon sprechen. Das war der erste deutsche Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war der beliebte Deutsche, der tatsächlich nichts mit dem Nazi-Regime zu tun gehabt hatte. Es war für die Menschen eine Sensation, dass der Bundeskanzler aus Bonn, welches die damalige Politmetropole war, auch in der kleinen Stadt Ho. seinen Wahlkampf durchführte.
Adenauer hatte dafür gesorgt, dass nach harten Verhandlungen mit der damaligen Sowjetunion die restlichen gefangenen deutschen Soldaten aus der russischen Gefangenschaft freigelassen wurden und „heimkehren“ konnten. Es handelte sich dabei um die „Heimkehr der 10.000“. Das entfachte eine derart riesige Freude im ganzen Land, dass dieser Bundeskanzler auf der Beliebtheitsskala ganz oben stand. Allerdings war dieses „Heimkehren“ nicht ganz unproblematisch, da viele ehemalige Soldaten bereits längst totgesagt waren und die Frauen sich „neue“ Männer gesucht hatten. Diese Soldaten waren nicht erwünscht und hatten dann nicht unbedingt ein Zuhause. Die „Heimkehrer“ waren alle abgemagert und um viele Jahre gealtert. Es gab einen langen Prozess der Integration.
In unserer Familie kam das nicht vor. Alle Männer waren irgendwie rechtzeitig jenem Wahnsinnskrieg entkommen, zumindest äußerlich. Das war wie ein Wunder.
Und wenn Silvester war, dann haben die Erwachsenen gefeiert, und wir Kinder mussten schlafen gehen und wurden zum Feuerwerk geweckt. Es war laut und bunt und kalt auf dem kleinen Balkon, von dem aus wir das Spektakel ansehen konnten.
Beim nächsten Silvester durften wir dann aufbleiben und Onkel Hans, Martin und Wilfried setzten Stinkbomben und andere Scherzartikel ein, wie z. B. ein Feuerzeug, das gar nicht funktionierte, Becher zum Trinken, aus denen dann gar keine Flüssigkeit herauskam und vieles andere. Dann gab es kleine Tischfeuerwerke, und um Mitternacht wurden Raketen in Flaschen gezündet. Gustav mochte das nicht so gern, ich auch nicht. Ich mag es bis heute nicht.
Irgendwie war das gutgegangen, zwei Jahre lang, zwei Familien in einer Wohnung - irgendwie hielt man damals zusammen und auch später veränderte sich der Zusammenhalt zwischen diesen beiden Familien nicht.
Eines Tages wollten Gustav und Maria wieder ein eigenes Zuhause für die Familie haben. Sie mussten abwarten, bis sie eine Zuzugsgenehmigung bekamen, und irgendwann war es dann so weit. Wir zogen innerhalb der kleinen Stadt Ho. um.
Wir hatten eine Wohnung in einer Kaserne bekommen, die Gustav und Maria erst als Wohnung hatten ausbauen müssen. Das Gebäude war aus gelbem Backstein und unterhalb der Wohnung gab es große Garagen.
Zuerst kam man in eine große Küche. Maria bekam nigelnagelneue Einbauküche mit einem Drehschrank für die Töpfe, mit vielen Unterschränken und einem Küchentisch mit einer Eckbank.
Die Räume gingen alle ineinander über. Von der Küche aus kam man dann ins Wohnzimmer, dann ging es von dort ins Schlafzimmer und dann in ein Kinderzimmer, das Lenchen und ich uns teilten.
Es war alles ganz neu tapeziert mit modernen Mustern der 1950er-Jahre, und auch die Wohnzimmermöbel und das Kinderzimmer entsprachen dem Geschmack der Zeit.
Lenchen hatte sich für das Kinderzimmer eine Teenager-Tapete ausgesucht. Der Hintergrund war anthrazitfarben und im Vordergrund befanden sich Laternen, an die junge Mädchen mit einem weiten Rock angelehnt waren. Das war für die damalige Zeit ein ganz „verwegenes“ Design.
Die Wohnung war hell, und die Fenster zeigten zu einem davor gelegenen Sportplatz, der von Bäumen und Sträuchern umgeben war. Gustav und Maria waren glücklich, wieder ein eigenes Zuhause zu haben, und sie hatten es dort noch ganz gut angetroffen. Gegenüber unserer Wohnung stand ein großes, kastenförmiges Kasernengebäude, in dem viele Flüchtlinge nur ein einziges Zimmer bewohnten. Rechts hinter diesem Kasernengebäude befanden sich außerhalb dieses Kasernengeländes mehrere Holzbaracken, in denen ebenfalls Flüchtlinge wohnten.
Unsere Wohnung war, verglichen mit den eben beschriebenen Wohnmöglichkeiten, mit Abstand die beste.
Nun war ich gerade sechs Jahre alt und wurde zu Ostern eingeschult. Das war damals so. Ich bekam eine große blaue Schultüte, hatte ein hübsches Kleid an, Kniestrümpfe und schwarze Lackschuhe und einen blauen Teddymantel, weil es doch noch irgendwie kalt war. Maria ging an jenem Tag mit mir zur Schule.
Dort stellte sich unsere Klassenlehrerin vor, die Schapprot hieß und noch sehr jung war. Sie führte uns Kinder, wir waren ungefähr 30, in unseren Klassenraum, und sie erzählte uns eine Geschichte, die am Ende ein Rätsel aufgab. Es wurde ein Gewächs beschrieben, das sich im Wald befände, einen weißen Stängel mit einem roten Dach und weißen Punkten darauf hätte. Ich sagte als Einzige, ohne mich zu melden, weil ich das noch gar nicht kannte: „Das ist ein Fliegenpilz!“ Das war nun meine erste richtige Antwort in der Schule gewesen, und Maria hat noch viele Jahre später immer stolz davon erzählt. Zunächst ging ich gern zur Schule. Ich hatte eine Schiefertafel und einen Griffelkasten mit Griffeln und Buntstiften und einen Zeichenblock. Ich lernte einzelne Buchstaben kennen: das kleine i, das war ein Hockeyschläger mit einem Ball oben drauf, kleine Schleifen, damit war das kleine e gemeint, und große Schleifen bedeuteten das kleine l. Das erste Wort, das ich lesen konnte, stand auf einer Dose. Ich saß allein am Frühstückstisch, was häufig vorkam, und sah mir die Dose mit dem Caro-Kaffee auf dem Tisch genau an. Ich kombinierte: C A R O. Und dann las ich Caro, und weil ich wusste, dass sich darin der besagte Kinderkaffee befand, war mir klar, dass ich richtig gelesen hatte.
Ich lernte, das Lied zu lesen, zu schreiben und zu singen: „Tut, tut, ein Auto kommt, tut, tut, ein Auto kommt, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut … tut, tut ein Auto kommt!“ Das sollte wohl sehr modern sein, dass das Auto schon für ein sechsjähriges Kind wichtiger sein sollte als eine Blume, ein Tier oder ein Mensch!
In meiner Klasse gab es sogenannte Barackenkinder, die waren nicht hübsch gekleidet. Die fielen auf, weil sie ungepflegt waren. Irgendwie taten die mir leid. Wir hatten einen Lehrer, der hat diese Kinder geschlagen. Vor unser aller Augen musste z.B. ein Junge nach vorn kommen, weil er seinen Griffelkasten vergessen hatte, oder er hatte gar keinen, weil die Eltern so arm waren – und der Lehrer nahm ein Lineal und schlug dem Jungen, der sich auf das Pult legen musste, damit auf den Po. Das war so furchtbar mit anzusehen und schürte die Angst bei uns Kindern.
Ich war sehr gut in der Schule, aber auch ich wurde einmal geschlagen. Da haben wir Buchstaben geschrieben, auf unseren Zeichenblock. Ich war früher fertig als die anderen Kinder, und ich drehte mich nach hinten um, um einer Mitschülerin zu zeigen, wie sie die Buchstaben zeichnen/schreiben müsse. Daraufhin kam Fräulein Schapprot und schlug mir ins Gesicht. Heute würde man so ein Kind belohnen, das eine so hohe soziale Kompetenz zeigt.
Heutzutage verhalten sich Kinder seltener auf diese Weise, sie mobben einander mehr als damals und sind oftmals gewalttätiger. Jedenfalls erzählte ich damals nicht viel von meinen Schulerlebnissen zu Hause, aber das hier schon.
Als Maria und Gustav von dem Schlag ins Gesicht hörten, waren sie empört, und Maria ging am nächsten Tag zur Schule und beschwerte sich bei Fräulein Schapprot: „Unsere Kinder werden zu Hause nicht geschlagen, und mein Mann und ich wollen auch nicht, dass unsere Kinder in der Schule geschlagen werden!“
Das tat Maria für mich, und ich wurde auch nie wieder in der Schule geschlagen!
Ich war sehr beliebt, und ein Schulkamerad, der in unserer Nähe wohnte, holte mich immer morgens zur Schule ab und brachte mich wieder nach Hause. Werner hieß er und er mochte mich gern. Maria fand das niedlich, mir war das irgendwie gar nicht so wichtig.
Ich musste morgens immer ein Glas warme Milch trinken und bekam Butterbrote mit in die Schule.
Werner kam auch zu meinem Geburtstag und er war sehr fein gemacht – mit einer Fliege. Er brachte mir hübsche Geschenke mit. Das war mir allerdings auch nicht so wichtig. Überhaupt mochte ich einen Jungen lieber als Werner, der hieß Gerd und war ganz dünn und blass. Ich weiß nicht, warum mir der gefiel, aber es war so.
Einmal feierten wir Fasching in der Schule und ich war ein Marienkäfer. Ich hatte einen roten Rock aus Krepppapier mit schwarzen Punkten darauf und ein spitzes Hütchen ebenfalls mit Punkten. Das war lustig. Wir machten alle gemeinsam hübsche Spiele im Kreis und wir sangen.
Zu Weihnachten bekam ich nun mein erwünschtes Himmelbett in der richtigen Größe und eine große Babypuppe, die die Augen öffnen und schließen konnte, wenn ich sie hinlegte. Das war toll.
Lenchen bekam sensationeller Weise einen Philips-Plattenspieler, der große Schallplatten und Singles abspielen konnte. Der hat uns viele Jahre als Musikquelle gedient, und ich hatte ihn sogar noch zu Beginn der 70er-Jahre in meiner Studentenwohnung.
Dieser Plattenspieler war damals eine Sensation. Gustav und Maria hatten ihn bei Onkel Hans und Tante Frieda im Laden günstiger bekommen, und dazu gab es Schallplatten, solche, die Gustav und Maria gern hörten, z. B. von Friedel Hensch und den Cypris: „Ohne Gruß, ohne Kuss, soll man nie auseinander geh´n, denn, wer weiß, denn, wer weiß, wann wir uns mal wiederseh´n!“ oder „Solang die Sterne glüh´n, solang noch Blumen blüh´n, solange bleiben uns die Hoffnung und die Liebe!“ oder „Meine Heimat ist täglich woanders, immer dort, wo der Wagen grad hält!“ oder von Wolfgang Sauer: „Wenn die Glocken hell erklingen, und der Sommer geht
durch’ s Land, dann beginnt mein Herz zu singen, und wir reichen uns die Hand!“ oder Tom Dooley auf Deutsch: „Alles vorbei, Tom Dooley, auf deinem letzten Gang, keiner wird um dich weinen, bringt dir kein Glockenklang!“ Die meisten Schlager spiegelten noch irgendwie die Traurigkeit des Abschiednehmens, die Heimatlosigkeit, die Tragik von Trennung und eine gewisse Wehmut wider.
Und Lenchen? Lenchen hörte die Musik der Jugendlichen von damals. Das war Rock´n Roll auf Deutsch, von Peter Kraus. Er tritt übrigens sogar heutzutage noch in Deutschland auf. - Ebenso hörte sie Conny Froboess, die auch manchmal mit Peter Kraus zusammen sang, und auch Ted Herold wurde oft gehört, der den damals bekannten Song „Moonlight“ sang. Und dann war da noch ein Amerikaner, der alle jugendlichen Gemüter erhitzte: Elvis Presley. Danach wurde „Rock´n Roll“ getanzt. „Rock´n Roll, Rock´n Roll, ist die Hose noch nicht voll!“, haben wir Kinder immer gesungen.
Jene Songs hatte Lenchen nun in Form von Singles, und die wurden immer gehört, und ich als kleine Schwester war stolz, dass ich mithören durfte.
Die Erwachsenen nannten die Jugendlichen mit Jeans „Halbstarke“. Die Mädchen trugen weite Röcke oder Kleider, darunter Pettycoats. Da diese sehr teuer waren, trugen viele Mädchen mehrere Unterrücke übereinander, damit die Röcke weit abstanden. So also machte das auch Lenchen, und Maria hatte es ihr verboten. Ich habe nie verstanden, warum. Das sei schlampig oder so.
Jedenfalls kontrollierte Maria den Rock und die Unterröcke und Lenchen musste dann, bevor sie zur Schule ging, immer welche ausziehen. Das hat sie genervt.
Und dann hatte Lenchen Konfirmation und bekam den schönsten, breitesten und teuersten Pettycoat geschenkt, dafür sorgte Gustav. Nun brauchte sie nur noch einen und hatte so die weitesten Röcke von allen Mädchen in ihrer Klasse.
Für die Konfirmation wurde unheimlich viel vorbereitet. Ein großer Teil unserer Verwandtschaft kam nun bei uns zusammen. Sie übernachteten alle bei uns in der Wohnung und bei Tante Frieda: meine Großeltern aus Düsseldorf, Onkel Andre, Onkel Fred mit seiner Frau Lucia, Tante Lotti mit ihrem Ehemann Otto, die kleine Oma mit Gustavs Stiefvater, Onkel Ernst und Tante Magda, Nora mit ihrem Mann Bernhardt, Emil mit seiner Verlobten Felicitas und Ilse und Bastian, dem Cowboy, und Onkel Hans und Tante Frieda, Martin und Wilfried und noch einige mehr.
Jedenfalls wurde die ganze Wohnung umgeräumt. Es wurden Tische neu dazugeholt und durch alle Zimmer, die ja ineinandergingen, gezogen. Sie waren mit gestärkten weißen Tischdecken versehen, und Maria hatte für alle gekocht und einige Tage lang bewirtet. Und eine Frau, die tatsächlich Minna oder so ähnlich hieß, wusch das Geschirr ab. Es war eine lustige Stimmung. Gustav, Maria, Lenchen und ich fuhren zu einem Fotografen und dort wurden Familienfotos mit der Konfirmandin Lenchen gemacht.
Nach der Konfirmation besuchte meine Schwester einen Tanzkurs und war stolz auf ihren Pettycoat. Sie hatte einen Verehrer, der ihr Tanzpartner war und der sie immer zum Tanzen abholte. Er lud sie zum Abtanzball ein und sie bekam einen großen Strauß roter Rosen.
Und als die kleine Oma für mehrere Wochen zu Besuch war und Lenchen ihre Musik von Elvis und Peter Kraus hörte, verstand die kleine Oma das nicht so richtig, auch Maria und Gustav konnten der Musik nichts abgewinnen. Doch dann legte Lenchen die Platte „Muß´i denn, muß i´ denn zum Städtele hinaus!“ auf, da schmolz die kleine Oma dahin und meinte: „Hat der aber eine schöne Stimme!“ Und dann sagte Lenchen: „Oma, das ist doch Elvis Presley!“ Die kleine Oma war erstaunt und irgendwie überzeugt. In Deutschland galt Elvis für die ältere Generation als „Halbstarker“, der die Jugend mit seiner wilden Musik verderbe. Durch den Rock´n Roll entstand damals schon eine Art Subkultur. Ich hörte Elvis damals auch gern. Danno ist noch heute ein großer Elvis-Fan, weil er der erste weiße Sänger und Star war, der öffentlich mit schwarzen Sängern und Musikern auftrat, trotz der Apartheid in den 1950er- und 1960er-Jahren in den USA. Er war ein außergewöhnlicher Künstler und überaus spiritueller Mensch und übrigens auch Steinbock.
Allerdings war mein Liebling damals Freddy Quinn, der jung und für mich ein toller Sänger war. Ich liebte wahrscheinlich die Sehnsucht, die hinter diesen Liedern durchschimmerte.
Ich wünschte mir zu meinem Geburtstag zwei Singles, die ich dann auch bekam. Die eine war von Freddy, „Die Gitarre und das Meer“, und von Dalida, „Am Tag, als der Regen kam.“ Das waren meine Lieblingsschlager, die ich im Radio gehört hatte, und als ich diese Schallplatten besaß, spielte ich sie immer wieder, bis ich die Schlager selbst singen konnte.
Maria hörte gern „Köhlerliesel“, das war ein Volkslied als Schlager interpretiert. Und Gustav? Gustav liebte Musik in allen Variationen.
Ja, so war das. Aber das war nicht alles, was sich zu jener Zeit zutrug. Da gab es noch mehr … Dort, wo nicht soviel verdrängt werden musste, passierte mehr zwischen Himmel und Erde …
Zum Beispiel gab es auf der anderen Seite der Erdkugel einen, der sich aufgemacht hatte, die Welt zu verändern. Er hatte 1953 zum Dr. med. promoviert und hatte sich mit einem Motorrad aufgemacht, quer durch Südamerika zu reisen, um sich ein Bild von der Bevölkerung und deren Armut zu machen. Er hatte in Bolivien auf einer Lepra-Station gearbeitet und wollte die ungerechte Welt und die Armut bekämpfen und wurde zum Revolutionär und Rebellen. Er meinte, dass es eine bessere Welt geben könne, wenn man das kapitalistische System durch ein sozialistisches ersetze. Und wenn es möglich sei, die Armut und die Weltungerechtigkeit mit Waffengewalt beseitigen zu können, so wollte er das tun. Er eroberte mit Fidel Castro durch jahrelange Guerilla-Kämpfe Kuba und wurde Kommandant der Festung „La Cabana“, bestimmender Wirtschaftsberater und Ideologe der neuen Regierung Cubas unter Fidel Castro und Leiter der Nationalbank Cubas. Er besuchte mehrmals Ost-Berlin und Moskau. Hierbei handelte es sich um den Argentinier Ernesto Rafael Guevara de la Serna, genannt Che.
Und in den deutschen Familien wurde zunächst fleißig vergessen und verdrängt, so gut es alle konnten: die Täterschaft, das Opferdasein, den Hunger und die Ungeheuerlichkeiten an Unmenschlichkeit.
Nur die Nervenzellen hatten alles gespeichert, das sollte sich noch zeigen! Es war eine Art Pause in jener Zeit im Deutschland der 1950er-Jahre, die notwendig war, weil alle irgendwie unter Schock standen und so tun wollten, als ginge das Leben normal weiter. Die Deutschen waren mit dem Überleben, mit einer Neuordnung des Lebens beschäftigt, und das geschah im Außen, im Aufbauen einer kleinen Welt, die allen zuvor verloren gegangen war. Es wurde nichts wirklich problematisiert. Dazu war kein Raum in den verletzten und irritierten Gemütern.
Am Wochenende, wenn Gustav von seinen Schleswig-Holstein-Touren nach Hause kam, gingen wir vier manchmal in die Kirche und anschließend spazieren. Wir waren sehr fein ausstaffiert. Maria trug ein eng anliegendes, modisches Kostüm mit breitem Kragen und einen Topfhut, Gustav hatte einen feinen Anzug an und trug einen ziemlich breitkrempigen Hut, Lenchen hatte ein Kleid an, das mit ihrem neuen Pettycoat sehr weit war und ich hatte ein weiß-blaues Sommerkleid an. So gingen wir in einen nahegelegenen Park und fielen auf. Wir sahen aus wie eine Fürstenfamilie. Lenchen und ich waren immer sehr gut angezogen. Wir sollten nicht als Flüchtlingskinder auffallen, aber wir fielen natürlich auf, weil wir besonders gut gekleidet waren. Als Kind möchte man gar nicht auffallen, man möchte nur dazugehören, aber das war nicht immer so einfach.
Danno und ich fahren morgen von der Kur nach Hause. Wir haben 12 Tage gefastet, und Danno will auch im Alltag noch weiter fasten. Heute hat Essen und Trinken einen anderen Stellenwert, aber das ist noch nicht dran. Wir besuchen nächste Woche Maria, die, mit Unterstützung von Beruhigungspillen, den Tod von Gustav zu verwinden versucht. Sie ist sehr tapfer, mehr in ihrer Mitte, nur sehr, sehr traurig.
Tapfer war Maria damals auch, denn Gustav war während der Woche unterwegs, und sie musste noch Geld dazu verdienen. Sie verkaufte Elektroöfen in einem Hotel in Ho. Wir hatten selbst auch so einen Ofen, der auf Rollen stand und elektrisch heizte. Der sollte eine Ergänzung dafür sein, wenn Kohle- oder Ölöfen nicht genügend Wärme brachten. Dann waren entweder die kleine Oma zu Besuch bei uns, um auf mich aufzupassen, oder meine Großeltern aus D.
Ich mochte das nicht, wenn Maria nicht da war. Ich fühlte mich wund und verlassen, habe aber mit niemandem darüber gesprochen.
Und einmal, es war ein Samstagmorgen, da stand ich auf, etwas später als sonst, und da waren morgens nur meine Großeltern da. Gustav und Maria waren in der Stadt zum Einkaufen. Sie hatten mir aber nichts davon gesagt, und da war ich sehr enttäuscht. Ich fühlte mich verlassen, im Stich gelassen, und da habe ich meinen Großeltern gegenüber Panik verbreitet, indem ich behauptete, ich hätte schon längst in der Schule sein müssen. Damals gingen die Kinder noch samstags zur Schule. Meine Großeltern waren ganz aufgeregt und wollten mir helfen, mich für die Schule fertig zu machen. Das habe ich aber nicht zugelassen und gesagt, das sei sowie schon zu spät. Die beiden waren besorgt, wussten aber nicht so recht, wie sie mir nun helfen konnten. Da kam Gustav. Er war sehr gelassen und liebevoll. Und ich freute mich einfach nur, dass er wieder da war. Er warf einen Blick auf den Stundenplan, der im Küchenschrank in der Innentür hing, und sagte: „Heute musst du doch erst um 10.30 Uhr in der Schule sein.“ Alle waren beruhigt und ich war glücklich, dass Gustav sich nun um mich kümmerte.
Als Gustav, Maria und ich einmal nach Düsseldorf zu meinen Großeltern fuhren, weil Maria und Gustav einen neuen Bus in Köln kaufen wollten, gab es wieder Hühnersuppe mit Suppengemüse und Nudeln, Hühnerfleisch mit Kartoffeln und Gurkensalat bei meiner Oma.
Und als Maria und Gustav am nächsten Morgen nach Köln fuhren und mir erklärt hatten, dass sie mich nicht mitnehmen könnten, da hatte ich den Grund nicht verstanden und die Tatsache, bei meinen Großeltern bleiben zu müssen, innerlich nicht hingenommen. Jedenfalls war ich bockig. Ich aß das Mittagessen meiner Oma nicht, obwohl ich Hunger hatte, und sagte zu ihr: „Das ist alles von gestern!“ Und das wurde noch viele Jahre später als Anekdote erzählt, weil ich sonst immer das artige, angepasste Kind war. Tatsächlich war ich damals sehr enttäuscht gewesen, dass meine Eltern mich nicht nach Köln mitgenommen hatten, und ich war traurig und auch ein wenig verzweifelt gewesen. Als Gustav und Maria dann mit dem neuen Auto vor der Tür standen, da war ich froh, und meine Bockigkeit war sofort verschwunden.
Wenn die kleine Oma zu Besuch war und auf mich aufpasste, während Maria Elektroöfen verkaufte, Gustav mit seinen Teppichen unterwegs war und Lenchen sich mit ihren Freundinnen und Freunden traf, da hatte ich manchmal auch dieses Bockigkeitsgefühl. Obwohl ich meine kleine Oma sehr liebte, tobte ich draußen herum und sagte ihr nicht, wann ich wieder zurückkommen würde. Ich spielte mit den Flüchtlings- und Barackenkindern „Räuber und Gendarm“ oder „Cowboy und Indianer“, und ich fiel oft hin und schlug mir die Knie auf. Maria wusch mich abends in der Schüssel und behandelte mich wie einen Jungen. Sie rieb mit einem Lappen und Seife über meine Wunden und sagte: „Das härtet ab!“ Und ich hielt das tapfer aus.
Ich sammelte Schnecken, große und kleine, mit Häusern und ohne und ich genoss es, wenn sie in unserem Kinderzimmer auf der Fensterbank ihre Schleimspur hinterließen.
Einmal hatte ich Keuchhusten und verwand das ganz tapfer. -
In der Adventszeit war alles schön geschmückt und an den Adventssonntagen wurde am späten Nachmittag das Licht ausgemacht und die Kerzen am Adventskranz angezündet. In dieser Atmosphäre erzählten Gustav und Maria Lenchen und mir, als seien wir Erwachsene, von den Gräueltaten, die sie auf der Flucht gesehen und miterlebt hatten. Sie beschrieben Leichenberge am Wegesrand, Menschen, die schwer verwundet und am Verbluten waren, denen sie nicht helfen konnten, Freunde und Bekannte, die erschossen worden waren, Kinder, die verhungert waren, Mütter, die ihre verhungerten Babys noch mit sich herumtrugen, weil sei deren Tod nicht fassen konnten. Sie schilderten die Angst und den Terror der damaligen Zeit und ihre eigene Angst.. Wir Kinder waren sprachlos, haben aber alles verstanden.
Später haben Gustav und Maria nie mehr von jenen Gräueltaten erzählt, sondern nur noch von dem Geschenk, dass sie so heil davongekommen sind.
Als der 6. Dezember kam, glaubte ich immer noch irgendwie an den Nikolaus. Ich konnte in jener Nacht nicht schlafen und wollte irgendwie wissen, ob es den guten Mann nun gibt oder nicht. Es war nur Maria da. Lenchen schlief bei ihrer Freundin Petty, und Gustav war mit seinen Teppichen unterwegs. Als es über Mitternacht hinaus war und ich immer noch nicht eingeschlafen war, ging die Tür auf. Ich stellte mich schlafend und Maria trat ein und steckte mir ein paar bunte Süßigkeiten in den Schuh, da begriff auch ich, dass es den Nikolaus, der den Kindern Geschenke bringt, gar nicht gibt! Oder?
Zu Weihnachten bekam ich einen Kaufmannsladen, Lenchen bekam hübsche Sachen zum Anziehen und Singles für ihren Plattenspieler, den die ganze Familie nutzte.
Gustav spielte mit mir die Weihnachtstage über, indem er bei mir in meinem Kaufmannsladen einkaufte und immer große Mengen Bonbons verlangte: Er wollte immer zwei Kilogramm Bonbons haben, sodass ich ihm sagen musste, so viele seien gar nicht so gut!
Als ich die erste Klasse beendet hatte, bekam ich ein Zeugnis, das überragend war. In den Sommerferien sollten wir mit Buchstaben und kurzen Wörtern ein ganzes Heft voll schreiben, das tat ich dann auch, obwohl mich das irgendwie belastete.
Und in der zweiten Klasse hatten wir dann Religionsunterricht. Die Religionslehrerin war eine große, dünne ältere Frau mit einem grauen Knoten und einer Brille, und sie erzählte uns biblische Geschichten, die ich sehr mochte.
Und einmal, vor Ostern, erzählte sie uns die Geschichte von Jesus. Alle hörten aufmerksam zu. Es war eine unglaubliche Stille im Klassenzimmer, die fast wehtat. Ich hatte das Gefühl, als würde ich diese Geschichte bereits sehr gut kennen. Die Lehrerin beschrieb die Leidensgeschichte Jesu besonders eindringlich, und ich war sehr traurig. Ich konnte es nicht verstehen, dass ein Mensch, der nur Gutes getan hatte, der die Menschen geheilt und sich für Gerechtigkeit eingesetzt hatte, gekreuzigt worden war, und dass das auch noch für mich zum Zeichen sein sollte, dass meine Sünden vergeben sind.
Ich konnte es kaum aushalten, dass so ein kostbarer Mensch für mich gestorben sein soll! Das machte mich so unendlich traurig und es beschäftigte mich sehr.
Bereits damit hatte schon etwas in meinem tiefsten Inneren beschlossen, eine Art Kämpfer, Rebell zu werden, und zwar für das Gute, für die Gerechtigkeit, für diesen Christus. Aber das war mir nicht bewusst. Ich sprach mit niemandem darüber.
An jenem Tag, als ich die Leidensgeschichte Jesu verinnerlicht hatte und nach Hause kam, ging ich nicht wie sonst an den an unsere Wohnung angrenzenden Bodenraum, an dessen Holzbalken Gustav eine Schaukel für mich angebracht hatte, sondern ich ging in mein Kinderzimmer.
Da Lenchen noch nicht zu Hause war, setzte ich mich ans Fenster und betete lange Gebete, für Gustav und Maria, für Lenchen und mich und all unsere Verwandten. Das tat ich oft während jener Schulzeit in Ho., wenn ich aus der Schule kam.
Zur gleichen Zeit, in jenen 1950er-Jahren, da gab es einen, der sich schon längst aufgemacht hatte, Christus zu folgen. Er war auch ein Steinbock-Geborener, ein Baptistenprediger, der sich in jener Zeit in den USA gegen die Apartheid einsetzte. Er war einer der charismatischsten Führer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Er war Theologe und Philosoph. Er hatte u. a. Platon, Aristoteles, John Locke, Jean-Jaques Rousseau, David Thorea und Walter Rauschenbusch gelesen. Ich meine Martin Luther King Jr. Er war Prediger und Bürgerrechtler zugleich und meinte:
„Predigen ist für mich ein dualer Prozess. Einerseits muss ich versuchen, die Seele eines jeden Einzelnen zu verändern, damit sich die Gesellschaft verändern kann. Andererseits muss ich versuchen, die Gesellschaft zu verändern, damit sich jede einzelne Seele verändern kann. Darum muss ich mir über Arbeitslosigkeit, Slums und wirtschaftliche Unsicherheit Gedanken machen.“ (Clayborne Carson: The Autoborgraphy of Martin Luther In, Jr., S. 19)
Als Philosoph beschäftigte sich Dr. Martin Luther King mit unterschiedlichen Theorien, also hatte er auch Karl Marx gelesen und fand dabei heraus, dass die Wahrheit weder im traditionellen Kapitalismus noch im Marxismus zu finden sei. „Der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts beachtete die sozialen Aspekte des Lebens nicht und der Marxismus übersah und übersieht, dass das Leben individuell und persönlich ist. Das Königreich Gottes ist weder die These von individuellen Unternehmungen noch die Antithese von kollektiven Unternehmungen, sondern stellt eine Synthese dar, welche die Wahrheiten beider vereinigt.“ (ebd., S. 22).
Für seinen Vater, der auch Pastor und Prediger war, und für ihn selbst war der Name Martin Luther Ausdruck tiefen religiösen Empfindens. Nach einer Europareise 1934, als beide auch nach Deutschland kamen, änderte der Vater seinen eigenen Namen und den seines Sohnes zu Ehren Martin Luthers in Martin Luther King.
Martin Luther King Jr. reiste durch die USA und besonders durch die Südstaaten, hielt über 200 Reden und rief zum zivilen Ungehorsam auf und erreichte bereits in den 1950er-Jahren viel für die Aufhebung der Rassentrennung.
Nach einer Indienfahrt war Luther King durch Gandhis Gewaltlosigkeit und Liebe dazu inspiriert, dies als Methode für soziale Reformen und die Aufhebung der Apartheid anzuwenden.
Davon erzählten uns unsere Verwandten, z. B. Onkel Clemens, Gustavs Cousin, der nach dem Krieg in die USA ausgewandert war. Er besuchte uns regelmäßig und berichtete uns von dem Leben in den USA und auch von der Apartheid.
Damals in den deutschen Wohnzimmern schienen diese Themen nicht von Interesse zu sein. Es fand in Deutschland ein Leben voller alltäglicher Banalitäten statt, oder vielleicht ist es ja auch in Ordnung für Banalitäten zu leben oder nicht?
Jedenfalls hatte ich damals eine Freundin. Sie hieß Rosi und ging in meine Parallelklasse. Sie wohnte bei uns gegenüber, auch auf dem Kasernengelände, in dem Hochhaus, in dem es nur kleine Einzimmerwohnungen gab. Ihr Vater fuhr eine Isetta, das war ein winzig kleines Auto, bei dem die Tür nach vorn, wo sich das Steuerrad befand, aufzumachen war. Der Vater fuhr im Sommer mit Rosi und mit mir in einen kleinen Schrebergarten, wo Rosi und ich spielen und dort mit einem schwarzen Kater schmusen konnten. Wir verstanden uns sehr gut.
Eines Tages haben wir uns gestritten, und Rosi lief einfach mitten im Spiel davon direkt über die Straße. Da kam ein Auto und sie war angefahren worden. Ich hatte das gesehen und konnte es nicht verhindern. Sie wurde von dem heranfahrenden Auto in hohem Bogen auf das Kopfsteinpflaster geschleudert. Noch heute muss ich immer besonders aufmerksam nach links und rechts schauen, bevor ich eine Straße überquere, so sehr hatte mich damals jener Unfall schockiert.
Rosi sah sehr schlimm aus, und Maria und ich besuchten sie im Krankenhaus und brachten ihr etwas zum Spielen mit. Zum Glück war sie noch glimpflich davongekommen, sie hatte nur eine kleine Gehirnerschütterung und einige Schürfwunden. Ich war so froh. Sie war mir damals meine liebste Freundin.
Und einmal sangen Rosi und ich zusammen Maria ein witziges Liedchen vor: „Auf der grünen Wiese stand ein Gockelhahn, wollte gern verreisen, mit der Eisenbahn. Eisenbahn kam an, Gockelhahn stieg ein, fuhr zu Tante Liese über Stock und Stein! `Guten Tag, Tante Liese! sprach der Gockelhahn. ´Ich bin hergekommen, mit der Eisenbahn!` Tante Liese spricht: ´Nein, das glaub´ ich nicht! So ´nen dummen Gockelhahn nimmt die Bahn nicht mit!“ Das gefiel Maria so gut, dass sie uns beiden Süßigkeiten gab und viele, viele Jahre noch davon erzählte.
Vielleicht müsste ich Maria jetzt dieses Lied vorsingen, wo sie so sehr um Gustav trauert und so schwer depressiv ist. Vielleicht würde sie das aufmuntern, aber sie hört nicht viel, nur ein Rauschen. Irgendetwas will wahrscheinlich auch nicht mehr hören, auf nichts mehr, das von außen kommt, das ihr den Weg weisen könnte, sie reglementieren könnte - nur Geräusche, die von innen kommen, kann sie hören. Es scheint alles überzufließen von ihrem bewegten, anstrengenden, aufregenden, bunten Leben. Sie hat wahrscheinlich einen Hörsturz und kann kaum mehr hören. Ich gebe ihr nach den neuen Quanten-Selbstheilungsmethoden Massagen und lege ihr meine Hände auf. Es geht Maria dann besser, nur wenn Danno und ich wieder wegfahren wollen, dann wird sie wieder unendlich traurig, weint oder sie schimpft auch. Ich würde sie gern davon befreien, von dieser unendlichen Traurigkeit, und ich versuche, sie wenigstens ein wenig abzulenken und ihr meine Liebe zu zeigen. Aber mehr kann ich nicht tun, ich kann ihre Wunden nicht zu meinen machen, damit sie nicht so viel Schmerz tragen muss, obwohl ich das in meinem Leben immer versucht habe.
Ich weiß zwar mittlerweile, dass das nicht meine Aufgabe ist, aber es geht doch irgendwie um gelebte Barmherzigkeit. Da weiß ich nicht, wo mein Ich aufhört und das Du anfängt oder umgekehrt. Ich bin so, ich meine die Grenzen zwischen Ich und Du fehlen, ich habe ja schließlich keine richtige Ich-Werdung als Kind vollzogen. Freunde sagen, dass ich glücklich sein darf, auch wenn meine Mutter traurig ist. Das kann ich nicht. Laut der Erkenntnisse der Quantenphysik ist alles miteinander verbunden, und ein System ist dann gut, wenn es allen in dem System gut geht. Also kann der Mensch wirklich glücklich sein, wenn so viele Menschen auf der Welt unglücklich sind, weil sie krank, am Verhungern und Verdursten und depressiv sind!? Und wenn die Seele meiner Mutter am Verhungern und Verdursten ist, dann kann ich das doch nicht ignorieren, dann muss ich doch auch betroffen sein, wenn ich ein „ungepanzerter“ Mensch bin, oder?
Zurück zu meinem Leben als Kind. Es galt damals, die „Olympischen Spiele“ in Rom zu Hause am Fernseher mitzuverfolgen. Alle Nationen der Welt bzw. fast alle spielten dort im sportlichen Wettkampf um Medaillen.
Wir hatten von Anfang an in jener Wohnung einen eigenen Fernseher, der in einem Schrank war, der abgeschlossen werden konnte. Der hat mindestens 25 Jahre lang seinen Dienst getan. Ich hatte jenen Schrankfernseher noch in meiner Studentenzeit schwarz angemalt, und er funktionierte bis 1984 oder länger. Irgendwann wurde er dann mal ausrangiert.
Damals hatte ich viele Kindersendungen gesehen wie solche von der „Augsburger Puppenkiste“, „Die Mumienfamilie“, oder „Fiede Appelschnut“, amerikanische Sendungen wie „Lassy“ und auch Folgen wie „Abenteuer unter Wasser“ mit Mike Nelson, dem Taucher.
Lenchen und ich schauten jeden Nachmittag, wie die deutschen Leichtathleten viele Medaillen gewannen. Dann gab es den legendären 100-Meter-Lauf mit Armin Harry, der lief am schnellsten von allen Mitstreitern und gewann schließlich eine Goldmedaille. Darüber wurde noch Jahrzehnte immer wieder gesprochen. Das war 1960.
Und dann wollten Maria und Gustav sich verändern, wir zogen in eine andere Stadt, nach N., nur eine Stunde von Ho. entfernt. Das war 1961. Sie hatten eine Zuzugsgenehmigung bekommen, um dort zu wohnen und ein kleines Teppichgeschäft zu eröffnen. Wir mussten wieder alles aufgeben, die Menschen, die Umgebung und das Vertraute: Lenchen ihre Freundinnen und Freunde und ich Rosi, Werner und Gerd.
So friedlich, wie das tägliche Leben damals erschien, ging es in jener Zeit in Deutschland nicht wirklich zu.
Denn in jenem Jahr geschah noch etwas Geschichtsprägendes: Es wurde eine Mauer gebaut, eine lange, hohe graue Mauer. Sie trennte Ostberlin von Westberlin. Sie verlief dann quer durch ganz Deutschland und trennte Ostdeutschland von Westdeutschland. An jenem Tag, zu Beginn des Mauerbaus, spielte der amerikanische Präsident Kennedy Golf und der Premierminister Mac Millan war ebenfalls nicht ansprechbar. Sie sahen weg und die ganze Welt schaute zu, wie Deutschland geteilt wurde. Viele Staaten sahen es wohl noch als gerechte Strafe an, dass der deutsche Übermut und Verrat an der Menschheit auf diese Weise gesühnt wurden.
Jedenfalls wurde nichts dagegen unternommen, und die beiden deutschen Staaten, die DDR und die BRD, waren nun nicht nur wegen der unterschiedlichen Staatsformen voneinander getrennt, sondern nun auch durch eine konkrete unüberwindbare Grenze. Das war ein schwerer Schlag für die Bevölkerung beider deutscher Staaten, und eine große zusätzliche Angst machte sich breit. Deutschland war nun offensichtlich geteilt in Ost und West, die Welt war geteilt in Kommunismus und Kapitalismus. Man sprach von dem so genannten „Eisernen Vorhang“. Zunächst konnte niemand in die DDR einreisen. Man durfte weiterhin Pakete an die Verwandten schicken, aber auch das war zunächst alles schwierig. Die Schatten des Krieges wurden hier sicht- und spürbar.
Die Mauer als Grenze in einem Land wurde auch zu einer Enge im Kopf und im Gemüt, in Raum und Zeit. Es gab einen sogenannten Todesstreifen und viele Todesopfer. Viele Flüchtlinge wurden von Volkspolizisten an der Grenze erschossen, wie auch Peter Fechter, der mit 18 Jahren am 17. August 1962 an der Mauer sein Leben lassen musste. Man ließ ihn auf der DDR-Seite verbluten, nicht einmal die Alliierten kamen zu Hilfe!
Kurz vor dem Mauerbau waren noch viele Menschen aus dem Osten in den Westen geflohen oder von Ost- nach Westberlin gegangen. So sprang ein 20-jähriger Soldat in die Freiheit, Hans Conrad Schumann. Während des Mauerbaus, der gerade zwei Tage zuvor begonnen hatte, wagte ein DDR-Grenzsoldat die Flucht über eine 80 Zentimeter hohe Stacheldrahtrolle. Vor der Errichtung der Mauer stellten Stacheldrahtrollen bereits die Grenze zwischen Ost und West dar.
Die Flucht gelang und er „landete“ durch seinen mutigen Sprung heil im Westen Berlins. Das Foto von seinem Sprung in die Freiheit gehört zu den bekanntesten Bildern des Kalten Krieges. Dieser Soldat in seiner Sprunghaltung steht auch als Skulptur an der Bernauer Straße in Berlin.
Es gab zur damaligen Zeit und auch Jahre später viele Flüchtlinge aus der DDR, viele Tote und viele gescheiterte Versuche, in den Westen zu gelangen.
So war ein Ostberliner, der bereits in Westberlin sein Abitur gemacht hatte, 1961 unmittelbar vor dem Mauerbau nach Westberlin übergesiedelt, wo er Soziologie, Ethnologie, Philosophie und Geschichtswissenschaft studierte. Es war Rudi Dutschke, der Rebell. Er war in der DDR geboren, war aktiv in einer evangelischen jungen Gemeinde in Luckenwalde gewesen und auf diese Weise zu einer „religiös sozialistischen“ Grundhaltung gekommen. Durch den Ungarnaufstand 1956 wurde er politisch und verweigerte ein Jahr später den Wehrdienst im Osten, der damals noch freiwillig war. Er vertrat einen demokratischen Sozialismus und distanzierte sich gleichermaßen von den USA und der Sowjetunion. Er sorgte in den folgenden Jahren für die Unruhe, die nötig ist, um gesellschaftlich irgendetwas zu verändern. Das ist jetzt aber noch nicht dran. Übrigens gibt es seit 2008 eine Rudi-Dutschke-Straße in Berlin, die die Axel-Springer-Straße kreuzt.
Zu jenem Zeitpunkt, den es gar nicht gibt, in jenem Zeitkontinuum, fing der Begriff „Ostzone“ im allgemeinen Sprachgebrauch an, unüblich zu werden, und es wurde nun offiziell meistens von der sogenannten DDR gesprochen, wenn Ostdeutschland gemeint war. Darüber erhitzten sich noch viele Jahre die Gemüter und irgendwann später wurde dann fast nur noch von der DDR gesprochen.
Unsere Familie fing also mal wieder neu an und wechselte den Ort, so, als sei es ein Beweis für die Freiheit, freiwillig den Ort zu wechseln, auch wenn es immer noch die Beschränkung von Zuzugsgenehmigungen für Flüchtlinge gab.