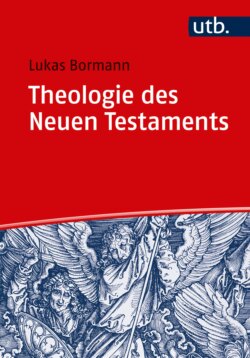Читать книгу Theologie des Neuen Testaments - Lukas Bormann - Страница 8
ОглавлениеDiese Theologie des Neuen Testaments stellt die Gedankenwelt der neutestamentlichen Schriften und ihrer Autoren dar. Sie konzentriert sich dabei auf die Aussagen, die theologisch relevant sind. Für die Bestimmung dieser Relevanz wird als Analysekategorie ein offenes Verständnis von Theologie zugrundegelegt, nach dem Theologie das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch reflektiert. Zugleich werden die Herausforderungen angenommen, die sich einem solchen Projekt innerhalb der selbstreflexiv gewordenen Moderne stellen. An die Wissenschaften werden grundlegende Fragen nach ihrer Legitimität gestellt: Was ist Wissen überhaupt? Welche Funktionen erfüllt dieses Wissen? Welches Versprechen gibt es den Wissbegierigen? Diese hermeneutische Situation hat dazu geführt, dass die aktuellsten Theologien des Neuen Testaments (Schnelle, Wright) nicht nur informieren, sondern mit den Konzepten der story und der Meistererzählung die identitätsbildenden Funktionen einer Theologie des Neuen Testaments als Erzählung aufnehmen. Diese Erzählungen geben ihren Lesern und Zuhörern ein Versprechen. Wright sieht das Ziel in einer Kirche, die er als „single, multi-ethnic family promised by God“ bezeichnet. Schnelle hingegen konzentriert sich auf die Liebe als das „Grundprinzip allen Seins“. Beide Aussagen, die eher soziologische bzw. ekklesiologische Wrights und die eher begriffliche bzw. dogmatische Schnelles, treffen eine Auswahl, die vieles, was die neutestamentlichen Autoren theologisch bewegt, unberücksichtigt lässt, z. B. die Fragen nach Gerechtigkeit, Schuld, Strafe und Vergeltung. Der vorliegende Entwurf hat sich deswegen entschieden, einen Vorstellungszusammenhang in den Mittelpunkt zu rücken, der sowohl die neutestamentlichen Texte enger zueinander in Beziehung setzt als auch der Tatsache Rechnung trägt, dass die neutestamentlichen Autoren selbst die „Schrift“, die das Christentum das Alte Testament nennt, als autoritativen und normativen Text sowie als grundlegende Erzählung (primary history) voraussetzen. Aus diesem dem Neuen Testament vorgegebenen Reflexionshorizont der „Schrift“ ragen die Aussagen über die Eigenschaften Gottes in Ex 34,6 bzw. Ps 145,8 u. ö. hervor. Sie werden innerhalb des Alten Testaments immer wieder aufgegriffen, im antiken Judentum reflektiert und von der alttestamentlichen Wissenschaft als „Wesensdefinition Gottes“ (Jeremias, Spieckermann) bezeichnet. Der Diskurs um die Eigenschaften Gottes, der sich vor allem in der Spannung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bzw. zwischen Recht und Liebe bewegt, ist demnach zugleich der Ausgangspunkt wie auch der Zielpunkt, d. h. das Versprechen, dieser Theologie des Neuen Testaments.
Im Rahmen dieses Diskurses verwenden die verschiedenen neutestamenentlichen Schriften Sprachformen und Ausdrucksweisen, die für sie jeweils charakteristisch sind. Die gewählte sprachliche Form und der sprachliche Ausdruck bestimmen und begrenzen die Textaussagen, ihren Bezug zur textexternen Wirklichkeit und ihren Beitrag zur Kommunikation um die theologischen Anliegen. Jesus bevorzugt den Spruch und das Gleichnis, während Paulus dem Argumentationsstil der stoisch-kynischen Diatribe folgt. Das Markusevangelium reflektiert sein theologisches Anliegen als biographisches Narrativ. Matthäus und Lukas greifen das auf, setzen aber mit der Aufnahme jüdischer Diskursformen bzw. der Orientierung an der hellenistischen Fachprosa eigene Akzente. Das Johannesevangelium schlägt wiederum einen ganz anderen Weg ein, indem es die äußere Simplizität seines Sprachgebrauchs bewusst dafür einsetzt, den Leser von der komplexen theologischen These des christologischen Monotheismus zu überzeugen. Die Johannesoffenbarung schließlich entscheidet sich für eine visuelle Kommunikation in Bildern und Vorstellungen, die ganz eigene Möglichkeiten eröffnet, aber auch bestimmte Grenzen setzt.
Der offene Begriff von Theologie, die Reflexion der Darstellungsform einer Theologie, die Orientierung an den Eigenschaften Gottes und die Analyse der gewählten Sprach- und Ausdrucksformen stellen die vier übergreifenden Perspektiven dar, die dieser Entwurf verfolgt.
Der Aufbau und die Gliederung der einzelnen Kapitel folgen der sachlichen Ordnung des gedanklichen Zusammenhangs, der durch die behandelten Themen und neutestamentlichen Schriften gegeben ist. Auf eine schematische Bearbeitung theologischer Topoi (Gotteslehre, Christologie, Soteriologie usw.) wurde verzichtet. Vielmehr wird auf der Grundlage des offenen Theologiebegriffs die Gedankenwelt der jeweiligen neutestamentlichen Schrift oder der hinter diesen Texten stehenden Personen, etwa Jesus und Paulus, in ihrem historischen Kontext dargestellt und analysiert.
Der fortlaufende Text wird an geeigneten Stellen durch im Druck hervorgehobene Zwischenresümees unterbrochen. Diese sollen Grundaussagen des zuvor entfalteten Gedankengangs zusammenfassen, weiterführende Überlegungen anstoßen und das vertiefte sinnerfassende Lesen des Buches unterstützen. Jedes Kapitel bzw. in Kp. 12 die Unterabschnitte schließen mit einem Literaturverzeichnis, das die in den Anmerkungen als Kurztitel notierten Angaben vervollständigt.
Die einzelnen Kapitel werden durch eine bildliche Darstellung eröffnet, deren Bedeutung im Text aufgegriffen und auf die weiteren Ausführungen bezogen wird. Durch die Kombination von bildlicher Darstellung und wissenschaftlichem Text soll dem Leser des Buches die Möglichkeit gegeben werden, eigenständig bedeutsame Zwischenräume wahrzunehmen und Sinndimensionen zu erschließen, die entstehen, wenn visueller Ausdruck und textlich-begriffliche Interpretation nebeneinander stehen und zugleich aufeinander bezogen werden. Die Grafiken sollen auch zum Ausdruck bringen, dass die Texte des Neuen Testaments in historischen Kontexten entstanden sind und in Rezeptionsprozessen überliefert wurden, die für ihr Verständnis bedeutsam sind, aber in diesem Buch nicht ausführlich behandelt werden können. Die gewählten Grafiken sind je für sich so ausdrucksstark und vielschichtig, dass ihre Wahrnehmung auch ein autonomes Seh- und Leseerlebnis ermöglicht. In der Regel wird im Anschluss daran, meist ausgehend von den altkirchlichen Zeugnissen, eine knappe historische Information über die Abfassungsverhältnisse gegeben, um dann in geeigneter Weise jeweils auf die gewählten sprachlichen Formen des neutestamentlichen Überlieferungsträgers oder der jeweiligen Schrift einzugehen. Diese Fragestellungen werden nicht schematisch abgearbeitet, sondern orientieren sich an den jeweiligen Sinn- und Verstehensangeboten, die die Gegenstände der Untersuchung machen.
In Kapitel 1 wird die Forschungs- und Problemgeschichte der Disziplin Theologie des Neuen Testaments dargestellt. Kapitel 2 wendet sich den Grundlagen der neutestamentlichen Schriften zu, die im antiken Judentum liegen. Die neutestamentlichen Autoren reflektieren ihre Überlegungen zum Verhältnis von Gott, Welt und Mensch im Horizont der Überzeugungen und Praktiken des antiken Judentums. Ohne eine Zuordnung der neutestamentlichen Aussagen zu diesem Sinn- und Deutungshorizont sind sie nicht angemessen zu verstehen. Im Verlauf der weiteren Kapitel wird vor allem auf dieses zweite Kapitel durch Verweise immer wieder Bezug genommen, aber auch dort, wo dies nicht ausdrücklich geschieht, wird der Inhalt dieses Kapitels vorausgesetzt. Den internen Verweisen in den Fußnoten ist in Klammern jeweils ein Stichwort über die Thematik, die auf der angegeben Seite behandelt wird, beigegeben, sodass der Leser jeweils entscheiden kann, ob er diesen Sachverhalt im Sinn hat oder ob er ihn nachschlagen möchte. Kapitel 3 befasst sich mit Jesus von Nazareth. Auch in diesem dritten Kapitel werden Überlegungen formuliert, die im weiteren Verlauf des Buches immer wieder aufgegriffen werden. Aufgrund dieses besonderen Charakters enden die drei ersten Kapitel jeweils mit einem Abschnitt zu „Ergebnis und Ausblick“. In diesen abschließenden Passagen sind die Gedanken, die für die Theologie des Neuen Testaments besonders bedeutsam sind, zusammengefasst.
Die Darstellung der Theologie des Paulus erfolgt in den Kapiteln 4 und 5. Dabei werden nicht die einzelnen Paulusbriefe für sich, sondern die sachlichen Zusammenhänge der Theologie des Paulus behandelt. Diese beiden Kapitel setzen zwar mit „Gott und Christus“ (Kp. 4) und „Mensch“ (Kp. 5) unterschiedliche Schwerpunkte, sie sind aber aufgrund des alle Themen der paulinischen Theologie durchdringenden eschatologisch-soteriologischen Interesses des Paulus im Zusammenhang zu lesen. Das Kapitel 6 erläutert die Rezeption und Weiterführung der Theologie des Paulus in der Paulustradition, d. h. in den Deuteropaulinen (Kol, Eph, 2Thess) und in den Pastoralbriefen (1/2Tim; Tit). Die Kapitel 7 bis 11 kommen wieder auf die Jesustradition im engeren Sinn zurück. Die Logienquelle und die Evangelien werden unter besonderer Berücksichtigung ihrer narrativen Gestalt als Jesuserzählungen auf ihre theologischen Aussagen hin interpretiert. Die beiden abschließenden Kapitel 12 und 13 wenden sich dann den übrigen neutestamentlichen Schriften zu, die nicht unmittelbar an die beiden durch Paulus und Jesus vorgegebenen Traditionslinien anknüpfen: Hebräer-, Jakobus-, Johannes- und Petrusbriefe sowie Judasbrief und Johannesoffenbarung.
Im Verlauf werden immer wieder biblische Texte und antike Quellen zitiert. Dadurch sollen zentrale Aussagen in ihrem Wortlaut zugänglich gemacht werden. Auch diese Zitate eröffnen wie das Gegenüber von Bild und Text gedankliche Zwischenräume, indem sie den originalen historischen Ausdruck neben die Interpretationen des Autors stellen. Diese Zitate sind ein wichtiges Korrektiv gegenüber einer allzu integrativ-synthetischen Darstellungsweise. Sie ermöglichen dem Leser ein eigenes Urteil darüber, ob und inwieweit diese Darstellung der Theologie des Neuen Testaments überzeugend und sachgerecht mit ihren Quellen umgeht – und welche Sinndimensionen der antiken Texte unberücksichtigt bleiben und zu eigener Quellenlektüre auffordern. Die Übersetzungen sind an den Stellen, an denen es nicht anders vermerkt ist, eigenständig aus den Originaltexten angefertigt und an Übersetzungen in moderne Sprachen geprüft worden. Zentrale Begriffe sind in den Quellensprachen angeführt. Griechische und hebräische Wörter und Wendungen werden in einer Umschrift, die sich an der Aussprache orientiert, kursiv und dann in griechischen und hebräischen Schriftzeichen gedruckt. Der Text soll ohne Kenntnisse des Griechischen und Hebräischen verständlich sein, dennoch aber darauf hinweisen, dass die dargestellten Gedanken in Zusammenhängen stehen, die sich erst durch die Kenntnis der genannten Sprachen voll erschließen. Im Falle des Koptischen und Aramäischen wird in der Regel nur die lautorientierte Umschrift in Kursivdruck verwendet.
In Zitaten verweisen eckige Klammern auf Auslassungen, die der Autor vorgenommen hat. Runde Klammern hingegen zeigen an, dass er Ergänzungen zum Verständnis des Zitats hinzugefügt hat. Bei Zitaten moderner Autoren sind diese zudem durch das Kürzel „LB“ für den Autor gekennzeichnet. Alle fremdsprachigen Zitate aus der wissenschaftlichen Literatur wurden ins Deutsche übersetzt. Dadurch soll zum einen der Lesefluss erleichtert und zum anderen die grammatikalisch korrekte Einbindung von Begriffen und Wendungen in den deutschen Text ermöglicht werden.
Die verwendeten Abkürzungen orientieren sich an Siegfried M. Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (IATG3), Berlin/Boston 3. Aufl. 2014.