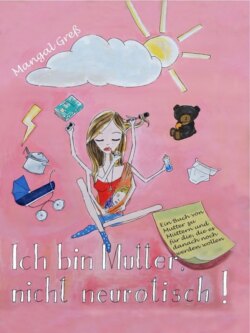Читать книгу Ich bin Mutter, nicht neurotisch! - Mangal Greß - Страница 8
ОглавлениеGuten Rutsch!
Während meiner Schwangerschaft fragte ich mich immer wieder, welche Entbindungsgeschichte ich später wohl anderen erzählen könnte.
Würde es ein lange Geschichte à la Ich lag zwanzig Stunden in den Wehen sein oder eher eine kurze, frei nach dem Motto Es war eine Sturzgeburt? Und mit welchen Adjektiven würde ich dieses Ereignis beschreiben? Um das Wort schmerzhaft würde wohl auch ich nicht herumkommen.
Immer wieder betrachtete ich meinen Bauch mit Neugier und Faszination. Und mit Angst, denn selbst wenn ich doch nicht mehr wollte: Dieses Kind musste irgendwann raus.
Egal wie. Es käme. Nur wie?
Auftakt zur Entbindung
Der Tag des errechneten Termins für die Entbindung verging. Ab jetzt erfüllte mich nur noch Spannung. Wann würde es losgehen?
Als ich eines Nachts auf die Toilette ging, um meine bis zum Rand mit Tee gefüllte Blase zu leeren, vernahm ich ein merkwürdiges Geräusch. Es war, als wäre ein kleiner Gegenstand ins Toilettenwasser gefallen.
Wie von der Tarantel gestochen sprang ich auf und schaute in die Toilette. Wegen des abgedunkelten Badezimmerlichts konnte ich nur schwer etwas erkennen.
Da schwamm doch was auf dem Grund des Toilettenbodens? Irgendein quallenähnliches Zeug.
Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, also führte mich mein Weg am Schlafzimmer vorbei ins Arbeitszimmer.
Als ich die Wörter Schwangerschaft und Schleim in Google eingab, wurde ich von unzähligen Erfahrungsberichten erschlagen. Und wenige Minuten später wusste ich, dass es sich um einen sogenannten Schleimpfropf handeln musste, der sich vor der Entbindung lösen konnte.
Solange meine Tochter nicht gleich hier und jetzt käme, war das in Ordnung für mich. Allerdings fühlte ich mich jetzt wie ein Rennpferd in den Startlöchern.
Ab jetzt konnte es jederzeit losgehen.
Ein paar Tage später ging ich morgens einkaufen. Immer wieder hatte ich das Gefühl, ein wenig auszulaufen. Es war nicht viel Flüssigkeit, die sich in meinen Slip absonderte, aber immerhin doch so viel, dass ich unruhig wurde. Was hatte das noch mal zu bedeuten, fragte ich mich und ließ alle Erfahrungsberichte diverser Mütter Revue passieren.
Zu Hause angekommen, rief ich sofort in der Praxis meines Frauenarztes an. Ich solle vorbeikommen, so die Sprechstundenhelferin. Nein, alles wäre in Ordnung und ich bräuchte mich auch nicht zu beeilen.
Eine dreiviertel Stunde später saß ich wieder einmal mit gespreizten Beinen auf dem Behandlungsstuhl. Alles in Ordnung, bestätigte nun auch der Arzt. Es wäre noch ausreichend Fruchtwasser da, weshalb ich wieder nach Hause gehen könnte.
Also ging ich nach Hause, holte unseren Hund und machte einen langen Spaziergang. Als ich nach dem Spaziergang wieder nach Hause kam, spürte ich, dass ich immer mehr Wasser verlor. Langsam überkam mich ein leichter Anflug von Panik. Was bedeutete das denn jetzt?
Während ich mich umzog, lief das Wasser mittlerweile in immer kürzeren Intervallen meine Beine entlang. Das letzte Mal hatte ich dieses Gefühl gehabt, als ich mir als Kind in die Hose pinkelte, weil ich es nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette geschafft hatte.
Erneut rief ich in der Praxis an. Ich solle in die Klinik fahren. Die könnten mir sagen, wie der Stand der Dinge nun sei.
Irgendwie waren alle entspannt. Also gut, dachte ich, dann versuche ich, es ebenfalls zu sein.
Ich wählte die Nummer meines Mannes und berichtete.
„Ich komme sofort nach Hause und dann fahren wir gemeinsam in die Klinik“, sagte er. In seiner Stimme lag ein feierlicher Unterton. „Deine Kliniktasche hast du ja schon gepackt.“
Das hatte ich. Gedanklich. „Ach, die brauche ich noch nicht“, sagte ich. „Glaub ich wirklich nicht.“
Mein Mann lachte. „Glaub mir, du wirst die Klinik heute nicht mehr verlassen. Also nimm sie mit.“
Und genau in diesem Moment wurde mir bewusst: Es ging los.
Ich packte meine Tasche und versuchte dabei, mich zu erinnern, was im Schwangerschaftsbuch als unbedingt notwendig für den Klinikaufenthalt geraten wurde.
Innerlich verfluchte ich mich ob meiner früheren Gelassenheit. Andere Frauen hatten ihre Kliniktasche vermutlich viel zeitiger, wenn nicht sogar gleich nach dem Schwangerschaftsbefund gepackt.
Richtig ins Schwitzen kam ich, als ich die Kleidung für mein Kind einpacken wollte. Was sollte ich mitnehmen? Sie durfte keinesfalls frieren. Also etwas Warmes, dachte ich, und griff nach einem niedlichen gefütterten Overall, in dem sie – dank der Öhrchen an der Kapuze – wie ein Eisbär aussehen würde. Dann wählte ich einen pink-grau-weiß gestreiften Body, eine rosafarbene Strumpfhose und ein kleines graues Strickjäckchen mit Rosenapplikationen. Schließlich sollte sie für ihren ersten Auftritt in der Welt entzückend aussehen.
3,2,1... meins!
Im Krankenhaus angekommen, verwies man mich auf eine Liege, wo eine sehr freundliche Hebamme den ersten von vielen Tastbefunden machte: „Ah, okay. Es geht los. Ich schließe Sie jetzt an einen Wehenschreiber an und dann schauen wir einfach immer wieder. Alles okay bei Ihnen?“
Klar doch. Hab alles im Griff.
Nach der ersten spürbaren Wehe sah ich das anders. Ich wollte mir nicht ausmalen, wie es in den nächsten Stunden werden würde. Und die Gewissheit, dass ich bald meine Tochter zu sehen bekäme, ließ mich aufgeregter werden.
Die Wehen kamen jetzt immer wieder. Langsam, dennoch spürbar. Um mich abzulenken, schaute ich auf eine an der gegenüberliegenden Wand befestigte Uhr. 19:04 Uhr. Morgen um diese Zeit würde ich bereits ein Kind haben. Alles wirkte sehr surreal auf mich.
Lia kam um 05:40 Uhr zur Welt. Nachdem sich der Muttermund vier Zentimeter geöffnet hatte, bekam ich die PDA, um die ich gebeten hatte. Die Wehen waren somit erträglicher für mich.
Ständig dachte ich, ich müsse aufs Klo, was aber selten tatsächlich der Fall war. Irgendwann setzte man mir einen Blasenkatheter.
Ungefähr sieben Stunden später und nachdem Lia eine Schädelseitenlage aufwies, entschied sich mein Arzt für einen Kaiserschnitt.
Als ich mit meinem Bett in den Operationssaal geschoben wurde, war ich müde, aufgeregt und erleichtert. Jetzt trennten mich nur noch wenige Minuten von meiner Tochter.
Nachdem man mich auf den OP-Tisch gehievt hatte, ließ man einen blauen Vorhang unter meinem Kinn herab. Auch mein Mann nahm nun mit Mundschutz neben mir Platz und streichelte meinen Arm. Obwohl ich meine Beine nicht fühlen konnte, nahm ich wahr, dass man sie hinter dem Vorhang seitlich in Beinablagen ablegte. Als eine OP-Schwester nun auch noch jeweils einen Arm von meinem Körper abspreizte, fühlte ich mich völlig ausgeliefert. Wie ein X lag ich da.
Auf meinem Bauch spürte ich plötzlich einen Druck. Keinesfalls schmerzhaft.
Mein Arzt unterhielt sich mit den OP-Schwestern über ein Abendessen, das er in einem neu eröffneten Restaurant in München zu sich genommen hatte.
Das fand ich tröstlich. Die OP schien also völlig normal zu verlaufen. Es erinnerte mich an das Gefühl, das ich empfand, wenn ich im Flugzeug bei aufkommenden Turbulenzen die Stewardessen beobachtete. Solange diese noch lachten und sich entspannt unterhielten, war auch ich ruhig.
Rückblickend ging alles sehr schnell. Plötzlich hörte ich ein „So, da ist sie!“ und dann wurde mir Lia kurz vor dem Vorhang präsentiert, mir kurz an die Wange gedrückt und dann schon weggetragen.
Romantisch war das nicht. Mein Mann wurde ebenso von meiner Seite abgezogen und durfte, ob er wollte oder nicht, die Nabelschnur durchtrennen. In der Zwischenzeit wurde ich wieder zugenäht.
Die Vorstellung war zu Ende.
Von der Schwangeren zur Mutter
Das war’s jetzt, dachte ich. Sie ist da. Nach zehn Monaten Schwangerschaft. Jetzt ist sie endlich da.
Ich hatte ihr Gesicht gar nicht richtig sehen können, so schnell hatten sie das kleine Bündel wieder davongetragen.
Es fühlte sich alles so unwirklich an und mein Gefühlscocktail aus Euphorie und völliger Benommenheit ließ mich erst einmal kotzen. Zudem zitterte ich so sehr, dass mein ganzer Körper wie ein Nostalgiewecker wackelte. Die Folge des Narkosemittels, so die OP-Schwester erklärend.
Als ich auf mein Zimmer gebracht wurde, konnte ich es gar nicht erwarten, Lia wiederzusehen. Und dann wurde sie mir endlich gebracht. Eingepackt in eine dicke Decke, mit einem weißen Mützchen auf dem kleinen Kopf.
Man legte sie mir nackt auf den Bauch und den Kopf an meine Brust, worauf sie sofort zu trinken begann. Ein wunderbar komisches Gefühl, dachte ich. Wir kennen uns noch gar nicht und schon liegst du hier an meiner Brust und bedienst dich. Ich lächelte verzückt. Sie war so winzig, so süß, so faszinierend. Du warst es also, die ich die ganze Zeit in mir herumgetragen habe.
Mittlerweile hatte man mich mit Lia ganz allein gelassen. Wir beide sollten uns erst einmal ausruhen.
Ich zog meine Bettdecke über unsere Köpfe und beobachtete sie, während sie einschlief.
Was für ein unaussprechliches Wunder.
Ich hatte ein kleines Töchterchen.
Nun war ich Mutter.