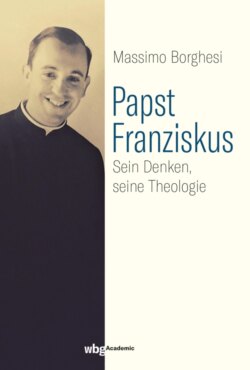Читать книгу Papst Franziskus - Massimo Borghesi - Страница 13
1.5 Das pueblo fiel als »theologische Quelle«
ОглавлениеDie Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl und die Armen einzusetzen, auf der einen Seite, und das Bewusstsein, dass das Königreich in der Welt durch Gottes Pläne verwirklicht wird, auf der anderen: Diese polare Spannung beschäftigte Bergoglio in den 1960er- und 1970er-Jahren. Er sah keine Lösung dafür. Die Unvereinbarkeit zwischen revolutionärem Messianismus und dem antikommunistischen Kreuzzug der Menschen in Uniform war für das antinomische Denken ein nicht enden wollendes Drama. Dieses Drama spaltete auch den Jesuitenorden, dem Bergoglio angehört. In den Spaltungen, die diese Zeit prägten, nahm sein Denken Gestalt an. Ivereigh zufolge lässt sich dies an drei Aspekten erkennen, die mit einer 1976 von ihm durchgesetzten Studienreform am Colegio Máximo in Buenos Aires zusammenhängen, dessen Rektor er damals war.
Er führte das Juniorat wieder ein (d.h. die ein oder zwei Jahre dauernde Grundausbildung in den Künsten und den Geisteswissenschaften) und trennte dadurch Philosophie und Theologie wieder voneinander. Damit schaffte er auch das ab, was er 1990 in einem Brief an Don Bruno als »Melange aus Philosophie und Theologie, die sich ›Lehrplan‹ nennt«, bezeichnet hatte, »wo man als Erstes Hegel studiert (sic!)«. Das neue, von Bergoglio eingeführte Juniorat ermöglichte es den Studenten, sich in der Tradition der argentinischen Jesuiten zu verwurzeln anstatt in Modellen aus dem Ausland. Zum Studium gehörten nicht nur europäische Klassiker, sondern auch die argentinische Literatur, alles von El gaucho Martín Fierro bis Borges. Der Geschichtskurs war insofern revisionistisch, als er die katholischen, hispanischen und frühjesuitischen Elemente der argentinischen Vergangenheit wieder ausgrub, die in der liberalen Geschichte ignoriert oder gar verachtet worden waren. Bergoglio wollte, dass die Jesuiten die religiösen Traditionen des Volkes ebenso wertschätzten wie die Hochkultur, kurz: dass sie nicht nur Eisenbahnen und Telegrafen, sondern auch Gauchos und Caudillos kannten.108
Durch diese Reform wollte Bergoglio dem historisch-kulturellen Hintergrund des Landes seine Würde zurückzugeben. Denn dieser fristete ein Dasein im Schatten der Soziologie und ihrer Ansätze, die – befeuert durch den Einfluss modernisierender, amerikanisierender und marxistischer Strömungen – eine gewisse Dominanz entwickelt hatten. Die Reform richtete sich zudem gegen eine Vermischung von Theologie und Philosophie, von Natürlichem und Übernatürlichen, die, wie bereits deutlich geworden ist, die Grundlage von Gutiérrez’ Befreiungstheologie war. Außerdem reagierte sie auf die Prävalenz Hegels und des Hegelianismus in den philosophischen Studien der 1970er-Jahre, deren logische Konsequenz der Marxismus war.
Dass Bergoglios Reformprogramm sich den »religiösen Traditionen des Volkes« zuwandte, hatte mit Folklore oder altertümelnden Vorlieben nichts zu tun. Vielmehr ist es auf den starken Einfluss der teología del pueblo zurückzuführen, die als der wohl wichtigste Beitrag anzusehen ist, den die Schule vom Río de la Plata zur Befreiungstheologie leistete. Dieser Theologie folgend forderte Bergoglio die Studenten des Colegio Máximo im zweiten Punkt seiner Reform dazu auf, in die Arbeiterviertel zu gehen, um mit den Kindern zu spielen, Katechismusunterricht zu geben und dadurch die Probleme der Familien besser zu verstehen. »Der missionarische Dienst an den Armen, den sie an den Wochenenden in den örtlichen Nachbarschaften verrichteten, sollte den jesuitischen Studenten helfen, eine Verbindung zum santo pueblo fiel de Dios, dem ›heiligen, Gott ergebenen Volk‹ zu knüpfen und den Bezug zur Realität nicht zu verlieren.«109 Das Eintauchen in die Realität geht auf ein Missionskonzept zurück, das eine Einheit von Theorie und Praxis forderte und eher christlich als marxistisch formuliert war. Eine Reform, an der die bevorzugte Option für die Armen, die die Kirche Lateinamerikas 1968 auf der Medellín-Konferenz formuliert hatte, nicht spurlos vorbeigegangen war.
Bergoglios Reform forderte drittens eine Rückkehr zu den Quellen der Spiritualität des Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens. Seit seinem Theologiestudium am Colegio Máximo in den Jahren 1967 bis 1970 stand Bergoglio seinem Philosophieprofessor Miguel Ángel Fiorito sehr nahe, der sich dafür stark machte, die ursprüngliche Methode zur Durchführung der Geistlichen Übungen wiedereinzuführen. Der Austausch mit Fiorito war für Bergoglio von besonderem Wert: Er schärfte seine innere, »mystische« Seite, die auf die anthropologische und naturalistische Herabsetzung christlichen Engagements in der Welt reagierte, wie sie etwa von den neuen politischen Theologien artikuliert wurde. Die Voraussetzung für das primerea der Gnade des Heiligen Geistes über Werke und Regeln, von denen er später als Papst sprechen sollte, liegt in der Überzeugung, dass ein Christ umso aktiver wird, desto passiver er in Bezug auf die Gegenwart und das Handeln Gottes ist.
Was hinter Bergoglios Reform stand, ist daher offensichtlich: Er reagierte auf eine verbreitete soziologische und praxistische Tendenz, die sowohl den Jesuitenorden als auch die Kirche veränderte und sie in den todbringenden Kampf innerhalb einer gespaltenen Gesellschaft hineinzog. Es ging ihm darum, den Glauben an das Evangelium wieder in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig zu vermeiden, dass die Kirche – die allzu anfällig war für die Wünsche von Regierung und Militär – aus der Welt und in den Spiritualismus floh. Zwei entscheidende Faktoren waren Voraussetzung für diese Reform: das Konzept des »gläubigen Volkes« und die Theorie der vier Prinzipien der Wirklichkeit (wobei es sich damals noch um drei Prinzipien handelte).
Hinsichtlich des ersten Faktors war Bergoglio, wie bereits erwähnt, der teología del pueblo, der Theologie des Volkes verpflichtet. Zu deren Anhängern gehörten zahlreiche argentinische Theologen und Denker, darunter Lucio Gera, Rafael Tello, Justino O’Farrell, Gerardo Farrel, Fernando Boasso und Juan Carlos Scannone.110 Vor allem Lucio Gera (1924–2012) spielte eine tragende Rolle.111 Der Jesuit Scannone beschrieb die Entstehung der argentinischen Theologie des Volkes folgendermaßen:
Gleich nach seiner Rückkehr vom II. Vatikanischen Konzil schuf das argentinische Episkopat 1966 eine bischöfliche Pastoralkommission (die COEPAL) mit der Aufgabe, einen pastoralen Gesamtplan für Argentinien vorzubereiten. Sie setzte sich aus drei Bischöfen, Theologen, Pastoraltheologen und Ordensleuten zusammen, darunter die oben erwähnten Gera und Tello zu nennen sind, die als Weltpriester Theologieprofessoren an der Theologischen Fakultät in Buenos Aires tätig waren. In dieser Pastoralkommission waren außerdem die Weltpriester Justino O’Farrell, früher Orionit, Professor für Soziologie an der Universität Buenos Aires, Gerardo Farrell, ein Experte in kirchlicher Soziallehre, der Jesuitenpater Fernando Boasso, der am Zentrum für Soziale Forschung Aktion der Gesellschaft Jesu arbeitete, sowie andere Mitglieder, unter diesen auch drei Ordensfrauen. In dieser Kommission wurde die Theologie des Volkes geboren, deren Siegel bereits die Bischöfliche Erklärung von San Miguel (1969) – inesbondere das VI. Dokument über die Volkspastoral –, trägt. Denn diese Erklärung versucht, die Dokumente der lateinamerikanischen Bischofsvollversammlung von Medellín (Kolumbien, 1968) auf Argentinien zu übertragen. Obwohl diese Pastoralkommission schon Anfang 1973 nicht mehr bestand, trafen sich einige ihrer Mitglieder unter der theologischen Führung von Gera auch später noch regelmäßig. Dieser hatte als Experte beim Konzil und in Medellín, und später in Puebla gedient […] Seine Theologie war eher mündlich als schriftlich, obwohl er wichtige Schriften verfasste und seine Vorträge oft aufgenommen und nachgeschrieben worden sind. Später nahm ich selbst an den genannten Treffen teil, zusammen mit Gera, Farrell, Boasso, dem jetztigen Generalvikar von Buenos Aires, Weihbischof Joaquín Zucunza, und dem uruguayschen Laientheologen, Philosophen und Historiker Alberto Methol Ferré.112
Die Einsetzung der Kommission durch die argentinischen Bischöfe war also maßgeblich für den Durchbruch der Theologie des Volkes verantwortlich. Deren erstes Dokument war die Erklärung von San Miguel.
Ein Teil des Dokuments, den Pater Lucio Gera verfasst hatte, begründete eine typisch argentinische Variante der Post-Medellín-Theologie, die Bergoglio und andere ihm nahestehende Jesuiten stark prägte. Obwohl es zu Gerechtigkeit aufrief, Unterdrückung und Ausbeutung geißelte und sich für die Rechte der Arbeiter stark machte, lehnte das Dokument den Marxismus ab und bezeichnete es als etwas, das ›nicht nur im Widerspruch zum Christentum, sondern auch zum Geist unseres Volkes steht‹. Diese Sichtweise war sicherlich nicht konservativ oder vorkonziliar; el pueblo wurde jedoch auch nicht soziologisch und marxistisch gestaltet, wie es die Befreiungstheologen taten. Die Erklärung von San Miguel sah den Einzelnen als aktiven Akteur seiner eigenen Geschichte. Überraschenderweise wurde festgehalten, dass »die Tätigkeit der Kirche nicht nur auf das Volk ausgerichtet sein solle, sondern sie solle auch und vor allem aus dem Volk entstehen«. Die Erklärung stellte sich also eine Kirche mit einer klaren Option für die Armen vor, im Sinne einer radikalen Identifikation mit den einfachen Menschen als Protagonisten ihrer eigenen Geschichte und nicht als »Klasse«, die im sozialen Kampf mit anderen Klassen steht. Bergoglio teilte diese Sichtweise der Erklärung von San Miguel.113
Die Theologie des Volkes war keine »konservative« Alternative zur Befreiungstheologie, sondern eine Befreiungstheologie ohne Marxismus. Scannone erinnerte sich:
In einem Artikel von 1982 unterschied ich vier verschiedene Strömungen innerhalb der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung, in welche ich die von Juan Luis Segundo kritisch und von Sebastián Politi löblich bezeichnete »Theologie des Volkes« einbezog. Der Vater der Befreiungstheologie, der peruanische Theologe Gustavo Gutiérrez, nimmt sie als eine »Strömung mit eigenen Grundzügen innerhalb der Befreiungstheologie« an, und sein Schüler, der mexikanische Jesuit Roberto Oliveros, weist sie als eine Tendenz derselben Theologie zu, bezeichnet sie jedoch als »populistisch«. Als 1984 der spätere Kardinal Quarracino – damals Generalsekretär des CELAM – in Rom die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über die Theologie der Befreiung öffentlich vorstellte, unterschied er die vier von mir differenzierten Strömungen. Nachher machten sowohl Befreiungstheologen wie Joao Batista Libanio als auch einige ihrer Gegner wie Kardinal Lucas Moreira Neves dieselbe Unterscheidung.114
Scannone verwies in seinem Artikel auf einen Aufsatz Methol Ferrés von 1982, der zwei Strömungen der Befreiungstheologie ausgemacht hatte:
Der Peruaner Gustavo Gutiérrez war es, der den Begriff ›Befreiungstheologie‹ einführte. Er ist auch der Hauptarchitekt dieser Verbindung von Theologie und Marxismus. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Version der Befreiungstheologie, die der Theologie der Säkularisierung diametral gegenübersteht. Sie entstand, als sich in Argentinien eine große nationale und populäre Bewegung bildete, die schließlich in der Rückkehr Peróns kulminierte. Ausgehend von Medellín kam es dabei zu einer Vertiefung der Seelsorge des Volkes und der Freikauf/die Erlösung der Volksreligiosität begann, die mit dem Problem der Befreiung in Verbindung gebracht wurde. In Lucio Gera finden wir den typischsten Ausdruck davon. Diese beiden Tendenzen der Befreiungstheologie stellten mit ihren Interpretationen eine wachsende Opposition dar und fanden in Lateinamerika ein breites Spektrum an Ausgestaltungen und Mittelpositionen.115
Als Gustavo Gutiérrez 1988 eine neue Auflage seines Werkes Theologie der Befreiung mit einer vollständig überarbeiteten Fassung des Kapitels »Glaube und gesellschaftlicher Konflikt« vorlegte, wurde deutlich, wie sehr er die Theologie des Volkes schätzte. In der neuen Einleitung, betitelt »In die Zukunft blicken«, bekannte Gutiérrez, dass sich in den 17 Jahren, die seit dem Erscheinen der ersten Auflage vergangen waren, seine Sicht der Armen und ihrer Welt eklatant verändert hatte:
Was uns betrifft, war dies die wichtigste, ja die bedrückendste Erfahrung dieser Jahre. Denn in Wirklichkeit geht es um ein ganzes Universum, in dem der sozioökonomische Aspekt, wenn auch fundamental, nicht das einzige ist. Armut bedeutet letztlich Tod: kein Brot auf dem Tisch, kein Dach über dem Kopf, keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse in Sachen Gesundheit und Erziehung auch nur einigermaßen befriedigt zu sehen, Ausbeutung der Arbeitskraft […] Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht vergessen, daß Armut nicht allein Mangel dieser oder jener Art ist. Oft genug haben die Armen nämlich eine eigene Kultur mit spezifischen Werten. Arm zu sein ist eine besondere Art, zu leben, zu denken, zu lieben, zu beten und zu hoffen.116
Für Gutiérrez war die Erkenntnis dieser zweiten Dimension ein Novum: »Andererseits bleibt bei einer Aufwertung des kulturellen Gesichtspunktes auch die ökonomische Seite nicht unberührt – und umgekehrt wohl auch.«117 Dank dieser Erkenntnis begriff er die Bedeutung der von ihm zuvor nicht berücksichtigten religiösen Dimension der Kultur eines Volkes. Bis dahin war sie für ihn nicht mehr als ein vormodernes, von der Aufklärung geprägtes Überbleibsel gewesen. Zu dieser Dimension gehört auch das Gebet – ein zentraler Aspekt im Leben vieler Armen.
Christliches Leben als Ja zur Gabe des Reiches Gottes ist nicht nur Aufgabe, sondern auch Gebet. Ohne betrachtende Dimension kein Glaubensleben. Die Lateinamerikaner sind ein Volk, das für Gerechtigkeit kämpft, zugleich aber auch glaubt und hofft; das unterdrückt und zugleich christlich ist und, wie Maria im Magnifikat, ein Gespür für Dank und Hingabe an Gott hat.
Betende Praxis ist es, was den Glauben unseres Volkes auszeichnet. Lateinamerikaner haben eine Form zu beten, welche modernes Denken allzu leicht für primitiv, wenn nicht für abergläubisch hält. […] Tief verankert in dieser Volksfrömmigkeit und sich zugleich speisend aus deren Potential des Protests gegen Unterdrückung wie auch des Strebens nach Freiheit, besitzt das Gebetsleben der im Befreiungsprozeß engagierten christlichen Gemeinden eine außerordentliche Kreativität und Tiefe. Wer immer gesagt hat, in Lateinamerika gehe derzeit der Sinne für das Gebet verloren, beweist damit nur, wie weit er vom töglichen Leben der kleinen, aber engagierten Leute unseres Volkes weg ist.118
Gutiérrez kam hier zu einem ganz anderen Schluss als zuvor: Er stürzte die theoretische, pro-marxistische Haltung der ursprünglichen Befreiungstheologie und brachte sie in Einklang mit der argentinischen teología del pueblo: »Und das bedeutet echte Spiritualität, will sagen: die angezeigte Form, Christ zu sein. Gerade die Verbindung dieser beiden Dimensionen – Gebet und Engagement – macht das aus, was wir Praxis nennen. Hier liegt der Quellgrund der Theologie der Befreiung.«119 Indem diese nun auf »die unumgängliche und befruchtende Verbindung zwischen Orthopraxis und Orthodoxis« verwies,120 bekenne sie offen, dass der Glaube vor den Werken steht: »Ihre letzten Kriterien schöpft die Theologie aus der geoffenbarten Wahrheit; und diese finden wir im Glauben und nicht in der Praxis.«121
Das überarbeitete Vorwort von 1988 zur neuen Auflage von Die Theologie der Befreiung skizzierte, unter welchen Bedingungen die Begegnung mit der teología del pueblo stattfinden konnte. Gutiérrez, der nun die hohe Bedeutung des Volksglaubens, des Gebets und des Dialogs mit der lateinamerikanischen »Kultur« in all ihren Ausprägungen erkannte, wandte sich vom marxistischen Konzept des Vorrangs von Praxis und revolutionärer (Gegen-) Gewalt ab. Dieser »Umschwung« bestätigt, dass die Theologie des Volkes zu Recht als eine Form der Befreiungstheologie verstanden wird. Ferner zeigt er, dass eine Volksfrömmigkeit, die von jeglichem »Devotionalismus« und allen Vorurteilen, die man aus aufgeklärter Sicht vorbringen könnte, befreit ist, ein locus theologicus ist – der Beweis für eine spezifisch lateinamerikanische Inkulturation des Glaubens.122 In der Eröffnungsansprache vor einer Versammlung der Jesuiten der argentinischen Provinz am 18. Februar 1974 hielt Bergoglio fest:
Wichtiger erscheint es jedoch, anzuerkennen, was für ein Reservoir an Religiosität das pueblo fiel, das gläubige Volk, ist, etwas, das wir argentinischen Jesuiten nun langsam erkennen. Ich möchte, ganz ungeschützt, erklären, was ich meine, wenn ich vom pueblo fiel spreche: Ich beziehe mich ganz einfach auf die Gläubigen, auf jene, mit denen wir in unserer priesterlichen Berufung und in unserem religiösen Zeugnis am meisten Kontakt haben. Mir ist klar, dass der Begriff pueblo hier bei uns mehrere Bedeutungen hat, was mit den verschiedenen ideologischen Konzepten zu tun hat, mit denen man die Realität des Volkes beschwört oder empfindet. Ich rede daher einfach vom gläubigen Volk (pueblo fiel). Als ich Theologie studierte, als ich wie ihr zur Vorbereitung meiner Abschlussarbeit den Denzinger und wissenschaftliche Abhandlungen durcharbeitete, fiel mir eine Formulierung der christlichen Tradition ins Auge: das gläubige Volk ist »in credendo«, in dem, was es glaubt, unfehlbar. Hier habe ich meine ganz persönliche Formel abgeleitet, die zwar nicht sehr präzise ist, mir aber sehr hilft: Wenn du wissen willst, was die Mutter Kirche glaubt, wende dich an das Lehramt – es hat die Aufgabe, die Lehre der Kirche auf unfehlbare Weise zu verkünden. Wenn du aber wissen willst, wie die Kirche glaubt, halte dich an das gläubige Volk. Das Lehramt sagt dir, wer Maria ist, aber das gläubige Volk zeigt dir, wie man Maria liebt. Unser Volk besitzt eine Seele, und weil wir von der Seele eines Volkes sprechen, können wir auch von einer Hermeneutik sprechen, von einer Weise, die Wirklichkeit zu sehen, von Gewissen. In unserem argentinischen Volk sehe ich ein starkes Bewusstsein der eigenen Würde. Es ist ein historisches Bewusstsein, das sich nicht aus einem Wirtschaftssystem ableitet (z.B. würde sich das argentinische Volk nicht in den »abstrakten« Kategorien Bourgeoisie und Proletariat wiederfinden), sondern das sich durch eine Reihe von Meilensteinen entwickelt hat. Es ist nicht das Ergebnis einer »Theorie«, sondern eher eines Lebens, das christliche Wurzeln hat.123
Diese Einschätzung des späteren Papstes ist von großer Bedeutung. Sie zeigt, dass sich die Kategorie des pueblo fiel deutlich von den populistischen Ideologien sowie auch vom marxistischen System abhebt, das auf die »abstrakten« Kategorien Bourgeoisie und Proletariat festgelegt ist. Das Konzept vom gläubigen Volk verweist auf die historische Art und Weise, wie der Glaube das Leben, die Realität und die Kultur belebt; es weist auf das wie der Inkarnation hin. Es geht dabei weder um Wissenschaft noch um Soziologie, sondern um den historischen, belebten Nährboden des Glaubens der Kirche. Es ist der Ort einer Hermeneutik von Symbolen: »Wenn es wahr ist, dass wir uns selbst in unseren Symbolen erkennen, dann ist unser Volk eine fruchtbringende Kinderstube für eine solche Erkenntnis. Unser Volk, das der Lehre der Kirche treu ist, das Volk, das seine Kinder taufen lässt, das Maria liebt, das sich nicht für das Kreuz schämt und das darin sowohl das Holz, das zum Stab des Hirten wird und ihn begleitet, als auch den Baum erkennt, der ewige Früchte trägt«.124 Die Kirche als Institution gibt nicht nur; sie empfängt auch. Aus diesem Grund sagte Bergoglio als Papst (eingedenk der Worte Lucio Geras): »[N]ur aus der affektiven Konnaturalität, die die Liebe gibt, können wir das theologische Leben in der Frömmigkeit der christlichen Völker, insbesondere in den Armen, schätzen«.125
Indem das Thema Volksfrömmigkeit das Thema Spiritualität durchläuft, wird es theologisch. Der christliche Glaube des Volkes ist ein locus theologicus, ein hermeneutischer locus eines gelebten, »inkulturierten« Glaubens. Die Spiritualität des Volkes ist Kultur, ein organisches Netz, das alle Aspekte der Existenz miteinander verknüpft. Im Dokument von Puebla heißt es: »Die katholische Volksweisheit hat eine große Fähigkeit zur Lebenssynthese. So führt sie in schöpferischer Weise Göttliches und Menschliches, Christus und Maria, Geist und Leib, Gemeinschaft und Institution, Person und Gemeinschaft, Glauben und Vaterland, Verstand und Gefühl zusammen. Diese Weisheit ist ein christlicher Humanismus, der unzweideutig die Würde eines jeden Menschen als Kind Gottes betont, eine grundsätzliche Brüderlichkeit begründet und lehrt, der Natur zu begegnen, die Arbeit zu verstehen, und Anlaß für Freude und Humor, auch inmitten eines sehr harten Lebens, zu finden.«126 Bezugnehmend auf diese Passage schrieb Bergoglio:
Die Spannungen, die das Dokument [von Puebla] erwähnt – das Göttliche und das Menschliche, Geist und Leib, Gemeinschaft und Institution, Person und Gemeinschaft, Glauben und Vaterland, Verstand und Gefühl – sind universal. Die Lebenssynthese, die kreative Aufhebung dieser Spannungen, die sich nicht in Worte fassen lässt, weil alle Worte dazu notwendig wären, dieser symbolische und lebendige Kern – der sich für unser Volk in »Eigennamen« wie Guadalupe und Luján, im pilgernden Glauben, in Gesten des Segens und der Solidarität, in Opfer, Lied und Tanz ausdrückt… – dieses Herz, in dem und dank dessen unser Volk liebt und glaubt, ist der theologische Ort, in den der Prediger sich und sein Leben hineinstellen muss.127
Das Herz des Volkes ist die unerlässliche Synthese der vom Geist, einem locus theologicus, umfassten Spannungen des Lebens. Keine Theorie und kein Doktrinarismus hat das Recht, dieses Herz zu brechen. »Daher«, sagte Bergoglio 1974, »müssen unsere aufrichtigsten Bemühungen um Befreiung die Einheit über den Konflikt stellen, denn nur dann wird man verstehen, dass der Feind teilt, um zu herrschen. Es geht um das Konzept einer ›Nation‹ und nicht die Einrichtung einer Klasse. […] Unser gläubiges Volk trennt seinen christlichen Glauben nicht von seinen geschichtlichen Projekten, aber es vermischt sie auch nicht mit einem revolutionären Messianismus. Dieses Volk glaubt an die Auferstehung und das Leben: es tauft seine Kinder, und es begräbt seine Toten. Und es bittet. Wofür? Gesundheit, Arbeit, Brot, ein gutes Einvernehmen im Kreis der Familie, für das Vaterland, um den Frieden. Manche denken, das sei nichts Revolutionäres. Aber dasselbe Volk, das um den Frieden bittet, weiß zur Genüge, dass dieser die Frucht der Gerechtigkeit ist.«128
En passant führte Bergoglio hier eines seiner vier Prinzipien ein: Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt. Er tat es im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Einheit eines Volkes vor denen zu schützen, die für Spaltung sorgen. Die teología del pueblo wahrte die Grundwerte der Befreiungstheologie – die bevorzugte Option für die Armen und den Kampf um Gerechtigkeit –, verwarf aber ihre gewaltbereite Seite, die der marxistischen Lehre entlehnt war.129 Durch die Schule vom Río de la Plata, deren Erkenntnisse Paul VI. in »Evangelii nuntiandi« (1975) aufgriff und die dadurch auch im Abschlussdokument der Konferenz von Puebla (1979) aufgegriffen wurden, wurde das Thema Volksreligiosität zu einem festen Bestandteil der lateinamerikanischen Theologie: »Aus dieser Perspektive kann die Volksreligiosität als eine der wenigen Ausdrucksformen der kulturellen Synthese Lateinamerikas betrachtet werden – ohne deswegen andere auszuschließen –, die all seine Epochen durchzieht und zugleich all seine Dimensionen abdeckt: die Arbeit und die Produktion, die Orte der Besiedlung, die Lebensstile, die Sprache, die Ausdrucksformen der Kunst, die politische Organisation, das Alltagsleben. Und gerade in ihrer Rolle als Reservoir der kulturellen Identität hat sie die Versuche der Moderne überstanden, die einzelnen Kulturen dem Diktat der Vernunft zu unterwerfen.«130
1 A. SPADARO, Interview, S. 73.
2 J. M. BERGOGLIO, Vorwort zu E.C. BIANCHI, Pobres, S. 21.
3 A. IVEREIGH, Reformer, S. 76.
4 A. SPADARO, Interview, S. 74.
5 A. IVEREIGH, Reformer, S. 92.
6 Zur »ignatianischen« Prägung Bergoglios vgl. A. SPADARO, Vorwort zu J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Cuore, S. v-xxx.
7 P. Jorge M. Mejía (1923-2014) war Herausgeber der Zeitschrift Criterio, von 1957 bis 1978 gemeinsam mit Gustavo J. Franceschi, von 1978 bis 1990 allein. Am 21. Februar 2001 wurde er von Johannes Paul II. zum Kardinal erhoben.
8 P. Maurice Giuliani leitete von 1954 bis 1962 die Zeitschrift Christus und war später Herausgeber der Zeitschrift Études. Von 1965 bis 1972 wear er Regionalassistent der Gesellschaft Jesu für Frankreich und Berater des Generaloberen Pedro Arrupe. Vgl. M. GIULIANI, Esercizi.
9 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 29. Januar 2017.
10 A. SPADARO, Interview, S. 36.
11 G. FESSARD, Dialectique.
12 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 29. Januar 2017.
13 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 3. Januar 2017.
14 Vgl. G. FESSARD, Interprètes, neu herausgegeben in G. FESSARD, Hegel. Zur Freundschaft zwischen Fessard und Kojève vgl. M. FILONI, Filosofo, S. 199-203. Interessant ist, woran Stanley Rosen sich erinnert: »Die bei weitem wichtigste Bekanntschaft in Royaumont war für mich die bemerkenswerte Persönlichkeit von Pater Gaston Fessard S.J. Fessard ist nicht nur an sich sehr wichtig; er war auch einer der engsten Freunde Kojèves, vielleicht sein engster Freund in Paris. […] Fessard war in Frankreich auch bekannt für seine Pamphlete, die er während des Zweiten Weltkriegs unter dem Pseudonym Monsieur X. gegen die Nazis geschrieben hatte. Von all seinen religiösen und theologischen Auseinandersetzungen möchte ich nur an seine lange Polemik gegen die Arbeiterpriester-Bewegung erinnern. Er war in keiner Weise ein Marxist, wurde aber zugleich von Kojève als die potentiell höchste Instanz zu Marx in ganz Frankreich angesehen. […] Fessard vereint in sich meiner Meinung nach die Tugenden eines Priesters und eines Philosophen auf geradezu vollkommene Weise. Man hatte mir beigebracht, dass eine solche Kombination prinzipiell unmöglich sei. Fessard aber belehrte mich eines Besseren. In der Klarheit und Lebendigkeit seines Intellekts, in der Fähigkeit, Ansichten, die seinen eigenen Überzeugungen fremd waren, sofort aufzunehmen, und in dieser eigentümlichen Kombination aus Tiefgründigkeit und kindlicher Einfachheit, die hochrangige Denker auszeichnet, übertraf Fessard alle, die ich in Paris traf – mit der Ausnahme von Kojève. Man könnte sagen, dass Fessard Christus akzeptierte, während Kojève nur sich selbst akzeptierte. Aber mit jeder Faser ihres geistigen Wesens versuchten sie beide, ihrem Glauben einen logos zu geben« (S. ROSEN, Metaphysics). Auch Augusto Del Noce zufolge war Fessard der »scharfsinnigste französische Kritiker und Kommentator des Marxismus« (A. DEL NOCE, Problema, S. 561-562, Anm. 16).
15 G. FESSARD, Actualité.
16 A. DEL NOCE, Problema, S. 128, Anm. 89.
17 Ebd., S. 293, Anm. 1.
18 G. NGUYEN-HONG, Verbe, S. 62.
19 P. HENRICI, Descendance, S. 317.
20 G. FESSARD, Dialectique, S. 6.
21 Vgl. M. CASTRO, Bouillard. Zum Einfluss Blondels auf Henri de Lubac vgl. A. RUSSO, Lubac (zum Einfluss Blondels auf Fessard vgl. S. 102-104); G. MORETTO, Destino; G. COFFELE, Apologetica.
22 P. HENRICI, Descendance, S. 317.
23 Vgl. É. FOUILLOUX, Église, vor allem das Kapitel »Des Jésuites blondéliens« (S. 174-181).
24 J. C. SCANNONE, »La filosofia dell’azione di Blondel e l‹agire di papa Francesco«, in La Civiltà Cattolica 3969, 2015, S. 216. Juan Carlos Scannone, Dekan der Philosophischen Fakultät der Universidad del Salvador (Buenos Aires/San Miguel) und Vizepräsident der Argentinischen Theologischen Gesellschaft, war der Griechischund Literaturprofessor des Seminaristen Bergoglio. Er wurde an der LMU München mit einer Dissertation über Sein und Inkarnation. Zum ontologischen Hintergrund der Frühschriften Maurice Blondels (Freiburg-München: Alber 1968) promoviert.
25 J. C. SCANNONE, »La filosofia dell’azione di Blondel e l‹agire di papa Francesco«, in La Civiltà Cattolica 3969, 2015, S. 216-233. »Die Philosophie des erstgenannten [Blondel] erhellt die theologische Tiefe des pastoralen Wirkens des letztgenannten [Bergoglio], und letzteres zeigt in der Praxis den christlichen menschlichen Wert des Denkens Blondels« (ebd., S. 233).
26 M. Á. FIORITO, OPCIÓN; DERS., Teoría. Auf die beiden Aufsätze wird verwiesen in J. M. BERGOGLIO, »Farsi custodi dell’eredità« (Juni 1981), it. Übersetzung in J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Cuore, S. 282, Anm. 4.
27 M. Á. FIORITO, Opción, S. 43-44.
28 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Cuore, S. 282, Anm. 4. Hervorhebung durch den Verfasser.
29 Vgl. G. FESSARD, Dialectique, S. 210ff.
30 M. Á. FIORITO, Teoría, S. 350-351, zit. nach J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Cuore, S. 282, Anm. 4.
31 A. SPADARO, Interview, S. 32. Zum Epitaph des Ignatius vgl. J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Circostanze. Am 14. Mai 1978 verwies der Generalobere Pedro Arrupe in einem an die gesamte Gesellschaft Jesu gerichteten Brief zur Inkulturation auf dieses ignatianische Motto: »Der ignatianische Geist wird manchmal durch folgenden Satz zusammengefasst: ›Non cohiberi a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est‹. In unserem Zusammenhang sollte uns dieses Prinzip zu einer lokalen Konkretisierung bis ins Kleinste herausfordern, ohne jedoch auf die Größe und Universalität menschlicher Werte zu verzichten, die keine Kultur, auch nicht deren Komplexität, in vollkommener und erschöpfender Weise aufnehmen und verkörpern kann« (P. ARRUPE, Schreiben an die ganze Gesellschaft über die Inkulturation in »Acta Romana«, xvii (1978), online zugänglich unter http://www.sufueddu.org/fueddus/inculturazione/0708/04_2_arrupe_inculturazione_oss_.pdf letzter Zugriff 13. Juli 2017). Mit der ignatianischen Grabschrift befasste sich neben Fessard auch H. RAHNER; vgl. H. RAHNER, Grabschrift.
32 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 29. Januar 2017. Leider lässt sich der Autor des vom Papst erwähnten Werkes nicht ermitteln. Der einzige Titel, der annähernd in Frage kommt, ist B. WALD, »Theologie des ›als ob‹. Das Dilemma nichtrealistischer Selbstdeutungen des christlichen Glaubens«, Nachwort zu J. PIEPER, Werke, 7: Religionsphilosophische Schriften, Hamburg: Felix Meiner Verlag 2000, S. 627-633. Es handelt sich jedoch nicht um ein Buch, sondern um ein Nachwort, das erst kürzlich erschienen ist. Es kann sich also nicht um das »Büchlein« handeln, von dem der Papst hier spricht.
33 Mitteilung des Sekretärs von Papst Franziskus vom 12. März 2017.
34 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 13. März 2017, 15:57 Uhr.
35 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 13. März 2017, 12:12 Uhr.
36 H. VAIHINGER, Philosophie.
37 K.-H. CRUMBACH, Wort, S. 321.
38 Ebd., S. 321-322. Vgl. überdies H. RAHNER, Ignatius.
39 K.-H. CRUMBACH, Wort, S. 322.
40 Ebd., S. 322-323.
41 Ebd., S. 323.
42 Ebd.
43 Ebd., S. 324-325.
44 Ebd., S. 328.
45 Im 20. Jahrhundert erschienen zahlreiche Interpretationen der Geistlichen Übungen des heiligen Ignatius. Vgl. M. Schneider, Unterscheidung.
46 Das Grundlagenwerk zum »Deus semper major« in den Übungen des heiligen Ignatius ist E. PRZYWARA, Deus.
47 Y. CONGAR, Réforme.
48 A. IVEREIGH, Reformer. S. 93-94.
49 Ebd., S. 74-75.
50 Ebd., S. 27-28. Zum Verhältnis zwischen Perón und der Kirche in dieser Phase vgl. L. CAIMARI, Perón.
51 A. IVEREIGH, Reformer, S. 30.
52 Ebd., S. 142. Zu Bergoglios Einsatz für die Opfer der Militärrepression vgl. N. SCAVO, Lista.
53 Vgl. J. C. SCANNONE, Teología.
54 G. GUTIÉRREZ, Theologie.
55 Ebd., S. 195.
56 Ebd., S. 196.
57 Zur politischen Theologie bei Metz und Moltmann vgl. M. BORGHESI, Critica, S. 203-245.
58 G. GUTIÉRREZ, Theologie, S. 41.
59 A. IVEREIGH, Reformer, S. 30.
60 Ebd., S. 71.
61 Vgl. D. JAMES, Resistance.
62 A. IVEREIGH, Reformer, S. 97. Vgl. MUGICA, Peronismo.
63 PAPST FRANZISKUS, Himmel, S. 216-217.
64 »Innerhalb der USAL gab es drei politische Strömungen und jede hatte ihren eigenen jesuitischen Geistlichen. Die konservative Strömung war der Militärdiktatur Juan Carlos Onganías zugetan und sah sie als Bollwerk gegen den Kommunismus; ihre Bezugsperson war Pater Alfredo Sáenz. Die zweite Strömung stand auf der Seite der Montoneros, die für eine bewaffnete Revolution eintraten; Pater Alberto Sily stand an ihrer Spitze. Die dritte, von Bergoglio und Luzzi repräsentierte Strömung bestand aus den Guardianes, traditionellen und orthodoxen intellektuellen und militanten Peronisten, die der Rückkehr Peróns den Weg ebnen wollten. Juli Bárbaro, einer der führenden Männer der Guardia an der USAL, der später Abgeordneter des Lagers Peróns war, erinnerte sich daran, dass Bergoglio und Luzzi zu den wenigen Priestern gehörten, die die Guardia verstanden und ihre Bemühungen um einen authentischen, nicht gewalttäigen und dem Volk zugewandten Peronismus unterstützten« (A. IVEREIGH, Reformer, S. 105).
65 Ebd.
66 Ebd.
67 Zu Amelia PODETTI vgl. J.R. PODETTI, Vorwort zu A. PODETTI, Comentario, S. 15-33; J. P. DENADAY, Podetti.
68 A. IVEREIGH, Reformer, S. 106.
69 A. PODETTI, Comentario (eine neue Ausgabe mit einem Vorwort von J. M. Bergoglio erschien 2007 in Buenos Aires bei Editorial Biblos); DIES., Irrupción.
70 J. M. BERGOGLIO, Vorwort zu A. PODETTI, Comentario, it. Übersetzung »Per un dialogo genuino con il pensiero filosofico moderno. Note di filosofia del cardinal Bergoglio a margine di un libro di Amelia Podetti«, in Terre d’America, 27. Juni 2013.
71 J. M. BERGOGLIO, »Per un dialogo genuino con il pensiero filosofico moderno. Note di filosofia del cardinal Bergoglio a margine di un libro di Amelia Podetti«, in Terre d’America, 27. Juni 2013, online zugänglich unter http://www.terredamerica.com/2013/06/27/per-un-dialogo-genuino-con-il-pensiero-filosofico-moderno-note-di-filosofia-del-cardinal-bergoglio-a-margine-di-un-libro-di-amelia-podetti/ (letzter Zugriff 12. Juni 2020). Carlos Astrada (1894-1970), ein Schüler Schelers, Hartmanns, Husserls und Heideggers, leitete in der Zeit, als Amelia Podetti dort studierte (1948-1955) das Philosophische Institut der Facultad de Filosofía y Letras in Buenos Aires. Er war maßgeblich daran beteiligt, die Phänomenologie und den Existentialismus in Argentinien einzuführen. Zu ihm vgl. A. MERCADO VERA, Astrada. Andrés Mercado Vera (1918-1992) war ein Schüler Carlos Astradas und Lehrer Amelia Podettis. Er lehrte Philosophie an der Universität Buenos Aires, war Mitherausgeber des Bandes Valoración de la Fenomenología del Espíritu (Buenos Aires: Devenir 1964), sowie zahlreicher weiterer Aufsätze zu Hegel und seinem Denken.
72 A. PODETTI, Comentario, S. 55-56 (Ausgabe von 2007).
73 Für eine Gegenüberstellung des hegelschen und des katholischen Modells vgl. M. BORGHESI, Era, S. 117-169.
74 A. PODETTI, Comentario, S. 51.
75 Ebd.
76 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 3. Januar 2017.
77 A. PODETTI, Irrupción. Die it. Übersetzung des Werkes wurde hier als Basis für die Übersetzung verwendet (A. PODETTI, Irruzione, S. 11).
78 J. M. BERGOGLIO, »Per un dialogo genuino con il pensiero filosofico moderno. Note di filosofia del cardinal Bergoglio a margine di un libro di Amelia Podetti«, in Terre d’America, 27. Juni 2013, online zugänglich unter http://www.terredamerica.com/2013/06/27/per-un-dialogo-genuino-con-il-pensiero-filosofico-moderno-note-di-filosofia-del-cardinalbergoglio-a-margine-di-un-libro-di-amelia-podetti/ (letzter Zugriff 12. Juni 2020).
79 Z. BRZEZINSKI, Ages, S. 65.
80 A. PODETTI, Irruzione, S. 12.
81 PAPST FRANZISKUS, Audioaufnahme vom 3. Januar 2017.
82 »Unter den vielen, die unter großem Aufwand in den Worten und Gesten von Papst Franziskus tiefe intellektuelle Prägungen zu erkennen versuchen, gibt es diejenigen, die mehr oder weniger implizite Berührungspunkte zwischen den bergoglianischen Peripherien und den Dependenztheoretikern gesehen haben wollen. Dies mag zwar interessant klingen, ist aber nicht zielführend. Denn das einzige analytische Instrument, um in der Spannung zwischen Zentrum und Peripherie einen Indikator für den Lauf der Dinge in Kirche und Welt zu finden, hat Bergoglio von der argentinischen peronistischen Philosophin Amelia Podetti (1928-79) übernommen. Die Hegel-Expertin vom Río de la Plata, die an der Staatlichen Universität von Buenos Aires und der Jesuitenuniversität Philosophie lehrte und als der Dritte-Welt-Fraktion und nicht der marxistischen Guardia de Hierro nahestehend galt, war der Ansicht, dass Europa sich nach der Erdumrundung Ferdinand Magellans anders ›gesehen‹ habe. Es war etwas anderes, die Welt von Madrid aus zu betrachten als sie von Feuerland aus zu sehen: Der Blick war weiter und man konnte Dinge sehen, die denen verborgen blieben, die alles vom ›Zentrum‹ des Reiches aus betrachteten« (G. VALENTE, »Francesco e il viaggio della Chiesa fuori di se stessa«, in Vatican Insider, 28. Mai 2016).
83 A. PODETTI, Irrupción, S. 10.
84 Ebd., S. 13-20.
85 J. M. BERGOGLIO, »Per un dialogo genuino con il pensiero filosofico moderno. Note di filosofia del cardinal Bergoglio a margine di un libro di Amelia Podetti«, in Terre d’America, 27. Juni 2013, online zugänglich unter http://www.terredamerica.com/2013/06/27/per-un-dialogo-genuino-con-il-pensiero-filosofico-moderno-note-di-filosofia-del-cardinalbergoglio-a-margine-di-un-libro-di-amelia-podetti/ (letzter Zugriff 12. Juni 2020).
86 A. PODETTI, Irrupción, S. 16.
87 Zur konzeptuellen Unterscheidung von »politischer Theologie« und der »Theologie der Politik« vgl. M. BORGHESI, Critica, S. 9-22.
88 P. MORANDÉ, Optica.
89 A. METHOL FERRÉ, Przywara. Die Rezension bezog sich auf die spanische Ausgabe (Madrid: Cristianidad 1984) von E. PRZYWNOTEARA, Augustinus.
90 Viele dieser Beiträge aus den 1990er-Jahren sind enthalten in L. CAPPELLETTI, M. P. COMUNALE, Potere. Zu den meistzitierten Werken Ratzingers gehören J. RATZINGER, Volk; DERS., Einheit.
91 Vgl. M. BORGHESI, Critica, S. 65-88.
92 J. M. BERGOGLIO, »Parola e amicizia« (2002), in J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Occhi, S. 144-145. Dieser Text ist in der deutschen Übersetzung des Bandes »Im Angesicht des Herrn« nicht enthalten.
93 Ebd., S. 146.
94 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, »Erziehen heißt, das Leben wählen« (2003), in DERS., Angesicht, I, S. 189.
95 Ebd., S. 188.
96 Ebd., S. 189-190. Antonio Spadaro beschreibt Bergoglios »augustinischen« Geist treffend: »In der Tat nimmt Bergoglio die augustinische Kritik an einer Religion, die als ›wesentlicher Bestandteil der gesamten symbolischen und imaginären Konstruktion‹ verstanden wird, die ›die Gesellschaft durch eine sakralisierte Macht‹ aufrechterhält, vollumfänglich an. […] Bergoglio – und darin folgt er dem großen jesuitischen Theologen Erich Przywara, dem Lehrer Hans Urs von Balthasars – postuliert das Ende der Konstantinischen Ära und lehnt die Idee der Verwirklichung des Reiches Gottes auf Erden, die die Grundlage des Heiligen Römischen Reiches und aller ähnlichen politischen und institutionellen Formen gewesen war, radikal ab« (»La diplomazia di Francesco. La misericordia come processo politico«, in La Civiltà Cattolica, 3975, 13. Februar 2016, S. 215-216, hier 218).
97 J. RATZINGER, Einheit, S. 104.
98 Ebd., S. 103.
99 Ebd., S. 105.
100 Ebd., S. 105-106.
101 J. M. BERGOGLIO, »Bene piantati per terra, per non perdere la rotta verso il cielo« (2000) in J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Occhi., S. 58. Die deutsche Übersetzung des Bandes »Im Angesicht des Herrn« enthält nur eine gekürzte Fassung dieser Predigt (»Zu Frieden und Hoffnung erziehen«); vgl. J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Angesicht, I, S. 108- 110.
102 Ebd.
103 Ebd., S. 60.
104 Ebd.
105 Ebd., S. 61.
106 Ebd., S. 60.
107 Ebd., S. 61.
108 A. IVEREIGH, Reformer, S. 140.
109 Ebd., S. 141.
110 Zur teología del pueblo und Papst Franziskus vgl. J. C. SCANNONE, Papa; DERS., Teología; R. LUCIANI, Papa; C. M. GALLI, Pueblo.
111 Lucio Gera (1924-2012) studierte in Bonn und wurde danach Professor für Dogmatik an der UCA (Universidad Católica Argentina) in Buenos Aires. Er war Mitherausgeber der Zeitschrift Theología, Peritus beim Konzil, »Perito Asesor« in Medellín, Mitherausgeber des Dokuments von San Miguel des argentinischen Episkopats und später erneut »Perito« in Puebla. Zu seinem Denken vgl. L. GERA, Teología; DERS., Chiesa. Darin enthalten sind Übersetzungen der Aufsätze »Pueblo, religión del pueblo y iglesia« und »La iglesia frente a la situación de dependencia«. Scannone nimmt in seinem Nachwort seinen zuvor in der Civiltà Cattolica erschienenen Aufsatz auf (»Lucio Gera: un teologo ›dal‹ popolo«, in La Civiltà Cattolica, 3954, 2015, S. 539-550). Für einen umfassenden Einblick in Geras Denken vgl. R. FERRARA, C. M. GALLI, Presente. Vgl. auch V. AZCUY, C. M. GALLI, M. GONZÁLES, J. C. CAAMAÑO, Escritos.
112 J. C. SCANNONE, Theologie, S. 37.
113 A. IVEREIGH, Reformer, S. 95-96.
114 J. C. SCANNONE, Theologie, S. 40-41.
115 A. METHOL FERRÉ, Rio, S. 22. Vgl. auch »La Chiesa, popolo tra i popoli« (1975), it. Übersetzung in Ders., Risorgimento, S. 157-158. In der italienischen Einleitung zum Band schrieb Methol bezugnehmend auf seinen Aufsatz von 1976 mit dem Titel »Quadro storico della religiosità popolare«, der ebenfalls im Band enthalten ist (S. 166-190): »Der Geltungsanspruch der ›Religiosität des Volkes‹ begann 1969 mit Río de la Plata, vor allem dank des argentinischen Theologen Lucio Gera. Bei einer Gelegenheit erzählte mir Segundo Galilea – eine der treibenden Kräfte hinter der ikonoklastischen Welle der 1960er-Jahre –, dass er glaubte, die erste Rehabilitierung der Religion des Volkes gegen säkularisierende Angriffe sei in meinem Aufsatz ›I periodi storici‹ formuliert worden. Die Rückkehr der Volksfrömmigkeit führte die Kirche unweigerlich zur Problematik der lateinamerikanischen Kultur und überwand die üblichen ausschließlich sozioökonomischen Ansätze, die das Ethos und die Geschichte unserer Völker ignorierten und wegfiltern ließen« (ebd., S. 16).
116 GUTIÉRREZ, Theologie, S. 23-24.
117 Ebd., S. 28.
118 Ebd., S. 36-37.
119 Ebd., S. 38.
120 Ebd., S. 41.
121 Ebd.
122 In »Evangelii gaudium« heißt es: »Da die Volksfrömmigkeit Frucht des inkulturierten Evangeliums ist, ist in ihr eine aktiv evangelisierende Kraft eingeschlossen, die wir nicht unterschätzen dürfen; anderenfalls würden wir die Wirkung des Heiligen Geistes verkennen. Wir sind vielmehr aufgerufen, sie zu fördern und zu verstärken, um den Prozess der Inkulturation zu vertiefen, der niemals abgeschlossen ist. Die Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit haben vieles, das sie uns lehren können, und für den, der imstande ist, sie zu deuten, sind sie ein theologischer Ort. Diesem sollen wir Aufmerksamkeit schenken, besonders im Hinblick auf die neue Evangelisierung« (PAPST FRANZISKUS, »Evangelii gaudium«, § 126. Zur »evangelisierenden Kraft der Volksfrömmigkeit« vgl. § 122-126).
123 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Institución, S. 49-60; dt. Übersetzung teilweise bei D. DECKERS, Papst, S. 111ff. Zum »im Glauben unfehlbaren« Volk vgl. J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, »Die innige und tröstliche Freude der Verkündigung« (2005), in DERS., Macht, S. 361, so"fnoteie »Evangelii gaudium«, § 119.
124 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, »Fede e giustizia nell’apostolato dei gesuiti« (1976), it. Übersetzung in DERS., Pastorale, S. 249.
125 PAPST FRANZISKUS, »Evangelii gaudium«, § 125.
126 »Dokument der III. Generalkonferenz des lateinamerikanischen Episkopats in Puebla, 13. Februar 1979. Deutsche Übersetzung der durch den hl. Vater am 23.3.1979 approbierten Fassung«, in: Stimmen der Weltkirche 8 (1979), § 448, S. 76.
127 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, »Die innige und tröstliche Freude Verkündigung« (2005), in DERS., Macht, S. 366.
128 J. M. BERGOGLIO-PAPST FRANZISKUS, Institución; dt. Übersetzung teilweise bei D. DECKERS, Papst, S. 111ff.
129 »Obwohl die Theologie des Volkes – wie E[vangelii] G[audium] – in ihrem Verständnis von ›Volk‹ die Einheit gegenüber dem Konflikt als vorrangig betrachtet, übersieht sie dennoch die dringenden sozialen Konflikte in Lateinamerika nicht. Denn sie benutzt auch den Begriff ›Antivolk‹, der die ursprünglichere Einheit des Volkes, das jedoch durch die persönliche oder strukturelle Ungerechtigkeit verraten wird, voraussetzt. Darüber hinaus erkennt sie das Faktum des Klassenkampfs an, ohne diesen – wie der Marxismus – als ›bestimmendes hermeneutisches Prinzip‹ des Verständnisses von Gesellschaft und Geschichte zu betrachten« (J. C. SCANNONE, Theologie, S. 39).
130 J. M. BERGOGLIO, »Kultur und Volksreligiosität« (2008), in PAPST FRANZISKUS, Angesicht, II, S. 210. Vgl. auch E.C. BIANCHI, Introduzione, S. 13-22.