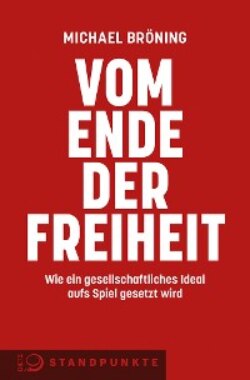Читать книгу Vom Ende der Freiheit - Michael Bröning - Страница 7
Der Rollentausch der Freiheit
ОглавлениеBibliotheken ließen sich füllen mit Abhandlungen und Streitschriften für, gegen oder über die Freiheit. Was ist Freiheit? Bürde und Kür eines Christenmenschen, wie Martin Luther meinte? Selbstverwirklichungsfeld »männlicher Krieger«, von denen Friedrich Nietzsche schwärmte? Die »Freiheit der Sklavenhalter« Lenins oder die Selbstbeschränkung, wie Hans Jonas argumentiert? Mit Hannah Arendt »die Freiheit, frei zu sein« oder mit Theodor Adorno etwas, was es »nicht gibt«?
»Philosophische Erklärungen der Freiheit sprechen wenig an«, heißt es lakonisch im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm aus dem Jahr 1864. Dieser Hinweis von Andreas Arndt gilt heute ungebrochen, allerdings weit über das Feld der Philosophie hinaus. »Freiheit« sei ein Begriff so unbestimmt wie das Wetter, spottete der rechtskonservative Publizist Joachim Fernau, um süffisant zu fragen: »Mögen Sie Wetter?« Und auf der Linken konterte Kurt Tucholsky: »Wer die Freiheit nicht im Blut hat, wer nicht fühlt, was das ist: Freiheit – der wird sie nie erringen«. Aber: Muss man die Freiheit im Blut haben oder doch eher im Investitionsportfolio? Zumindest in der Welt des Kommerzes scheint das Produkt Freiheit schließlich nach wie vor reißenden Absatz zu finden. Die Freiheit liegt demnach im Konsum – den Überbau dieser eingeschränkten Weltsicht lieferte der Ökonom Milton Friedman mit seiner Gleichsetzung von Kapitalismus und Freiheit.
Von der griechischen und römischen Antike über das europäische Mittelalter bis zur Französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung war der Begriff der Freiheit stets ein Spielball widerstreitender Interessen. Die Freiheit, so viel zeigt ein Blick auf die Genese des Begriffs, war immer alles andere als selbsterklärend.
Als einflussreiche Stimme neuzeitlicher Freiheitsüberlegungen hat sich insbesondere der Philosoph und Nationalökonom John Stuart Mill erwiesen, der in seinem Aufsatz »On Liberty« Grundsätze eines individualistischen Freiheitsverständnisses formulierte. Für Mill umfasst menschliche Freiheit »als Erstes das innere Feld des Bewusstseins und … zweitens … Freiheit, einen Lebensplan, der unseren eigenen Charakteranlagen entspricht, zu entwerfen und zu tun, was uns beliebt, ohne Rücksicht auf die Folgen und ohne uns von unseren Zeitgenossen stören zu lassen, solange wie ihnen nichts zuleide tun«. Mills Erörterungen zum Spannungsverhältnis zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft sind auch heute noch aktuell. Doch weiterführender für die auf den folgenden Seiten erörterte Bedrohung der Freiheit erscheint eine Unterscheidung, die auf Isaiah Berlin zurückgeht: nämlich die zwischen positiver und negativer Freiheit.
Isaiah Berlin, der in Riga geboren wurde und den Despotismus des Zarismus und der Revolution in Russland selbst hautnah miterlebte, thematisierte in seiner Oxforder Antrittsvorlesung »Two Concepts of Liberty« einen doppelten Freiheitsbegriff. Negative Freiheit wird darin im Wesentlichen als »Freiheit von« begriffen. Als Freiheit von Unterdrückung, Freiheit von Fremdbestimmung, Freiheit von staatlicher Übergriffigkeit, aber auch als Freiheit von den Störungen durch das Freiheitsstreben anderer. Es ist dieses enge Verständnis von Freiheit als Trumpf gegen den Staat, das die größte Gemeinsamkeit mit dem heutigen Alltagsverständnis von Freiheit aufweist.
In Abgrenzung zur negativen definiert Berlin die positive Freiheit. Sie bezieht sich auf die Voraussetzungen, die zur Realisierung negativer Freiheitsrechte erforderlich sind. Denn welchen Sinn hätte etwa die Pressefreiheit in einer Gesellschaft von Analphabeten? Welchen realen Inhalt hätte die Freiheit der Berufswahl, wenn nicht der Staat durch ein öffentliches Bildungssystem die Grundlagen für eine wirkliche Wahlfreiheit legt?
Die Rolle des Staates beschränkt sich für Verfechter der positiven Freiheit eben nicht auf einen Rückzug auf den »Nachtwächterstaat«, sondern sie umfasst eine staatliche Betätigung, die Freiheitsrechte auch über punktuelle Einschränkungen fördert – etwa durch Besteuerung, Zölle und Tarife. Denn nur so werden öffentliche Güter im Bereich der Gesundheitsvorsorge, der Forschung, der Bildung, aber auch der Sicherheit geschaffen und für alle zugänglich. Hinter dieser Unterscheidung steht die fundamentale Einsicht, dass Rechte keine Freiheiten darstellen, sondern Privilegien, wenn Freiheit nicht mit dem Ideal der Gleichheit verknüpft wird.
Es ist wenig verwunderlich, dass sich gerade politische Kräfte links der Mitte in die Tradition dieser positiven Freiheitsrechte gestellt haben – nicht zuletzt in Deutschland. Schon der Mitbegründer der Sozialdemokratie, August Bebel, fragte 1870: »Was nützt ihm [dem Arbeiter, M. B.] die bloße politische Freiheit, wenn er dabei hungert, wenn seine Lage sich nicht verbessert, er der vom Kapitalisten ausgebeutete Mensch ist, der sein ganzes Leben sich plagen und abrackern muss, um schließlich elend zu Grunde zu gehen«? Bebel geht es hier weniger um die Freiheit von staatlicher Bevormundung als vielmehr darum, dass Freiheit nie voraussetzungsfrei ist. Ohne die Befähigung zu bestimmten Ansprüchen ergeben negative Freiheitsrechte entweder keinen Sinn oder sie können faktisch nicht in Anspruch genommen werden.
Rechte und linke politische Kräfte lassen sich weltweit auch anhand ihrer jeweiligen Bewertungen von positiver und negativer Freiheit unterscheiden: Im rechten und liberalen Spektrum liegt der Fokus auf der (negativen) Freiheit vom übermächtigen Staat, der kritischen Beurteilung bürokratischer Regelungen und dem dezidierten Lob der Eigeninitiative. Auf der Linken erklingt dagegen der Ruf nach einem handlungsfähigen Gemeinwesen, dem die Aufgabe zukommt, vergleichbare Lebenschancen für alle sicherzustellen, die Voraussetzungen für tatsächliche Autonomie in den Blick zu nehmen und dabei, wenn erforderlich, auch rein negative Freiheitsvorstellungen einzuschränken.
In der jüngeren Vergangenheit haben sich nahezu sämtliche maßgeblichen politischen Kräfte zumindest in westlichen Demokratien im Wesentlichen mit einem Freiheitsbegriff arrangiert, der sowohl negative als auch positive Freiheitsrechte beinhaltet. Von radikalen Ausnahmen abgesehen, stellen sich schließlich selbst hartgesottene Verfechter der »Freiheit von« nicht etwa ernsthaft gegen die Erhebung einer Einkommensteuer, die ja das heilige Ideal des Eigentums verletzt, nur um zum Beispiel ein allgemeines Straßennetz zu finanzieren.
Akzeptiert wird dabei die grundlegende Einsicht Isaiah Berlins, dass das Zusammenspiel von positiver und negativer Freiheit eben nicht als ein Entweder-Oder begriffen werden kann. »Negative Freiheit muss begrenzt werden, wenn positive Freiheit realisiert werden soll, zwischen beiden muss eine Balance bestehen«, so Berlin. Doch – und diese Sorge durchzieht die folgende Warnung vor dem »Ende der Freiheit« – kann eine solche Balance noch zweifelsfrei für prägende Teile des linksliberalen Lagers festgestellt werden?
Heute, so scheint es, richten maßgebliche Stimmen des progressiven Spektrums ihre Aufmerksamkeit zwar zu Recht weiterhin auf positive Freiheitsvorstellungen – und fordern einen aktiven Staat und gerecht verteilte Lebenschancen. Doch ebenso entscheidende Aspekte eines negativen Freiheitsbegriffs wie die grundlegende Freiheit von Bevormundung, das Zurückweisen von Paternalismus und staatlicher Gängelung werden nicht nur übersehen, sondern in Teilen ganz bewusst infrage gestellt.
Das aber ist ein so gefährlicher wie merkwürdiger historischer Rollentausch. Denn es waren traditionell schließlich stets herrschaftsnahe und privilegierte gesellschaftliche Kräfte, die ein Zuviel an Freiheit und Zügellosigkeit als Bedrohung auffassten. Angesichts der bestehenden Wohlstandsunterschiede bezog sich diese Furcht der Besitzenden historisch in der Regel zuallererst auf den Schutz von Eigentumsrechten, die vor allzu umfassender freiheitlicher Maßlosigkeit behütet werden mussten.
Die vom französischen Publizisten (und Aristokraten) Alexis de Tocqueville konstatierte Gefahr der »Tyrannei der Mehrheit« fand aus diesem Grund einen breiten Widerhall auch in der konservativen angelsächsischen Tradition bei Denkern wie Edmund Burke, in dessen skeptischem Blick »praktische Freiheit« nur realisierbar erscheint, sofern dem »Appetit der Menschen moralische Ketten auferlegt werden«. Dieser Impuls mag mit Blick auf die jakobinische Tyrannei der Französischen Revolution nur zu gerechtfertigt erscheinen. Doch ist es nicht bezeichnend, dass der große konservative Denker des viktorianischen Zeitalters mit seiner Forderung nach »moralischen Ketten«, nach einer Begrenzung des »Appetits der Menschen« und mit seinem skeptischen Blick auf freiheitliche Ideale heute ausgerechnet in Teilen des progressiven Lagers offene Türen einlaufen würde? Wo ist das progressive Lob der Freiheit? Und wann ist es verloren gegangen?