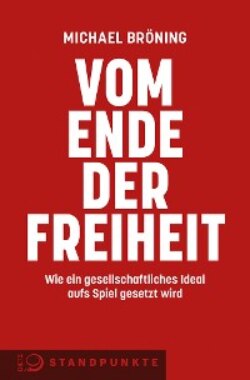Читать книгу Vom Ende der Freiheit - Michael Bröning - Страница 9
Die Ausnahme der Freiheit
ОглавлениеDie Freiheit ist nicht am Ende. Zumindest noch nicht. Wie könnte sonst ein Essay »Vom Ende der Freiheit« erscheinen? Für die folgenden Ausführungen sei deshalb auch klargestellt: Eine Debatte über den gesellschaftlichen Wert der Freiheit findet gerade in Deutschland nach wie vor unter idyllischen Bedingungen statt, trotz Pandemie, Einschränkungen von Grundrechten und ungeachtet aller gerechtfertigten Kritik an Unzulänglichkeiten der öffentlichen Debatte. Wer hier allen Ernstes von Gesinnungsdiktatur schwadroniert, erweist sich als historisch blind und der Sache der Freiheit einen Bärendienst.
Die folgenden Überlegungen sind deshalb kein Ausdruck von Katastrophismus und auch kein effekthascherischer Kassandraruf eines »Experten der Apokalypse« (Umberto Eco), sondern ihnen liegt vielmehr die umfassend belegte Tatsache zugrunde, dass das Ideal der Freiheit weltweit unter einzigartigem Druck steht. Der jährliche Bericht etwa der Nichtregierungsorganisation Freedom House zeichnet hier aktuell ein geradezu gespenstisches Bild. Insbesondere das Jahr 2020 zeichnet sich durch historisch einmalige Einbrüche in Sachen Demokratie und Freiheitsrechten aus. Nahezu zwei Drittel der Weltbevölkerung leben heute in einem Land, in dem sich die demokratischen Normen verschlechtern.
In 73 Ländern ist das Demokratieniveau im zurückliegenden Jahr gesunken. Doch dieser Einbruch ist keine Ausnahme. Zum 15. Mal in Folge registriert Freedom House einen solchen Rückgang. Schon 2008 warnte Larry Diamond, einer der weltweit führenden Demokratieforscher, vor einer »Rezession der Demokratie«. Die Entwicklungen der Gegenwart aber sind keine kurze Flaute der Demokratie, die demnächst von einer Konjunktur der Demokratie abgelöst wird, sondern sie sind Ausdruck einer langfristigen und tiefgreifenden Krise.
Dabei bedroht nicht nur ein Zuviel an autoritärer Übergriffigkeit, sondern auch ein Zuwenig an Staat das Überleben der Freiheit als Grundwert. Es gibt keine Balance der Freiheit, wenn ein Staat kollabiert – egal ob sich dieser in Südamerika, Subsahara-Afrika, dem Nahen Osten oder in Zentralasien befindet.
Auch die Meinungsforschung belegt hier bedenkliche Trends. So verweisen etwa die Daten des World Values Survey aus den Jahren 2017 bis 2020 auf den schweren Stand des Ideals der Freiheit gerade in Krisenzeiten. Zu einer eindeutigen Entscheidung zwischen den Werten Freiheit und Sicherheit aufgefordert, stellen sich in Deutschland nur 43 Prozent der Befragten auf die Seite der Freiheit, in Südkorea 42 Prozent, in Japan gerade einmal 13 Prozent. Nur in drei von 50 untersuchten Ländern kann die Freiheit derzeit in einem direkten Vergleich mit dem Wert der Sicherheit bestehen: in Australien, Neuseeland und den USA.
Für extreme Krisensituation scheint eine solche Gewichtung von Prinzipien durchaus naheliegend, schließlich gibt es kein freies Leben, wenn das Leben selbst bedroht ist. Doch was folgt daraus, wenn die Krise allgegenwärtig und dauerhaft wird? Welche Rolle kann die Freiheit dann noch spielen?
»Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann«, lautet das Diktum des früheren Richters am Bundesverfassungsgericht Ernst-Wolfgang Böckenförde. Eben das sei »das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist«. Auch empirisch ist dieser Satz gut belegt. Vergleichende Demokratieforscher wie Ronald Inglehart verweisen auf die Tatsache, dass »freiheitliche Aspirationen der Bevölkerung eine massiv unterschätzte Rolle in Demokratisierungsprozessen spielen«. Die Folgen des Abwendens breiter Bevölkerungsschichten von freiheitlichen Idealen sind deshalb keine Lappalie, sondern ein politischer Erdrutsch.
Spätestens seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen 2016 – und in Deutschland mit den Erfolgen der AfD – hat die öffentliche Debatte über die Gefährdung der Demokratie massiv an Intensität gewonnen. Dabei steht immer wieder zu Recht die Frage im Fokus, wie es konservative Kräfte und das politische Establishment insgesamt über Lippenbekenntnisse hinaus mit der Herausforderung von Rechtsaußen halten. Bewähren sich konservative Parteien als Gatekeeper des demokratischen Systems – wie etwa in Belgien in den 1930er-Jahren –, oder erweisen sie sich als Steigbügelhalter des Illiberalismus und als Totengräber der Freiheit? In Zeiten, in denen sich ein abgewählter US-Präsident weigert, seine Wahlniederlage anzuerkennen, und in denen in weiten Teilen der extremen Rechten in Europa das Zerrbild einer elitär-liberalen Weltverschwörung gezeichnet wird, ist der Kampf freiheitlicher Kräfte gegen die Bedrohung von rechts unabdingbar.
Doch in aufgeklärten Kreisen gerät angesichts dieser Bedrohungsperspektive allzu häufig aus dem Blick, dass auch auf der politischen Linken fragwürdige antifreiheitliche Tendenzen zu beobachten sind, die ebenfalls eine erhebliche Gefahr für die Demokratie darstellen - aber sehr viel seltener thematisiert werden. Sicher unterscheiden sie sich in Intention und Instrumenten von der rechten Bedrohung. Doch dass sich gerade gesellschaftliche Milieus, die sich stets als Bastion der Autonomie und Selbstbestimmung verstanden haben, nun nicht mehr bedingungslos für die Idee der Freiheit engagieren, ist auf eine ganz eigene Art brisant.
Angesichts dieser vielschichtigen Bedrohungslage soll in den folgenden Kapiteln zu den Schwerpunkten Pandemiebekämpfung, Identitätspolitik, Meinungsfreiheit, Digitalisierung und Klimakrise herausgearbeitet werden, welche spezifischen politischen Herausforderungen für das Ideal der Freiheit bestehen und welche Positionsverschiebungen auf der progressiven Seite besonders schwere Hypotheken für ein Bestehen der Freiheit darstellen.
Freiheit ist die historische Ausnahme, nicht die Regel – und existiert stets in einem Spannungsfeld zwischen potenziell übergriffigem Staat und latent willfähriger Gesellschaft. Die Freiheit behauptet sich in einem Korridor, in dem sich »Staat und Gesellschaft gegenseitig ausbalancieren«, wie es Daron Acemoglu und James A. Robinson in ihrer aktuellen monumentalen Studie The Narrow Corridor über die soziale Bedingtheit von Freiheit formulieren.
Freiheit ist eben kein Wert auf einer nach oben offenen Skala. Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Idealen kann sie nicht absolut werden, ohne sich in ihr Gegenteil zu verkehren. »Freiheit ist«, wie Hans-Peter Bartels, Wolfgang Merkel und Johano Strasser vor einigen Jahren für die Grundwertekommission der SPD schrieben, »Voraussetzung wie beständiges Resultat der freiheitlichen Demokratie«. Diese Erkenntnis ist es, die die Überlegungen dieses Essays als Ausgangspunkt mitbestimmt.
Wenn nun auf den folgenden Seiten die Bedrohung durch den Rechtsautoritarismus und andere Gefährdungspotenziale – etwa durch den militanten Islamismus – hintangestellt werden, so geschieht das nicht in dem Versuch, diese Gefahren kleinzureden. Es geht auch nicht um ein Loblied auf die vermeintlich reine Lehre des Laissez-faire, in der allen geholfen ist, wenn nur jedes Individuum intensiv genug an sich selber denkt. Im Gegenteil: Die Propagierung libertärer Glaubenssätze eines schwachen Staats in einem entgrenzten Kasinokapitalismus ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems – ebenso wie der Missbrauch freiheitlicher Rhetorik durch autoritäre Agitatoren, die sich in das Gewand der Freiheit kleiden, um ein Weltbild der Ungleichheit mit dem schönen Schein einer noblen Idee zu versehen.
Wenn diese Risiken auf den folgenden Seiten nur am Rande behandelt werden, geschieht das nicht aus Missachtung, sondern auch weil breit rezipierte Analysen wie Thomas Pikettys Das Kapital im 21. Jahrhundert, aber auch Michael J. Sandels Abrechnung Vom Ende des Gemeinwohls hier bereits den Finger in die Wunde legen, die nicht durch ein Zuwenig, sondern durch ein Zuviel an falsch verstandener »Freiheit von« geschlagen wurde.
Bewusst sollen dabei auch Aspekte des Themas ausgeblendet werden, die zwar durchaus relevant sind, aber eine gesonderte Betrachtung verdienen – etwa die Zukunft der Europäischen Union und das existierende freiheitliche Dilemma zwischen stärkerer globaler Handlungsfähigkeit und demokratischen Präferenzen der Einzelstaaten. Ebenfalls nicht weiter ausgeführt werden können hier aktuelle Forschungsergebnisse der (Neuro-)Wissenschaft, die hinter die als selbstverständlich angenommene Vorstellung der Existenz eines freien menschlichen Willens immer öfter ein Fragezeichen setzen, ohne dass hiervon die Irrelevanz solcher Hinweise abgeleitet werden soll.
Ziel dieses Essays ist also nicht eine erschöpfende wissenschaftliche Abhandlung zum Großthema Freiheit in all ihren Nuancen. Vielmehr sollen damit Schlaglichter auf so merkwürdige wie bezeichnende blinde Flecken des vorherrschenden politischen Diskurses geworfen werden. Dabei soll dieser Zwischenruf als ein so selbstkritisch wie hoffentlich konstruktiver Appell gerade an weltoffene Kräfte verstanden werden, das Ideal der Freiheit in der politischen Auseinandersetzung nicht vorschnell preiszugeben. Getragen wird dieser Einwurf dabei von der Mahnung, die Hannah Arendt ans Ende ihrer Betrachtungen zur Freiheit stellte: »Wir können allenfalls darauf hoffen, dass die Freiheit in einem politischen Sinn nicht wieder für Gott weiß wie viele Jahrhunderte von dieser Erde verschwindet«.
Wir aber sollten nicht nur hoffen, dass die Freiheit Bestand hat, sondern gegenhalten und engagiert für freiheitliche Prinzipien Position beziehen. Nur wo? Gerade als Stimmen, die sich für Demokratie, Gerechtigkeit und Zusammenhalt stark machen, fangen wir damit am besten an einem ganz bestimmten Ort an: vor der eigenen Haustür.