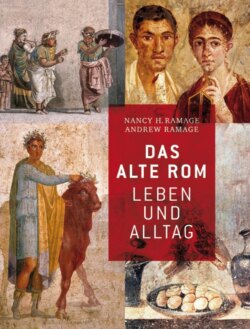Читать книгу Das Alte Rom - Nancy Ramage - Страница 15
Die Kaiser
ОглавлениеNach Caesars Tod bildete sich ein zweites Triumvirat, das aus Oktavian (Caesars Großneffe und Adoptivsohn), Marcus Antonius und Marcus Lepidus bestand. Doch auch dieses Triumvirat war nicht von Dauer, so dass sich Rom bald in einen erneuten Bürgerkrieg verwickelt sah, aus dem Oktavian schließlich als Sieger hervorging. In der Schlacht bei Aktium im Jahr 31 v. Chr. besiegte er Marcus Antonius und Kleopatra VII., die Königin von Ägypten. Vier Jahre später wurde er im Senat zum princeps ernannt, ein durchaus republikanischer Titel, der nun jedoch eine neue Bedeutung annahm. Auch der Ehrenname »Augustus« (»der Erhabene«) wurde ihm verliehen, ein Titel, der auf die glorreichen Ursprünge der Stadt verwies und welchen in seiner Nachfolge Kaiser bis in die Neuzeit hinein tragen würden. Auch die Titel pontifex maximus und imperator wurden fortan nur noch von den Kaisern getragen und unterstrichen ihren Anspruch, als oberster Priester Roms sowie als Oberbefehlshaber der römischen Truppen zu gelten. Viele der traditionellen kaiserlichen Titel, die wiederholt in formelhaften Sentenzen auf Münzen und in Inschriften verwendet werden, nehmen ihren Ursprung in den Eigennamen dieser Umbruchszeit: So wurden die ursprünglichen Namen »Caesar« und »Augustus« zu den Herrschaftstiteln der Spätantike. Zogen Kaiser mit ihren Truppen ins Feld, so konnten sie der offiziellen Titulatur weitere Ehren- oder Siegertitel hinzufügen, wie beispielsweise Germanicus als Sieger über die Germanen oder auch Britannicus nach seiner Eroberung Britanniens.
Augustus maß seiner Darstellung in Portraits große Bedeutung bei, von denen viele bis heute erhalten sind, da diese kaiserlichen Bildnisse seine Macht im Reiche festigen sollten und somit in großem Maße über das Reich verteilt wurden.5 Hierin folgte er dem Beispiel Caesars, der sein eigenes Bild auf die von ihm in Umlauf gebrachten Münzen prägen ließ. Ein großer Bronzekopf des Augustus, der in Meroë an den Oberläufen des Nils im Sudan gefunden wurde | Abb. 12 |, zeigt seine attraktiven Züge, die gerade Nase, hohe Wangenknochen, volle Lippen und ein ausgeprägtes Kinn. Das Haar ist typisch frisiert, mit in die Stirn gekämmten, kurzen Locken, eine Darstellungsart, die sich auf allen Herrscherportraits des Iulisch-Claudischen Kaiserhauses findet. Auch die Kopfform des Augustus, der knollenartige Schädel, bleibt nicht einzig typisch für seine Portraits, sondern wird auf die seiner Familienangehörigen übertragen. Der Bronzekopf ist durchaus ungewöhnlich, da zum einen nur wenige Bronzeportraits erhalten sind und zum anderen auch die Augen des Kopfes, die aus Glas und Stein gefertigt wurden, den Lauf der Jahrhunderte überdauerten. Die unregelmäßige Kante des unteren Halsbereiches lässt vermuten, dass der Kopf Teil einer Statue war, die im Laufe eines numidischen Plünderungszuges zerstört wurde. Der Kopf fand sich unter den Stufen eines Viktoria-Tempels vergraben, ein Akt, durch welchen die Einwohner den römischen Kaiser vermutlich symbolisch zu entehren suchten.
12 | Portraitkopf des Kaisers Augustus. Bronze, Augen aus Glas und Stein. Aus Meröe im Sudan. Wahrscheinlich in Ägypten gefertigt. Ca. 27–25 v. Chr. H. 47,7 cm.
Ein weiteres Portrait des Augustus | Abb. 13 | zeigt ihn auf einer großen, prächtigen Gemme. Der Stein ist ein braun-weißer Sardonyx, der äußerst geschickt geschliffen wurde, so dass sich Kopf und Schultern vor dem Hintergrund deutlich abheben. Der Harnisch des Kaisers ist farbig gestaltet. Die Details der Rüstung entsprechen der, die typischerweise von der Göttin Minerva getragen werden: Sie zeigen das Haupt der Medusa, umgeben von Schlangen. Die juwelenbesetzte Krone ist nicht antik.6 Diese Art von Gemmen waren wertvolle Geschenke innerhalb des engsten kaiserlichen Umfelds und wurden oft von König zu König und Kaiser zu Kaiser weitergereicht.
Mit seiner Frau Livia war Augustus 52 Jahre lang verheiratet. Innerhalb der kaiserlichen Familie nahm Livia eine überaus dominante Position ein. Zum ersten Mal in der römischen Geschichte hatte eine Frau gemeinsam mit ihrem Mann tatsächliche Macht inne, was die Verleihung des Titels Augusta durch das Testament des Kaisers noch verdeutlicht. Ihre Ehe begann allerdings auf eine recht unkonventionelle, fast schon skandalöse Weise: Sowohl Augustus als auch Livia mussten sich zunächst scheiden lassen, um einander heiraten zu können. Darüber hinaus war Livia zu dieser Zeit mit dem zweiten Sohn ihres ersten Mannes schwanger. Gleichwohl trat sie für Ehe und Moralität ein und wurde so in den Augen der Öffentlichkeit zum Vorbild der tugendhaften Frau. In dieser Rolle unterstützte sie das Programm ihrer Mannes zur Förderung der Familientradition. Auf der anderen Seite haftete Livia selbst beständig der Ruf einer äußerst intriganten Frau an, die alles daran setzte, ihren Sohn Tiberius als Nachfolger des Augustus auf den Thron zu verhelfen. Hartnäckig hielt sich auch das Gerücht (das aber wahrscheinlich nicht den Tatsachen entspricht), sie sei schließlich so weit gegangen, ihren Mann durch ein Feigengericht vergiftet zu haben.7
13 | Kamee mit Kopf und Büste des Augustus mit der Aegis der Minerva. Sardonyx. H. 12,8 cm, B. 9,3 cm.
Ein Marmorkopf zeigt Livia mit recht ausdrucksstarken Zügen | Abb. 14 | Ihre Haare sind streng zurückgekämmt und am Hinterkopf in einem Knoten zusammengenommen. Über der Stirn wurden die Strähnen nach oben gebürstet und in einem nodus, einer »Welle«, zusammengerollt, sowie an beiden Seiten in leichten Locken arrangiert. Die Haartracht der Kaiserin wurde von unzähligen Frauen ihrer Zeit kopiert, eine Imitationspraxis, die sich in der römischen Kaiserzeit immer wieder findet.
Livia bekam ihren Willen: Tiberius, ihr Sohn aus erster Ehe, folgte Augustus auf den Thron. Nachdem seine erwählten Nachfolger und Enkel, Gaius und Lucius, bereits jung verstorben waren, blieb Augustus schließlich kaum mehr eine andere Wahl. Die hierdurch gegründete Iulisch-Claudische Dynastie nahm ihren Namen aus dem Zusammenschluss der zwei alten patrizischen Familienzweige: der Iulier, als Familie des Caesar und Augustus einerseits, und der Claudier, als Familie des Tiberius-Vaters andererseits. Tiberius war ein sehr introvertierter Mensch und mag ob seiner Behandlung durch Augustus durchaus verbittert gewesen sein, da er in dessen Augen stets nur die zweite Wahl war. Dennoch trug er die Verantwortung für eine Reihe von imposanten öffentlichen Projekten und erwies sich den Gemeinden in Kleinasien gegenüber als überaus großzügig, als diese im Jahr 17 n. Chr. von einem heftigen Erdbeben erschüttert wurden. Auf Tiberius folgte Gaius, der besser unter seinem Spitznamen Caligula (»Stiefelchen«) bekannt ist – dieser Name beruht darauf, dass er die Kindheit im Feldlager seines Vaters Germanicus verbrachte, wo er kleine, den Soldatenstiefeln nachempfundene Schuhe trug. Seine Regierungszeit von nur vier Jahren gilt als Zeit von Angst und Hass auf den, wie vermutet wurde, geistesgestörten Kaiser.
Auch der nächste Kaiser stammte aus der Familie der Claudier, hieß passenderweise Claudius. Tatsächlich war er der Onkel des Gaius, doch waren seine Ansprüche auf den Thron zunächst missachtet worden – vermutlich, weil er als äußerst ruhiger, gelehrter Mann galt, dem die Leitung des Reiches nicht zugetraut wurde, und das wohl auch auf Grund einiger körperlicher Behinderungen. Doch erwies er sich als durchaus fähiger Kaiser und setzte die Fertigstellung einer Reihe von öffentlichen Projekten in Gang: unter ihnen die Vollendung der Aqua Claudia, eines Aquädukts in der Nähe Roms und des Hafens von Ostia.
Claudius war bereits fünfzig Jahre alt, als er zum Kaiser ernannt wurde. Die Macht fiel ihm mehr oder weniger zufällig zu, da er sich während der Ermordung des Caligula im Palast aufhielt und sich hinter einem Vorhang vor den Soldaten versteckte. Als er von diesen entdeckt wurde, erkannten sie ihn als Mitglied des Kaiserhauses und riefen ihn zum Kaiser aus, eine Wahl, die bald von allen anerkannt wurde.8
Beschreibungen von Claudius sind im Normalfall alles anderes als vorteilhaft:
14 | Portraitkopf der Livia. Marmor. H. 28 cm.
An eindrucksvoller Würde der äußeren Erscheinung fehlte es ihm keineswegs, sei es, dass er stand oder saß und vor allem, wenn er auf dem Ruhebett lag. Denn er war groß, aber nicht mager, hatte ein attraktives Gesicht, grau werdendes Haar und einen starken Nacken. Beim Gehen aber verließ ihn die Kraft in den schwachen Kniegelenken und beim Sprechen, sei es scherzhaft oder über ernste Dinge, verunstaltete ihn mehreres: ein ordinäres Lachen und noch mehr sein häßliches Aussehen im Zorn, wenn ihm der Schaum vor den Mund trat und die Nase tropfte. Außerdem stotterte er und wackelte beständig mit dem Kopf, was sich bei der geringsten Tätigkeit noch steigerte.9
Dieser Bericht stammt aus der Feder Suetons, der seine Kaiserbiographien in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhunderts n. Chr. schrieb. Er ist eine der wichtigsten Quellen für Anekdoten über die ersten zwölf Kaiser, doch müssen seine Beschreibungen mit Vorsicht genossen werden. Die Darstellung der römischen Geschichte ist abhängig von derartigen Quellen, doch muss sie durch zusätzliche Informationen, die durch Inschriften oder durch die Archäologie gewonnen werden, ergänzt werden (siehe Kapitel 9).
Ein überlebensgroßes Bronzeportrait des Claudius (vielleicht handelt es sich aber auch um Nero) wurde im Flussbett des Alde in Suffolk gefunden | Abb. 15 |. Claudius wird entsprechend der Iulisch-Claudischen Ikonographie mit in die Stirn gekämmten Haaren dargestellt und mit ungewöhnlich großen Ohren. Claudius war der erste Kaiser, der Britannien eroberte; somit ist es nicht verwunderlich, dass seine Statue hier gefunden wurde. Camulodunum (Colchester), im Süden des Flusses gelegen, war Residenz des mächtigsten Stammes dieser Gegend und wurde nach ihrer Eroberung kurzzeitig zur Hauptstadt der neu errichteten römischen Provinz.
Das Ende der Iulisch-Claudischen Dynastie wird durch den Tod des Kaisers Nero im Jahr 68 n. Chr. markiert. Nero wird als ausgearteter und verderbter Herrscher dargestellt, ein Größenwahnsinniger, der zwei seiner Frauen und seine Mutter umbringen ließ. Er forderte beständige Aufmerksamkeit und allgemeine Bewunderung, wenn er vor Publikum als Musiker und Sänger auftrat.10
15 | Portraitkopf des Claudius, vielleicht auch Nero. Bronze. In der Alde bei Rendham, in der Nähe von Saxmundham, Suffolk, gefunden. 1. Jahrhundert n. Chr. H. 30 cm.
16 | Portraitkopf des Vespasian. Marmor. 70–80 n. Chr. Aus Karthago. Bei Ausgrabung von Sir Thomas Reade gefunden, 1835/6. H. 40,6 cm.
Nach dem Ende der ersten Kaiserdynastie wurde die Nachfolge – in den Fällen, in denen kein legitimer Erbe zur Verfügung stand – durch Waffengewalt geregelt. Entsprechend konnten beim Tod des rechtmäßigen Kaisers an allen Enden des Römischen Reiches neue Herrscher ausgerufen werden, die ihren Anspruch auf den Thron geltend zu machen suchten. Dies gilt besonders für das Jahr 69, das auch als »Vier-Kaiser-Jahr« bekannt ist, da sich nach dem Tod Neros gleich vier Anwärter auf seine Nachfolge fanden. Es folgte ein blutiger Kampf um den Thron, doch blieb derartiges glücklicherweise bis zum Tod des Commodus, 123 Jahre später, zunächst einmalig. Nachdem Nero zum Selbstmord getrieben worden war, herrschten in den Jahren 68 und 69 n. Chr. kurzfristig drei Männer als Kaiser, bis sich Vespasian schließlich als Nachfolger etablieren und die Flavische Dynastie begründen konnte. Vespasian stammte nicht aus einer senatorischen Familie, sondern gründete seine Macht auf die Armee. Seine Portraits sind – anders als die der Iulier und Claudier – nicht idealisiert; vielmehr wird er als der reife Mann dargestellt, der er war und mit starken, aber freundlichen Zügen charakterisiert | Abb. 16 |. Nach den Ausschweifungen Neros war der neue Kaiser eine willkommene Abwechslung. Der abgebildete Marmorkopf wurde in den 1830er Jahren in Karthago ausgegraben; die zerstörten Teile seines Gesichts wurden zu dieser Zeit nicht restauriert: So fehlen bis heute die Nase und ein Ohr.
17 | Portraitbüste Trajans. Marmor. 108–117 n. Chr. 1776 bei Rom gefunden. H. 67,5 cm.
Als Vespasian sich zum Kaiser erhob, ließ er seinen Sohn Titus als Befehlshaber der Armee in Palästina zurück, wo sich die Juden im Aufstand gegen die Römer erhoben hatten. Titus führte den Krieg gegen die Juden auf besonders brutale Art, besiegte sie schließlich und zerstörte den großen Tempel von Jerusalem, bis auf ein einziges Fragment, die Westliche Mauer, besser bekannt unter dem Namen »Klagemauer“. Bei seiner Rückkehr nach Rom wurde ihm ein Triumph zuerkannt, und der Titusbogen wurde ihm zu Ehren errichtet. Szenen des Triumphes sind im Relief dargestellt (Seite 41, Abb. 33). Der gewissenhafte Titus folgte seinem Vater auf den Thron; nach ihm herrschte sein undurchsichtiger jüngerer Bruder Domitian: Auch dieser galt als einer jener Kaiser, der hinter jedem Menschen seiner Umgebung einen möglichen Attentäter vermutete und ein Heer von Spitzeln aufbaute, um sich zu schützen. Sein ausgedehnter Palast auf dem Palatin wurde von seinen Nachfolgern noch Jahrhunderte lang als Residenz genutzt.
Nerva, der nächste Kaiser, herrschte nur zwei Jahre, doch sein Amtskollege und Nachfolger Trajan gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des Römischen Reiches. Er stammte aus Italica, einer Stadt in Spanien, knapp acht Kilometer von Sevilla entfernt. Schon früh interessierte er sich für den Dienst an der Gemeinschaft, nicht nur in seiner Heimatstadt, sondern im gesamten Imperium. Als überaus fähiger Heerführer fügte er dem Reich neue Gebiete hinzu, so dass das Imperium unter seiner Herrschaft die größte Ausdehnung erreichte (Seite 10/11, Abb. 3). Er verschönerte die öffentlichen Plätze Roms durch den Bau eines neuen Forums mit einem mehrstöckigen Marktkomplex: das sogenannte Trajansforum (Seite 76, Abb. 65).
Ein Portrait Trajans | Abb. 17 | zeigt diesen mit den typischen hohen Wangenknochen und einer tiefliegenden, knöchernen Stirn, die durch das ins Gesicht fallende Haar besonders betont wird. Seine tiefliegenden Augen verstärken den Eindruck seiner Intelligenz und starken Persönlichkeit. Der neuen Mode des 2. Jahrhunderts n. Chr. entspricht die Ausarbeitung nicht nur des Kopfes, sondern auch der (heroisch) nackten Brust des Kaisers. Auf Münzen ist er fast immer im Lorbeer- oder Strahlenkranz dargestellt.