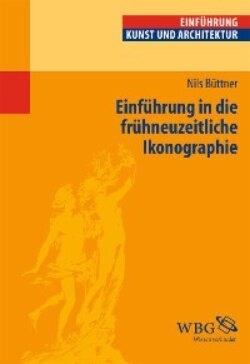Читать книгу Einführung in die frühneuzeitliche Ikonographie - Nils Büttner - Страница 12
3. Bilder für „das Volk“
ОглавлениеGedruckte Bilder wie der Buxheimer Christophorus galten lange Zeit als „ausschließlich für den kleinen Mann“ bestimmt (Brückner 1969, 10). Nach allem was man heute über die Besitzerinnen und Besitzer dieser frühen Blätter |24|und deren Funktionskontexte weiß, bestand das Publikum dieser Bilder anfangs vor allem aus wohlhabenden Angehörigen der städtischen Oberschicht (Hernad 1990). Selbst in den Gebetbüchern von männlichen und weiblichen Angehörigen des Hochadels finden sich eingeklebte Graphiken, so dass beim Gebrauch gedruckter Bilder offensichtlich nach oben keine Grenzen der sozialen Zugehörigkeit bestanden. Die Verbreitung von Druckgraphik auch unter der ländlichen Bevölkerung ist dabei zumindest für spätere Jahrhunderte gut dokumentiert. So zeigen zum Beispiel Genreszenen, die glaubhaft Einblicke in bäuerliches Wohnambiente gewähren, dass auch in Bauernstuben an Wänden und Möbeln Druckgraphik angebracht war (Kat. Essen/Wien/Antwerpen 1997, 115). Druckgraphische Blätter waren, soweit man über Preise unterrichtet ist, in der Regel nicht teuer und tatsächlich massenhaft verbreitet (Landau/Parshall 1994, 30–32). So berichtet zum Beispiel ein Antwerpener Verleger um die Mitte des 17. Jahrhunderts, dass sein Drucker in der Lage sei, 4.000 Abzüge von einer Kupferplatte herzustellen, eh diese überarbeitet werden müsse (Voet 1969–72, II, 220f.). Auch von hölzernen Druckstöcken ließen sich gewaltige Auflagen drucken. Und Druckgraphiken waren nicht die einzigen massenhaft verbreiteten Bilder. Wo von Bildern die Rede ist, muss auch an ein anderes Massenmedium der Vormoderne erinnert werden, nämlich Münzen (Abb. 2).
Abb. 2: Braunschweiger Annengroschen, 1534 Silbermünze, ∅ 2,9 cm Stuttgart, Landesmuseum Württemberg
Jesse 1962, Nr. 26; Leschhorn 2010, 100f.
Weil die Stadt Braunschweig mit schlechten auswärtigen Münzen überschwemmt worden war, hatte der Rat 1499 beschlossen, eigene Groschen zu prägen. Mit dieser neuen Währung, über deren Wert und Gewicht man sich auch mit anderen Städten und einigen Fürsten verständigt hatte, sollten im Einfluss- und Machtbereich der Vertragspartner fürderhin „die Bäcker, Brauer, Handwerker und Tagelöhner bezahlt werden“. Zugleich garantierte der sogenannte Hildesheimer Vertrag von 1501 die Festsetzung der Preise für bestimmte Waren und Handelsgüter (Leschhorn 2010, 100f.). Die Vorderseite der |25|Braunschweiger Münzen zeigt einen Wappenschild mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Löwen. Die Umschrift erläutert, um was es sich bei dieser Prägung handelt: „MONETA • NOVA • BRVNSWICG“, die „neue Braunschweiger Münze“. Die Rückseite, die dem Geldstück zugleich den Namen gab, wurde mit wechselnden Motiven versehen. Anfangs hatten sich die Braunschweiger im Vertrag von Hildesheim auf eine Abbildung des hl. Christophorus verpflichtet. Die neue Währung war allerdings in vielen Städten unbeliebt. Man brachte deshalb neue Münzen in Umlauf, die ein anderes Bild zeigten und die auch so das Vertrauen in die neue Währung stärken sollten. Zwischen 1533 und 1542 prägte man in Braunschweig so genannte Annengroschen, die ihren Namen der auf der Rückseite gezeigten „ANNA • MATER • VIRGI[NI]S • MARI[Æ]“ verdankten, „Anna, Mutter der Jungfrau Maria“.
Massenmedien
Die Darstellung folgt dem im Mittelalter ausgeprägten Bildtyp der „Anna selbdritt“ (LCI 5, 185–190), wobei der mit einem Nimbus ausgezeichneten Heiligen die Kinder auf ihrem Arm gleichsam als Attribut dienen. Auf ihrem rechten Arm trägt sie die mit einem langen Gewand bekleidete und bekrönte Mutter Gottes, auf ihrem linken Arm den nackten Jesusknaben. Die Verständlichkeit der Darstellung wurde nicht nur durch die umlaufende Inschrift garantiert, sondern vor allem durch die weite Verbreitung der Bilder. Hier kam gerade den Münzen große Bedeutung zu, die ein Massenmedium waren und eine großflächige Verteilung erfuhren. Die auf den Kursmünzen angebrachten Wappen, Porträts und Bilder sorgten dafür, dass es ein weithin geteiltes Wissen über Religion und Politik gab. Selbstverständlich hing die Wahrnehmung und Interpretation der auf den Münzen angebrachten Bilder vom Vorwissen der Betrachter ab und wurde durch den jeweiligen Bildungsgrad und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht bestimmt, die zum Beispiel auf Sprachkenntnisse und Lesefähigkeit wirkte. Dennoch sollte man Münzen als Vermittler von Bilderwissen nicht unterschätzen, da sie als echtes Massenmedium Bilder und mit ihnen das Wissen über bestimmte Bildtypen bis in entlegenste Orte brachte.
Die Bibel schweigt zu den familiären Umständen Marias. Erst das um die Mitte des 2. Jahrhunderts entstandene Protevangelium des Jakobus (1–4) berichtet ausführlich von der Herkunft Marias und liefert den Grundstock an Legenden, die auch in die Legenda aurea (676–688) Eingang fanden. Die Geschichten um Herkunft und Kindheit Mariens wurden nicht nur immer wieder erzählt und aufgeschrieben, sondern waren auch ein besonders beliebter Bildgegenstand. Wo Welt- und Heilsgeschichte untrennbar miteinander verflochten sind, steht dem zeitlich limitierten, individuellen irdischen Sein die Ewigkeit gegenüber. Der biblischen Heilsgewissheit gemäß begann sie mit dem Ende der weltlichen Ordo, am Tag des Gerichts. Und dabei war den Worten des hl. Augustinus folgend gewiss, dass „weitaus die Mehrzahl aller Menschen der ewigen Verdammnis anheimfallen“ sollte, „Non omnes, sed multo plures non fiunt salvi“ (Enchiridon ad Laurentium, c 97). Heilige Bilder konnten, indem sie daran erinnerten, einen Beitrag zur Rettung der Seelen leisten. Zugleich konnten sie der Hoffnung auf ein gnädiges Geschick |26|Ausdruck verleihen, die sich auch in Bildern und Gebeten aussprach. Nach der in Texten und Bildern gleichermaßen ablesbaren theologischen Auffassung war Maria, die Mutter Gottes, schon bei ihrer Geburt von der Erbsünde frei. Die legendäre Begegnung ihrer greisen Eltern an der Goldenen Pforte des Tempels von Jerusalem, nachdem ihnen getrennt voneinander die Geburt eines Kindes geweissagt worden war, galt als Präfiguration der jungfräulichen Geburt.