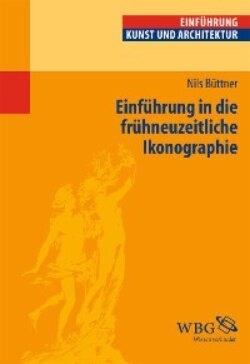Читать книгу Einführung in die frühneuzeitliche Ikonographie - Nils Büttner - Страница 8
2. Frühe Neuzeit
ОглавлениеEpochenschwellen sind nicht gegeben, sondern werden von Historikern entsprechend ihren jeweiligen Fragestellungen gesetzt. Genau wie die Geschichte nichts Vorgefundenes ist, sondern erst entsteht, wenn man beginnt, sich mit Gewesenem zu beschäftigen. In den Geschichtswissenschaften ist der Epochenbegriff „Frühe Neuzeit“ fest etabliert und durch die Einrichtung entsprechender Lehrstühle und die Edition von Buchreihen und Zeitschriften, die den Begriff im Titel führen, institutionalisiert (Neuhaus 2009; Höfele/Müller/Oesterreicher 2013). In der historischen und sozialwissenschaftlichen Forschung wird die Frühe Neuzeit dabei zumeist als Vormoderne gedeutet, aus der sich die europäische Gesellschaft der Moderne entwickelt hat. Grundlage dieser Vorstellung sind als historische Zäsur wahrgenommene Ereignisse und deren Folgen. So werden beispielsweise die Erfindung des Buchdrucks oder die Entdeckung Amerikas als Marker für den Beginn der Epoche in Anspruch genommen, die Revolutionen des 18. Jahrhunderts für deren Ende. Schon die Zeitgenossen haben dabei ein Periodenbewusstsein entwickelt. Und das bis heute wirkende Schema der historischen Einteilung in Altertum, Mittelalter und Neuzeit begegnet in dieser Ausdrücklichkeit erstmals 1685 bei Christoph Cellarius. Auch die Wahrnehmung der Ära des Buchdrucks oder der großen gesellschaftlichen und sozialen Umbrüche des 18. Jahrhunderts lässt sich in zeitgenössischen Quellen belegen. Dieses Epochenbewusstsein der Zeitgenossen arbeitete den Periodisierungsbemühungen der Geschichtswissenschaftler zu, die aus der historischen Distanz Entwicklungsstrukturen konstruieren, um historische Verläufe sichtbar zu machen. Dabei werden beispielsweise mit der zunehmenden „Disziplinierung“ oder der „Konfessionalisierung“ unterschiedliche Interpretamente in Anschlag gebracht, um den Epochenstatus der schon von den Zeitgenossen wahrgenommenen Periode nach Ende des Mittelalters zu beschreiben. Um das Phänomen des Absolutismus und die Entwicklung des „frühneuzeitlichen Machtstaates“ differenzierter zu beschreiben, prägte der Historiker Gerhard Oestreich 1969 den Begriff der „Sozialdisziplinierung“. Wo Oestreich eine Disziplinierung von oben wirken sah, die er als Wechselwirkung von innerlicher Selbstregulierung und obrigkeitlicher Disziplinierung deutete, betrachtete der französische Historiker und Philosoph Michel Foucault die Disziplinierung als Resultat anonymer „Machttechnologien“, die ausgehend |15|von deren Rändern die gesamte Gesellschaft durchdringen. Gefängnis, Klinik und Schule werden von Foucault als prototypische Instanzen der Vereinnahmung des Körpers sowie als Inbegriff und Modell der modernen „Disziplinargesellschaft“ beschrieben. Zugleich zeigte er auf, wie sich die Struktur der über Glauben und Wissen, Sinn und Sinnlichkeit geführten Diskurse, die sogenannten episteme, als für eine Epoche spezifisch interpretieren ließ. Mit dem Begriff episteme beschrieb Foucault, was innerhalb einer zugleich dadurch gekennzeichneten Epoche als wahr angenommen oder überhaupt innerhalb eines Diskurses verhandelt wird. Gerade für die frühe Neuzeit beschrieb er einen grundlegenden epistemischen Umbruch, innerhalb dessen die Wissensorganisation nach den Prinzipien der Ähnlichkeit und Verwandtschaft im 17. und 18. Jahrhundert durch eine neue Wissensordnung abgelöst worden sei. In der Kunstgeschichte wurde Michel Foucaults Konzept 1987 von Carsten-Peter Warncke aufgegriffen, der die frühe Neuzeit nicht mehr allein als Oberbegriff und Bündelung für die Epochen von der Renaissance bis zur Aufklärung verwandte, sondern als einen über die seinerzeit wirksamen Medienverständnisse klar konturierbaren Epochenbegriff (Heinen 2009).
Bilder als Epochensignum
Tatsächlich lassen sich in Bildwerken aus der Zeit zwischen etwa 1400 und 1800 innerbildliche Ordnungs- und Einheitsvorstellungen feststellen, die sie deutlich von früheren oder späteren Werken unterscheiden (Puttfarken 2000). Offensichtlich vollzog sich am Ende jener Epoche, die man schon bald als Mittelalter bezeichnete, ein allmählicher Wandel in der allgemeinen Anschauung, was Bilder seien und wie sie zu sein hätten. Diese veränderte Auffassung ist gleichermaßen in Texten ablesbar wie in den erhaltenen Bauten, Bildern und Objekten. Vor allem Bilder sind dafür eine wichtige Quelle, die seinerzeit in einem bislang nicht gekannten Ausmaß als Träger von Informationen wirksam wurden. Schon mehr als fünfzig Jahre bevor im 15. Jahrhundert durch den Druck mit beweglichen Lettern ein neues Zeitalter der vervielfältigten Information anbrach, hatte man mittels druckgraphischer Techniken Bilder reproduziert. Gedruckte Bilder wurden zu einem Massenmedium und entfalteten in einer in weiten Teilen illiteraten Gesellschaft ihre Macht. Weil sie aber noch nicht so omnipräsent waren, wie sie es heute sind, wurde Bildern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit entgegengebracht.