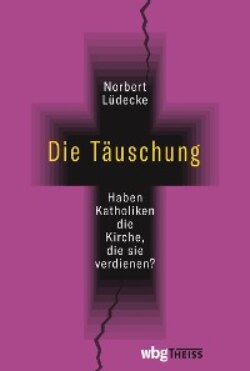Читать книгу Die Täuschung - Norbert Lüdecke - Страница 30
Beschwichtigung und Reintegration
ОглавлениеDie Politik der Bischöfe, durch organisierte Gespräche zu einer Beruhigung und Reintegration des deutschen Katholizismus zu gelangen und dabei die eigene Autorität im Modus des Gesprächs zu wahren und zu regenerieren, ging auf.174 Indem sie die Regie zu einer Kirchenversammlung übernahmen, für die sie Art und Umfang der Laienbeteiligung bestimmten, gelang es ihnen, auf die Kirche übergreifende Forderungen nach Demokratisierung abzuwehren und zugleich den (falschen) Eindruck zu erwecken, die Synode könne eine Möglichkeit sein, solche Forderungen wirksam werden zu lassen, könne selbst ein Schritt in diesem Prozess sein. So blieben selbst kritische Kräfte auf ihn bezogen.
Wo Reformkatholiken „Synodalität“ als katholischen Ausdruck für „Demokratie“ akzeptierten175, übersahen sie (und übersehen sie bis heute) dessen katho-semantische Entkernung: Demokratie in Anwendung auf die Kirche bedeutet nicht mehr die aus der gleichen Personwürde zwingend folgende gleichberechtigte Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess. Vielmehr ist sie auf eine allenfalls verfahrensgestützte Umgangsform unter fundamental Ungleichen herunterkatholisiert.176 So gelang es den Bischöfen, Ungleichheit zu überspielen, Gleichheit durch Gemeinsamkeit zu kompensieren und Fragen nach Wirksamkeit und Auswirkung der Synode in eine unbestimmte Zukunft zu verweisen.
Für die Verschleierung von Ungleichheit wurde (und wird) etwa die Metapher der „Spannung“ oder des „Spannungsverhältnisses“ genutzt. So zählte Kardinal Döpfner in seinem Schlussbericht zur Synode zu den theologischen Leitlinien an erster Stelle „Spannung und Ausgleich zwischen kirchlicher Tradition und gegenwärtiger Situation“177. Die Spannungsmetapher erweckt den Eindruck zweier Pole, die sich im Gleichgewicht halten. Sie überspielt den unterschiedlichen Geltungsrang von Heiliger Schrift und Tradition in der Auslegung der mit einem besonderen Geistbeistand ausgestatteten Bischöfe einerseits und der jeweiligen Zeitdiagnose andererseits. Personalisiert wiederholt sich das, wenn es bei Döpfner heißt:
„Die Spannung zwischen bischöflichem Leitungsamt und Dienst der Laien und Priester – in je eigenem Auftrag – darf nicht aufgelöst werden, da sie für das Leben in der Kirche entscheidend ist. Hier haben wir einen ‚Lernprozeß‘ durchgemacht, von dem das Gelingen der Synode abhing. Ich glaube, sagen zu können, daß die nicht-bischöflichen Synodalen ‚lernten‘, wie die Mitsynodalen-Bischöfe in ihrem Amt einen entscheidenden Dienst der Einheit [als Chiffre für formalen Geltungsvorrang; N. L.] in unserer Ortskirche und der Weltkirche haben. Die Bischöfe lernten immer mehr, wie auch kritisches Engagement ein Beispiel kirchlichen Sinnes sein kann“178.
Für den Synodenprozess wurden die Gemeinsamkeit und der Umgangsstil herausgehoben, ohne den Hinweis auf die bleibende Unterschiedenheit zu unterlassen:
„Es ist allen herzlich zu danken, die dafür Opfer gebracht haben, daß unsere Arbeit auch unter schweren Belastungsproben ein synhodos, ein Aufeinanderzugehen wurde, nicht allein durch Schaffung eines guten Klimas, sondern durch die Begegnung im gemeinsamen Suchen nach dem Willen des Herrn in der konkreten Stunde. Wir haben manchen Erwartungen zum Trotz zusammengehalten. Wohl aber wurden wir zu einem Prozeß gezwungen, dem wir einen neuen Stil des Miteinanderredens und Miteinanderumgehens zwischen Bischöfen, Priestern und Laien verdanken. Den möchten wir nicht mehr missen. Was wäre es für ein Erfolg der Synode, wenn es gelänge, diese gute Erfahrung in jede Gemeinde, Gemeinschaft, Dienststelle und alle Räume der Kirche hinein zu vermitteln! Die Erfahrung nämlich, daß ehrliche Bereitschaft zur redlichen Kommunikation Verkrampfungen lockern und Konflikte lösen kann und eine unverzichtbare Voraussetzung ist für Brüderlichkeit, Vertrauen, Frieden und Einheit. Es gilt darum, eine der entscheidenden Aussagen des II. Vatikanischen Konzils zu verwirklichen: Kirche als das eine Volk Gottes, in dem jeder seine unaufgebbare und unverwechselbare Sendung hat zum Wohle des Ganzen und für den Dienst an der Welt. … Die Aufgabe bleibt, diese Gemeinsamkeit weiterhin zu praktizieren“179.
Die Ergebnisse werden zugunsten des Ereignisses als zweitrangig abgewertet. Wichtig sei, dass eine solche nie dagewesene Synode geschehe und wie sie geschehe, das allein könne für die Weltkirche exemplarisch sein.180
In der katholischen Kirche die Frage „Quis iudicabit?“ („Wer entscheidet?“) zu stellen, heißt, sie zu beantworten. Während sich die nichtbischöflichen Gläubigen auf die Moral des Episkopats verlassen müssen, kommt diesem die rechtliche Kompetenz zu, über die Einhaltung der Spielregeln zu entscheiden, also – im amtlichen Sprachgebrauch – besagten „Dienst der Einheit“ zu leisten. Um diesen uneinholbaren strukturellen Vorteil zu kaschieren, durfte außerdem das probate, abstrakte Makro der Relativierung von Strukturen auch hier nicht fehlen:
„Wir sind dankbar, daß wir hier und dort dienlichere Strukturen für unseren pastoralen Dienst aufzeigen und beschließen konnten. Die Synode hat aber auch gelernt, daß Strukturen allein leere und starre Hohlformen bleiben, ja zu Hindernissen werden, wenn sie nicht mit Geist und Herz gefüllt werden. Gut funktionierende organisatorische und strukturelle Elemente in der Kirche sind unverzichtbar. Aber Strukturen für sich allein sind ohnmächtig und anfällig für manche Gefahren“181.
Die Verharmlosung von Struktur- und Rechtsfragen wirkt systemstabilisierend. Wer Strukturfragen bagatellisiert, ist möglicherweise Profiteur des Status quo.182
Bilanzierungen wurden ohne Vorkehrungen für eine Überprüfung der Wirksamkeit oder Kontrolle der Umsetzung in eine unbestimmte Zukunft geschoben, dem Herrn der Welt anvertraut. Zugleich wurde mit Pathos der Eindruck erweckt, die strukturell beendete Synode könne mental auf Dauer gestellt werden:
„Es wäre mehr als vermessen, in dieser Stunde, da wir es noch kaum glauben können, daß die Synode endet, Bilanz zu ziehen. Ob die Frucht unserer Arbeit brauchbar ist, das wird erst in Jahren und Jahrzehnten zu beurteilen sein“183. „Was also bleibt am Ende dieser Synode? Eine Kirche, die Christus hier und heute in seinen Brüdern dient. Wir verkünden das nicht als große Proklamation, sondern bringen es als inständige Bitte mit verhaltener Stimme und sehnsüchtigem Herzen vor unseren Herrn. … Die Synode endet – die Synode beginnt. Amen“184.
Zu wenige erkannten diesen Trick sofort, noch weniger spiegelten ihn zur Entlarvung. So erklärt eine Synodalin im Rückblick zum Abschiedsmotto Döpfners: „Trost und Hoffnung sollte den an der Effizienz der Arbeit zweifelnden Synodalen mit auf den Weg gegeben werden. Die meisten wußten, die anderen ahnten, daß diese Devise keiner realistischen Einschätzung der Situation entsprach“185.
An den synodalen Diskussionen beteiligten die Bischöfe sich eher zurückhaltend186, und manche entzogen sich unter Berufung auf Zeitmangel auch den mühsamen Auseinandersetzungen in den Sachkommissionen.187 Auf diese Weise vermieden sie, sich allzu gemein mit den übrigen Diskutanten zu machen. Schon damals funktionierte als Kompensation, wenn Bischöfe außerhalb des offiziellen Geschehens etwa in Pausengesprächen als jovial empfunden wurden oder vereinzelt sogar das Begegnungs- und Informationszentrum der kritischen Arbeitsgemeinschaft Synode betraten, was bereitwillig als bewusste Geste von hoher Symbolkraft aufgefasst wurde.188 In dieser schlichten Freude über die Zuwendung von Hierarchen im persönlichen Umgang zeigte sich die grundlegend unveränderte Anerkennung der Hierarchie, der tiefe Respekt vor der Oberkirche und ihrem Vorrang.
An diesem Vorrang ließen die Bischöfe auch keinen Zweifel zu. Schon in seiner Eröffnungsrede als Synodenpräsident hatte Kardinal Döpfner die keineswegs eingeebnete Leitungsgewalt des Episkopats signalisiert.189 Ihre gewollte Anordnung als „Schwarzer Block“ ließ die Bischöfe optisch aus der Synodengemeinschaft herausragen. Und der Blockoptik entsprach ihr Verhalten. Die Bischofskonferenz tagte vor jeder Vollversammlung und ließ in ihr eine gemeinsame Stellungnahme vortragen. Obschon man durchaus kontroverse Meinungen im Episkopat vermutete, wich selten ein Bischof in seinem Beitrag von der offiziellen gemeinsamen Position ab, ein Agieren, das eher als defensiv denn als kooperativ empfunden wurde.190 Dennoch empörte Kardinal Döpfner sich, als ein Pfarrer während der dritten Synodenvollversammlung die Bischöfe als „Fraktion“ und „organisierte Minderheit“ bezeichnete und die übrigen Synodalen aufforderte, ebenfalls Fraktionen zu bilden. Döpfner betonte, die Bischöfe hätten eine besondere Aufgabe, seien aber keine Fraktion. „Um Gestalt und Geist der Synode klar zu erhalten, dürfe es zu keiner Fraktionsbildung kommen“191. Da war es wieder, das Humpty-Dumpty-Syndrom: Wir mögen aussehen wie eine Fraktion, wir mögen sprechen wie eine organisierte Meinungsgruppe und uns verhalten wie eine Fraktion, wir sind dennoch keine, weil – ja, weil wir das eben sagen. Und deshalb sollen sich auch die anderen Synodalen nicht zu Meinungsgruppen zusammenschließen dürfen – was gleichwohl faktisch geschah.192
Von ihrer Leitungsgewalt machten die Bischöfe nach ihrem Ermessen Gebrauch. So ließen sie etwa das Thema der Zulassung verheirateter Männer zur Priesterweihe (viri probati) ebenso wenig als Beratungsgegenstand zu193, wie Fragen zu Sinn und Gestaltung der menschlichen Sexualität nur in Gestalt eines Arbeitspapiers als Hintergrundinformationen zum Synodenbeschluss „Ehe und Familie“ veröffentlicht werden durften.194 Auf diesen Beschluss hatten die Bischöfe besonders intensiv Einfluss genommen, indem sie Änderungen bei den Aussagen zur Empfängnisverhütung, zu vorehelichem Geschlechtsverkehr und zu pastoralen Hilfen für wiederverheiratete Geschiedene als unerlässlich verlangten. Geplante Voten über die kirchliche Anerkennung eines faktischen Eheendes bei permanenter Untreue und einer reinen Zivilehe als gültige, wenngleich nicht sakramentale Ehe, verhinderten sie mit ihrem Veto.195 Zwar kam es auch bei diesen Themenkomplexen zu heftigen Auseinandersetzungen in der Synode. Insgesamt war aber wohl die Kompromissbereitschaft des sozial wie theologisch und politisch doch eher homogenen Plenums, das mehrheitlich aus Synodalen im unmittelbaren kirchlichen Dienst (Verwaltung, Diözesangremien, kirchliche Organisationen und Verbände) bestand, stärker ausgeprägt als das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Die Bischöfe stellten sich dem Gespräch und erlaubten emotionale Entladung, blieben aber bei ihrer inhaltlichen Position. Zwar konnte zäh um jeden Textbestandteil gekämpft werden, strukturell blieben die nichtbischöflichen Synodalen aber in einer Letztohnmacht. Sie mussten sich der Erfahrung beugen, dass „die Forderungen der Bischöfe schon in den Kommissionsberatungen berücksichtigt werden mußten, sollte die Gesamtvorlage schließlich nicht an ihrem Einspruch scheitern“196.
Die zeitgenössische Berichterstattung verzeichnete bisweilen eine gedrückte Stimmung der Synodalen, anfängliche Euphorie sei bald Ernüchterung gewichen. Um das Gesamtprojekt Synode nicht zu gefährden, begnügten sich die Synodalen mit einer Art routinierter Pragmatik.197 Entsprechend wurde bei allem in dieser Intensität erstmaligen katholischen Austausch mit kontroversen Diskussionen, ja Streit und mühsam errungenen Kompromissformeln und auch Erfahrungen von Solidarität und Wertschätzung über unterschiedliche theologische und politische Überzeugungen hinweg doch gefragt, wie viel das zählt,
„wenn sich das alles letztlich als Scheingefecht auf einer mit teurem Aufwand bereitgestellten Spielwiese herausstellt? Im nachhinein muß festgestellt werden, daß selbst ein noch so konsequentes Auftreten der Synodalen an der selbstherrlichen kurialen und episkopalen Amtsautorität gescheitert wäre“198.