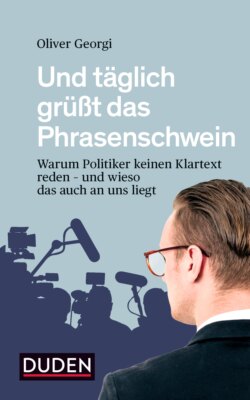Читать книгу Und täglich grüßt das Phrasenschwein - Oliver Georgi - Страница 6
ОглавлениеEinleitung:
Phrasen, Floskeln, leere Sätze
Wenn Politiker und Politikerinnen reden, sind Floskeln meist nicht weit. Politiker handeln mit Augenmaß, betonen ihre große Einigkeit, wollen sich nach Wahlniederlagen ehrlich machen und die Leitplanken ihres Handelns neu ausrichten, weil es an der Tatsache nichts zu beschönigen gibt, dass das Profil dringend wieder geschärft werden muss. Sie wenden Schaden vom Land und von ihrer Partei ab, sagen Dinge in aller Deutlichkeit und versachlichen die Diskussion mit einer Dynamik, die authentisch und zukunftsfähig ist – Politikerinnen und Politiker aller Parteien lieben solche Wortformeln und Stanzen, mit denen sie viel reden können, aber wenig sagen müssen. Besonders Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eine Meisterin dieser »lingua blablativa«, wie der Soziologe Niklas Luhmann diese Art zu sprechen genannt hat.1 Egal, wo Merkel auftritt, ob bei der Eröffnung des Handwerkstages, einem europäischen Gipfeltreffen in Brüssel oder bei einer Regierungserklärung im Bundestag, ihre Reden gleichen sich in ihrer Floskelhaftigkeit oft so sehr, dass das Zuhören schwerfällt.
Der Duden definiert eine Phrase als eine »nichtssagende Aussage« oder Redensart, also als einen Begriff, dessen ursprünglicher Sinn einem »rhetorischen Automatismus« gewichen ist2, wie Wikipedia ergänzt, weil er inflationär und zu oft ohne kausale Konsequenz verwendet wird. Das Wort Floskel ist ein Synonym dazu, weshalb in diesem Buch von beiden Begriffen die Rede sein soll. Selbst Politiker, denen gemeinhin gute rhetorische Fähigkeiten attestiert werden, sind vor dem Phrasenschwein nicht gefeit, im Gegenteil. Als der heutige FDP-Vorsitzende Christian Lindner am 14. Dezember 2011 überraschend seinen Rücktritt als FDP-Generalsekretär erklärte, geriet sein kurzer Vortrag im Berliner Thomas-Dehler-Haus zu einer Sternstunde politischer Kommunikation – im negativen Sinn. »Es gibt den Moment, in dem man seinen Platz frei machen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen«, sagte Lindner. »Meine Erkenntnis hat für mich zur Konsequenz, dass ich aus Respekt vor meiner Partei und vor meinem Engagement für die liberale Sache mein Amt niederlege. Dadurch ermögliche ich es dem FDP-Bundesvorsitzenden Philipp Rösler, die wichtige Bundestagswahl 2013 […] mit neuen Impulsen zu einem Erfolg für die FDP zu machen.«3 Erkenntnis, Dynamik, Respekt, Engagement, Impuls – von alldem hatte Lindner gesprochen und seinem Publikum damit quasi ein Best-of des politischen Phrasenvokabulars geboten. Nur gesagt hatte er wenig – die Gründe für seinen überraschenden Rückzug blieben auch nach seiner Rede so nebulös wie davor.
Ist das der Grund, warum Politiker so formelhaft reden: Weil sie ihre echten Beweggründe vor ihren Wählern verbergen und krampfhaft den Anschein wahren wollen, dass Streit, Missgunst und Konkurrenzkampf in der Politik nicht vorkommen? Weil sie ihr Volk mit ihren Floskeln und Stanzen bewusst in die Irre führen wollen, wenn sie »Bürokratieabbau« sagen und damit eigentlich den Abbau des Kündigungsschutzes meinen, wie die Journalisten Daniel Baumann und Stephan Hebel 2016 in ihrem Buch Gute-Macht-Geschichten schrieben?4 Dass die politischen Vertreter ihre Wähler durch ihre Sprache vorsätzlich täuschen wollten, ist in Zeiten erstarkender (rechts-)populistischer Bewegungen nicht nur bei der AfD und Pegida ein beliebter Topos – aber ist diese Erklärung nicht viel zu einfach?
Die Phrasen- und Formelhaftigkeit der Politikersprache sei ein Grund dafür, warum immer weniger Menschen ihre Volksvertreter glaubwürdig fänden, gestand der langjährige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust (CDU) 2012 in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung – den Vorwurf der bewussten Irreführung wies er jedoch zurück.5 Politiker verwendeten ihre Phrasen »meist gar nicht in der bösen Absicht der Verkleisterung oder Vertuschung« – ihre Sprache sei eher ein »Ausdruck der Sozialisation in der Politik«. Viele Volksvertreter hätten sich von den Jugendorganisationen ihrer Parteien über die Kommunalpolitik bis in die »höheren Ebenen« hochgearbeitet und dabei fast zwangsläufig die »herrschende Terminologie« übernommen, um die »eigene Kompetenz« zu beweisen. Von Beust verglich das mit der Sprache angehender Mediziner, die »aus Stolz und Anpassung« den Duktus ihrer Zunft übernehmen und damit ihre Zugehörigkeit zum Orden beweisen – um den Preis, eine immer hermetischere Sprache zu verwenden. Von Beust machte aber noch einen zweiten Grund für die immer größere Formelhaftigkeit der politischen Sprache aus: die Angst von Politikern und Politikerinnen, sich eine Blöße zu geben und Autorität zu verlieren, wenn sie ihren Zorn und ihre Trauer ehrlich zeigten. »Wenn ich gestanzte Formulierungen nehme, gehe ich kein Risiko ein« – nach diesem Motto handelten viele Politiker, schrieb von Beust und nahm dafür auch die Medien in Mithaftung, die zur »Ritualisierung der Politik« beitrügen und denjenigen bestraften, der sich nicht an die Regeln halte. Ist das so? Reagieren Politiker mit ihren Floskeln lediglich auf den Druck der Öffentlichkeit, in der Scheitern und Schwäche heutzutage nicht mehr vorkommen dürfen? Sind es vor allem die immer kürzeren Erregungszyklen in der medialen Berichterstattung, die teils auch kleine Abweichungen vom rhetorischen Mainstream schnell zum großen Skandal hochspielt und Politikern das Signal vermittelt, dass es besser ist, vage zu bleiben, und sich nicht lohnt zu polarisieren? Oder liegt es auch an den widersprüchlichen Erwartungen der Wähler, die sich »authentische« Politiker mit Charisma wünschen, dann aber mitunter wie vor den Kopf gestoßen sind, wenn diese das Versprechen einlösen und sich tatsächlich unangepasst verhalten wie Peer Steinbrück im Bundestagswahlkampf 2013? »Belastbar«, »authentisch«, »ergebnisoffen«, solche Floskeln sind kaum ohne den Rückbezug auf diejenigen zu verstehen, die ebendiese politischen Repräsentanten wählen.
Es ist an der Zeit, sich der Dreiecksbeziehung zwischen Politikern, den Wählern und den Medien wieder bewusster zu werden – auch weil die politische Kommunikation vor allem in der Ära Merkel so phrasenhaft geworden ist, dass es unserer Demokratie längst zu schaden beginnt. Es ist auch Merkels schablonenhafte, technokratische Sprache, die das rechtspopulistische Versprechen der AfD, endlich wieder jenen »Klartext« zu reden, den die etablierten Parteien verlernt hätten, auf so fruchtbaren Boden fallen lässt. Zugleich hat das Erstarken der AfD in den letzten Monaten zu einer zunehmenden Verrohung und Entgrenzung des politischen Vokabulars selbst im Bundestag geführt. Ob »Asyltourismus«, »Anti-Asyl-Industrie«, »Kopftuchmädchen« oder Alexander Gaulands »Vogelschiss«: Im öffentlichen Diskurs werden plötzlich wieder Sätze gesagt, die vor kurzer Zeit noch undenkbar gewesen wären. Offen artikulierter Hass gegen Ausländer und Flüchtlinge, abfällige Bemerkungen gegen das »System«, dessen Sturz zu planen die Rechtspopulisten öffentlich verkünden, immer häufigere rhetorische Provokationen an der Grenze des Sagbaren, die zu verschieben das offen erklärte Ziel der AfD ist: Auch das ist, neben der Phrasenhaftigkeit vieler Politiker, die Lage der politischen Rhetorik im Jahr 2019.
Wie könnte ein Ausweg aus diesem Dilemma aussehen, den Phrasen abzuschwören und eine präzisere, offenere Sprache zu sprechen, ohne damit zu ihrer Verrohung beizutragen? Wie kann der verständliche Wunsch vieler Wähler nach mehr Authentizität auch in der politischen Kommunikation eingelöst werden, ohne »Klartext« mit der verantwortungslosen Sprache der (Rechts-)Populisten zu verwechseln? Darum soll es in diesem Buch gehen. Und um noch etwas: um mehr Selbstkritik und Ehrlichkeit auch bei uns selbst, den Wählern und den Journalisten. Denn auch wir nutzen jeden Tag Phrasen – und das häufig aus denselben Gründen wie die politischen Vertreter. Wir wollen Dinge sprachlich verzögern, weil wir uns noch nicht festlegen mögen oder können (etwa wenn wir sagen, morgen sei »auch noch ein Tag«). Wir wollen Dinge verschleiern, weil wir eine Festlegung scheuen, und finden etwas »interessant«, obwohl »völlig daneben« viel ehrlicher wäre. Und wir sagen viele Phrasen leichtfertig dahin, weil sie nicht nur zur Sprache der Höflichkeit gehören, sondern oft auch Ausdruck von Sprachökonomie sind. Phrasen schaffen Distanz, geben Zeit zur Orientierung und ermöglichen es uns und unseren Gesprächspartnern, Dinge blitzschnell in einen Bedeutungskontext zu setzen. Phrasen sind für uns also mindestens so praktisch wie für die Politiker. Deshalb wäre es unehrlich, mit dem Finger immer nur auf ihre Floskeln zu zeigen.
Trotzdem müssen es sich unsere Volksvertreter mehr als »normale Menschen« gefallen lassen, für ihre oft blutleere Sprache kritisiert zu werden. Denn Sprache ist nicht losgelöst von der Politik, sie macht sie auch. Nicht nur was Politiker tun, kann die Gegenwart und die Zukunft verändern. Sondern auch die Art und Weise, wie sie darüber reden.