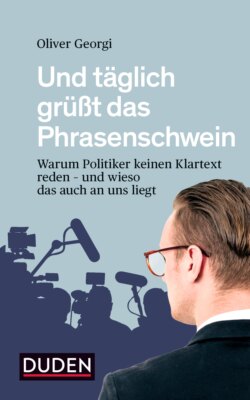Читать книгу Und täglich grüßt das Phrasenschwein - Oliver Georgi - Страница 7
Оглавление1 Vertrauen
Im Leben ist es ja so: Man kann auf vieles verzichten, auf dreilagiges Toilettenpapier, handgemahlenen peruanischen Bohnenkaffee und sogar auf rechtsdrehende Joghurtkulturen in Heumilch, aber wenn das Vertrauen fehlt, dann wird die Existenz schnell zu einer trüben Veranstaltung. Ob in der Ehe, beim Rohfisch-Japaner um die Ecke oder dem Arzt, der eine Reizung des Blinddarms von dessen Durchbruch unterscheiden soll – ohne Vertrauen ist alles ein Krampf, und das gilt nicht nur für den Blinddarm. In der Politik hingegen verhält es sich mit dem Vertrauen genau umgekehrt: Je mehr es davon gibt, desto gefährlicher wird es. Kaum jemand stellt das regelmäßig so eindrucksvoll unter Beweis wie Angela Merkel. Wenn die Kanzlerin einem langjährigen Mitstreiter öffentlich ihr Vertrauen ausspricht, weil er sich bei einem hässlichen Skandal oder beim Leugnen einer anderen, längst offensichtlichen politischen Dummheit hat erwischen lassen, kann der Betroffene hoffen, dass der Kelch noch einmal an ihm vorübergeht. Hat die Kanzlerin allerdings »vollstes Vertrauen«, dann ist völlig klar: maximal noch 72 Stunden, Kisten packen, Anschlussverwendung, notfalls bei der EU oder im Bahn-Vorstand.
Die Liste derer, denen Merkel in ihrer Zeit als Kanzlerin schon gnadenlos vertraut hat, um sie kurz darauf, als es nicht mehr zu vermeiden war, noch gnadenloser fallen zu lassen, ist lang. Der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung, der 2009 wegen der Kundus-Affäre in Afghanistan in Ungnade gefallen war; der unglückselige Bundespräsident Christian Wulff, der 2011 wegen der Affäre um einen Hauskredit und die Bezahlung eines Urlaubs durch den Unternehmer David Groenewold in Verruf geriet; der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der bei seiner Doktorarbeit nicht nur bei der F.A.Z. abgeschrieben hatte; sogar Annette Schavan, eine enge Freundin Merkels, die 2013 ebenfalls über eine Plagiatsaffäre im Zusammenhang mit ihrer Doktorarbeit stolperte: Ihnen allen sprach Merkel auf dem Höhepunkt der Krise ihr »volles« oder sogar ihr »vollstes« Vertrauen aus. Und machte der Öffentlichkeit damit unmissverständlich klar: Wenn die Kanzlerin so etwas zu diesem heiklen Zeitpunkt schon eigens betont, kann die Demission nicht mehr weit sein. Der Blogger Sascha Lobo errechnete, dass in 73 Prozent der Fälle, in denen Merkel während ihrer zweiten Amtszeit einem deutschen Politiker ihr »volles Vertrauen« ausgesprochen hatte, nach durchschnittlich 33,3 Tagen der Rücktritt erfolgte.1 Wohl nie zuvor hat eine Politikerin einen zentralen Begriff der Politik rhetorisch so fundamental ins Gegenteil verkehrt.
Brandgefährliches Vertrauen ist aber mitnichten nur ein Alleinstellungsmerkmal Angela Merkels. Auch sonst wird einander in der Politik vertraut, dass es eine wahre Freude ist und man vor lauter Ergriffenheit manchmal am liebsten das Taschentuch zücken möchte. Ob eine »vertrauensvolle Zusammenarbeit«, auf die politische Partner sich zu Beginn einer neuen Koalition einschwören, oder die »Kultur des Vertrauens«, die meist erst dann betont wird, wenn es mit dem Vertrauen schon längst nicht mehr so weit her ist: Allenthalben machen Politikerinnen und Politiker in ihren Äußerungen klar, dass Vertrauen eine der wichtigsten Kategorien im politischen Alltag ist.
Als der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) im Winter 2017 nach einem quälend langen Machtkampf seinen Platz in der Staatskanzlei für seinen Widersacher Markus Söder räumte, betonten danach beide, wie sachlich sie miteinander gerungen hätten und wie »vertrauensvoll« sie auch künftig zusammenarbeiten würden. Das klang aufgeräumt und edel: Zwei erbitterte Kontrahenten begraben ihre kleingeistige Fehde zugunsten der größeren Sache und hören endlich auf mit dem Kindergarten. Man musste auf Fernsehaufnahmen aber nicht erst in beider Gesichter blicken, um sich an die alte Weisheit zu erinnern: Je überschwänglicher zwei Politiker ihr gegenseitiges Vertrauen betonen, desto härter werden in den Taschen schon die Fäuste geballt.
Nun kann man sagen: Wozu überhaupt diese mühsamen Verklausulierungen? Weiß nicht ohnehin jeder, dass in Wirklichkeit alles viel hässlicher ist, weil echtes Vertrauen in der Politik, wenn überhaupt, nur so lange existiert, wie es dem eigenen Fortkommen nicht schadet? Warum sagt Angela Merkel nicht einfach, wie es ist, wenn sie wieder mal einen Minister entlässt, zu dem sie »vollstes Vertrauen« hat: Dass sie die Nase voll hat von ihm, weil er es trotz aller Mahnungen noch immer nicht übers Herz gebracht hat, zu seinen Verfehlungen zu stehen, und dass er jetzt schleunigst vom Hof muss, damit der Schaden nicht auch auf sie selbst zurückfällt? Und wieso kann Horst Seehofer nicht einfach öffentlich eingestehen, dass er Söder partout nicht ausstehen kann, in drei Gottes Namen aber nun einmal weiter mit ihm zusammenarbeiten muss, auch wenn das offenbar alles andere als ein Vergnügen ist?
Die Antwort auf diese Fragen ist simpel: Weil man sich in der Politik tunlichst erst dann abwendet, wenn jemand wirklich nicht mehr zu retten ist – man weiß schließlich nie, ob die Affäre nicht doch noch vorübergeht und man es weiter miteinander aushalten muss. Wie stünde man denn da, wenn man mit größtmöglicher Empörung mit einem Vertrauten gebrochen hat und der dann unvermutet doch wieder von den Toten aufersteht? Auch könnte bei zu schnellen Distanzierungen rasch der Eindruck von Missgunst entstehen – ist man bis kurz vor dem bitteren Ende des Lobes voll, kann einem hernach hingegen niemand vorwerfen, man habe insgeheim schon lange die Messer gewetzt. Politik, das ist – zumal in unserem medialen Zeitalter – auch eine große Bühne. Und Politiker wissen instinktiv, dass das Publikum Dolchstöße im Vorhinein nicht goutiert, Krokodilstränen im Nachhinein aber besser wegwischt. Hinzu kommt, dass die Sache mit dem Vertrauen natürlich ein Spiel mit offenen Karten ist, schließlich ist es im echten Leben genauso: Wenn etwas über Gebühr betont wird, ist es meist nicht mehr allzu ernst gemeint. Warum sollten die Politiker und Politikerinnen, von denen nun mal größtmögliche Volksnähe eingefordert wird, es dem Volk also nicht auch in dieser Hinsicht gleichtun?
Diese durchaus nachvollziehbare Taktik hat allerdings Folgen. Nach der Studie »Trust in Professions 2018« der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hatten nur 14 Prozent der Befragten Vertrauen in Politiker – damit lag diese Berufsgruppe weit abgeschlagen auf Rang 20, noch hinter Versicherungsvertretern, Werbefachleuten, Schauspielern oder Unternehmern. Ganz vorne in der Liste: Feuerwehrleute, Sanitäter und Krankenschwestern.2 Nach Ansicht vieler Wissenschaftler belegt das zwar nicht unbedingt, dass die Menschen allgemein demokratieverdrossen sind oder das System generell infrage stellen. Aber ihr Misstrauen in die handelnden politischen Vertreter und die Medien ist gewachsen. Das liegt, zugegeben, zum großen Teil an inhaltlichen Fragen – an gebrochenen Wahlversprechen, am persönlichen Fehlverhalten von Politikern oder an der immens gestiegenen Komplexität politischer Sachverhalte. Wenn es früher um die Einführung der 35-Stunden-Woche ging, dann war das von den allermeisten leicht nachzuvollziehen, weil es ihre Lebenswelt unmittelbar betraf und die wenigen Optionen klar auf dem Tisch lagen. Wenn heute aber über komplexe Großthemen wie die Eurorettungspolitik verhandelt wird, haben mitunter selbst Experten Mühe, das Thema ganz zu erfassen – und die Laien bleiben nur noch verwirrt zurück. Es ist diese wachsende Unüberschaubarkeit der politischen Themen, die bei vielen Wählern das Gefühl der Machtlosigkeit und des Misstrauens verstärkt hat.
Aber, und das ist ein wichtiger Punkt: Es hat auch mit einer politischen Kommunikation zu tun, die in den letzten Jahren, auch bedingt durch die häufigen Großen Koalitionen und den geradezu harmoniesüchtigen politischen Diskurs, immer formelhafter geworden ist. Viele Debatten werden mittlerweile so ängstlich geführt, dass echte Kontroversen, die die Unterschiede zwischen den politischen Positionen deutlich machen könnten, zunehmend ausbleiben. Leichtfertig dahingesagte Theater-Floskeln wie das »volle Vertrauen« verstärken noch diese fatale Sprachlosigkeit. Wenn Politikerinnen und Politiker schon bei so fundamentalen Begriffen des menschlichen Miteinanders offenkundig flunkern: Wie sollen die Wähler ihnen dann erst vertrauen, wenn es inhaltlich ernst wird?
»Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt«, hat der Schriftsteller Franz Kafka einmal geschrieben. Oder, um mit Angela Merkel zu sprechen: »Am Ende ist Vertrauen genau die Währung, mit der gezahlt wird.«3 Politiker wissen nur zu gut um den fundamentalen Wert dieser Währung. Auch deshalb sprechen sie nicht bloß nach Wahlniederlagen gern davon, dass sie das »verlorene Vertrauen« ihrer Anhänger oder Wähler jetzt schnell zurückgewinnen wollen. Doch auch dieses Versprechen nach großen Enttäuschungen ist längst so offensichtlich zur Formel erstarrt, dass nur noch die wenigsten Wähler wirklich hoffen dürften, dass sich am Verhalten und der Kommunikation ihrer politischen Repräsentanten mit ihnen schnell grundlegend etwas ändern würde.
Ein gutes Beispiel dafür, wie nachhaltig die falsche Vertrauensrhetorik das Vertrauensverhältnis zwischen Politikern, ihrer Partei und den Wählern beschädigen kann, bot nach der letzten Bundestagswahl die SPD mit ihren »ergebnisoffenen Verhandlungen« mit der Union. Rhetorisch ist der Begriff »ergebnisoffen« nachgerade genial. Um das zu verstehen, sollten Sie sich kurz folgende Szenerie vorstellen: Sie müssen das Unangenehmste tun, das in Ihrem Leben vorstellbar ist, und leider ist es so unausweichlich wie das Amen in der Kirche. Sagen wir, ein gemeinsames Weihnachtsfest mit allen Verwandten steht an, das nicht nur Ihnen und Ihrer Frau, sondern vor allem Ihren Kindern die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Trotzdem glauben Sie, dass es keine Alternative zu ihm gibt, weil Ihre Eltern Ihnen sonst mit der Enterbung drohen. Dummerweise haben Sie vor Ihren Kindern bis vor Kurzem laut verkündet, dass Sie so etwas nie tun würden, selbst mit vorgehaltener Waffe nicht, und waren eigentlich ziemlich stolz auf Ihren Mut. Und jetzt stehen Sie vor dem Dilemma, das Unausweichliche mit dem größtmöglichen Ekel, zu dem Sie fähig sind, als (wenn überhaupt!) unwahrscheinliche Option verkaufen zu müssen, weil Ihnen sonst der größte Ärger Ihres Lebens droht. Was also tun? Richtig: Sie müssen Wahlfreiheit vortäuschen, um das Vertrauen, das Ihre Kinder in Sie setzen, nicht zu verspielen. Also rufen Sie »ergebnisoffen« bei Ihren Eltern an, obwohl Sie das Ergebnis des Telefonats längst kennen.
In einem vergleichbar furchtbaren Dilemma steckten die Sozialdemokraten im Herbst 2017. Als die SPD-Spitze nach der Bundestagswahl schließlich doch Sondierungsgespräche mit der Union über die Bildung einer Großen Koalition eingehen wollte, musste sie ihrer erzürnten Basis einen 180-Grad-Schwenk verkaufen. Die SPD werde in die Opposition gehen, hatte der damalige Parteivorsitzende Martin Schulz am Wahlabend unter lautem Jubel angekündigt und dieses Versprechen danach gleich mehrfach wiederholt. Doch nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche war davon keine Rede mehr, die SPD stand plötzlich unter großem Druck: Wenn sie ihr Versprechen nicht kassierte, würde sie für Neuwahlen verantwortlich gemacht werden, die in Berlin kaum jemand wollte. Schulz und die gesamte Parteispitze standen vor dem Kunststück, womöglich einen offenkundigen Wortbruch begehen zu müssen, ohne dass er so aussehen durfte. Also verlegte sich Schulz bei seiner Argumentation auf die Kunst der Rosstäuschung: Die SPD lege sich mit der Aufnahme von Sondierungsgesprächen keinesfalls schon auf eine Große Koalition fest, sondern werde »ergebnisoffen« in die Verhandlungen mit der Union gehen, versprach er auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2017 in Berlin. Eine Autosuggestion, der die Delegierten nach einer stundenlangen heftigen Debatte zustimmten – und die fortan die »ergebnisoffene« Sprachregelung bildete. Dabei ist der Begriff »ergebnisoffene Verhandlungen« eigentlich eine Tautologie – schließlich ist das Ergebnis bei Verhandlungen in der Regel nie vorher bekannt und also immer »offen«, sonst wären es ja keine Verhandlungen.
Natürlich durchschaute selbst der ahnungsloseste Genosse schnell, dass das Wort, das nur vordergründig keine Vorfestlegung auf die Große Koalition zu bedeuten schien, genau sein Gegenteil zu kaschieren versuchte. Schließlich machte die Parteispitze längst keinen Hehl mehr daraus, dass sie im Zweifel den Wortbruch durch eine erneute Große Koalition der Ungewissheit von Neuwahlen vorziehen würde und ein »Nein« die Partei ihrer Ansicht nach nur noch weiter in die Krise stürzen könnte. Das Mitgliedervotum war also von Anfang an nicht wirklich »ergebnisoffen«. Wenn es um das Thema Vertrauen geht, hat der rhetorische Kniff sein Ziel deshalb definitiv verfehlt. Im Gegenteil: Was als »vertrauensbildende Notlösung« gedacht war, um vor der eigenen Parteibasis den Anschein der Wahlfreiheit und der Aufrichtigkeit zu wahren, dürfte vielen Genossinnen und Genossen nur als weiterer Beleg dafür gedient haben, dass diese Parteiführung ihr Vertrauen endgültig nicht mehr verdient habe.
Was hätte die SPD stattdessen tun sollen? Ganz einfach: Sie hätte ihrer Partei reinen Wein einschenken und viel offener kommunizieren sollen, warum es sowohl gewichtige Argumente für neuerliche Gespräche mit der Union als auch mindestens ebenso gewichtige dagegen gab. Sie hätte offen eingestehen können, dass auch die Parteiführung selbst zerstritten darüber ist, welche Option die richtige ist. Das hätte tatsächlich »Vertrauen« schaffen können, weil die Kommunikation endlich einmal aufrichtig und wahrhaftig gewesen wäre. So aber entschied sich die Parteispitze, wie es nicht nur SPD-Politiker in (zu) vielen Fällen tun: Sie legte sich auf eine Richtung fest, wo sie Basisdemokratie mit offenem Ausgang versprochen hatte. Sie hatte Angst vor der Vieldeutigkeit, die ihre ohnehin wacklige Position nach der Bundestagswahl weiter hätte schwächen können.
In den Tagen vor dem entscheidenden Parteitag, aber auch vor dem Mitgliedervotum wenige Wochen später, bei dem die Basis über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union abstimmen sollte, machte die SPD-Spitze in ihren Publikationen und im Internet einseitig Werbung für die Große Koalition – die Argumente der GroKo-Gegner fanden sich dort kaum. Nicht nur bei den Jusos um Kevin Kühnert sorgte das für große Verärgerung – waren ihnen von der Parteispitze nach der Bundestagswahl nicht endlich Transparenz und Offenheit versprochen worden? Auch, dass vor dem entscheidenden Parteitag offenbar massiv Druck auf die entscheidenden Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen ausgeübt wurde, trotz anfänglicher Verweigerung doch für die GroKo zu stimmen, verstärkte in der Partei nicht gerade jenes »volle Vertrauen«, das die Parteispitze von der Basis eigentlich zurückerlangen wollte. Dass derlei Druck auf die Landesverbände ausgeübt wird, ist natürlich normales politisches Geschäft und strategisch durchaus nachvollziehbar: Die Risiken von Neuwahlen galten im Willy-Brandt-Haus als ebenso groß wie die Gefahr, nach einem erneuten Urnengang wieder vor derselben Situation zu stehen und am Ende ohnehin eine Große Koalition eingehen zu müssen. Trotzdem war der Eindruck, die Parteispitze wolle die angeblich »ergebnisoffene« Entscheidung einseitig vorwegnehmen, kommunikativ fatal. Und das umso mehr, als die SPD in jenen Tagen wieder einmal einem Narrativ huldigte, das sich in den letzten Jahren immer mehr in Politik und Medien verbreitet hat: dem der »breiten Mehrheit«.
Nicht erst seit Konrad Adenauer, der bei der Kanzlerwahl 1949 bekanntermaßen für sich selbst stimmte und nur deshalb gewählt wurde, galt in der Politik die Regel: Eine Stimme mehr genügt, Hauptsache Mehrheit. Heute hingegen gelten knappe oder selbst klare, aber nicht überragend große Mehrheiten oft schon als Zeichen der Schwäche, die für die kommende Zeit Streit und danach nur noch das Scheitern verheißt. Das liegt auch an den immer schnelleren Erregungszyklen der Medien im Online-Zeitalter, die aus knappen Entscheidungen sogleich Rückschläge, Abstrafungen und »überraschende Niederlagen« machen und damit dem immer gierigeren Nachrichtenstrom Futter geben. Umgekehrt haben die Politiker und Politikerinnen schnell gelernt, dass Entscheidungen und Beschlüsse in den Medien nur dann nicht angezweifelt werden, wenn sie mindestens sehr eindeutig, im besten Fall aber mit überragender Mehrheit getroffen werden.
Auch vor dem entscheidenden SPD-Parteitag in Bonn dürften die Parteistrategen im Willy-Brandt-Haus viel darüber nachgedacht haben, ob eine Entscheidung von nur 51 Prozent für die Große Koalition »vertrauenswürdig« genug wäre oder aber die Partei noch mehr ins Unglück stürzen würde, weil die mediale Erzählung dann womöglich gelautet hätte: »SPD zittert sich in die Große Koalition – wie stabil ist die nächste Regierung?« Also tat die SPD-Spitze im Vorfeld alles, um der Entscheidung – unter den gegebenen Umständen – eine so »breite Mehrheit« wie möglich zu verschaffen. So wollte man in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass in die SPD wieder Stabilität und Konsens eingekehrt seien und man ihr und dem nächsten möglichen Regierungsbündnis »vertrauen« könne. Am Ende stimmten in Bonn 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der Union – in früheren Zeiten wäre das eine knappe, aber valide Mehrheit gewesen, und die Debatten darüber hätten wohl noch am selben Tag aufgehört. Jetzt aber wurden die 56 Prozent in den Medien weithin als Zitterpartie gewertet, die nur zeige, wie zerrissen und instabil die SPD sei. Gab diese Bewertung nicht den Sorgen der Parteistrategen recht, zu viel basisdemokratische Ehrlichkeit könne die Lage nur noch viel schlimmer machen?
Auch bei der Wahl von Andrea Nahles zur neuen Parteivorsitzenden im März 2017 ließ sich ein ähnlicher Mechanismus beobachten, der viel zum Thema »Vertrauen« und seiner medialen Kommunikation aussagt. Vor dem Parteitag in Wiesbaden streute das Nahles-Lager, man erwarte ein Ergebnis von »75 Prozent + x«. Und die Medien sekundierten, bei einem Ergebnis darunter wäre die Autorität von Nahles – sprich, das Vertrauen der Partei in die neue Parteivorsitzende – schon zum Beginn ihrer Amtszeit infrage gestellt. Wer ist Henne, wer Ei? Reagieren die Politiker auf die Medien oder umgekehrt? Und wer von beiden ist am Ende schuld daran, dass Erwartungen oft so künstlich in die Höhe geschraubt werden? Als Nahles schließlich mit 66 Prozent der Stimmen gewählt wurde, weil ihre unbekannte Gegenkandidatin Simone Lange überraschend viele Stimmen erhalten hatte, war der Ton in der Berichterstattung wie erwartet gesetzt: Nahles hatte einen »Dämpfer« erhalten, eine »Klatsche« bekommen und war »angeschlagen« – so werteten es jedenfalls die meisten Journalisten. Kaum einer schrieb darüber, dass Nahles in einer Zeit, in der die SPD durch einen veritablen Richtungsstreit zerrissen wurde und in einer der größten Krisen ihrer neueren Geschichte steckte, immerhin eine klare Mehrheit bekommen hatte und zumindest fürs Erste unangefochten war. Indem Nahles’ Umfeld die Erwartungen im Vorfeld aber so hoch gesteckt hatte, um den Medien keine Angriffsfläche zu bieten, hatte die SPD wieder nicht authentisch kommuniziert. Statt Vertrauen zu schaffen, wie es nach der desaströsen Bundestagswahl angekündigt worden war, und aufrichtig und selbstkritisch zu sein, hatte sie wieder auf das Narrativ der großen Einigkeit in Zeiten größter Uneinigkeit gesetzt. Damit hatte sie ihre neue Parteivorsitzende ohne Not nur noch mehr geschwächt – und den Eindruck der Zerrissenheit verstärkt.
Vertrauen zu verspielen, gerade indem man Vertrauenswürdigkeit in immer neuen rhetorischen Hülsen suggeriert, ist indes keine Paradedisziplin nur der SPD. Auch und gerade Angela Merkel ist eine wahre Meisterin dieser Technik, wie wir am Anfang des Kapitels schon beim Wort »vollstes Vertrauen« für ihre wankenden Minister gelernt haben. Die Kanzlerin hat viele Hülsen in ihrem Wortschatz, die das Vertrauen vieler Wählerinnen und Wähler in die Wahrhaftigkeit der politischen Klasse nachhaltig beschädigt haben. Einer der fragwürdigsten Begriffe im Merkel’schen Duktus ist jedoch das Wort »alternativlos«. Kaum ein anderes Wort steht so sinnbildlich für eine Kommunikation, die Festigkeit, Handlungsfähigkeit und letzthin Vertrauenswürdigkeit signalisieren soll, aber das völlige Gegenteil bewirkt.
Als im September 2008 die Bankenkrise ausbrach und nach Lehman Brothers auch die deutsche Hypo Real Estate ins Wanken geriet, tauchte der Begriff »alternativlos« ab 2009 immer öfter in Reden von Merkel und danach auch von anderen Kabinettsmitgliedern auf. Sie halte die staatliche Kontrolle über »systemimmanente« (noch so ein Begriff) Banken wie die Hypo Real Estate für »alternativlos«, sagte Merkel damals, was bei vielen in Deutschland für einen empörten Aufschrei sorgte.4 Denn es war mitnichten so, dass es damals tatsächlich keine Alternative zur Zwangsverstaatlichung von Banken gab – zahlreiche Ökonomen argumentierten dagegen und glaubten nicht, dass eine Bankenpleite zwangsläufig zu jenen Ansteckungseffekten bis hin zu einem großen Bankencrash führen müsse, vor denen Merkel und die Regierung so große Angst hatten. Auch 2010, die Griechenland-Krise war auf einem vorläufigen Höhepunkt, verwendete Merkel wieder denselben Begriff, um die weiteren Finanzhilfen für Athen zu rechtfertigen, die viele Ökonomen nicht nur in Deutschland kategorisch ablehnten.5 »Mit dem Etikett ›alternativlos‹ stellt sich Politik als ohnmächtiges Vollzugsorgan eines von höherer Macht bestimmten Schicksals hin«, schrieb Heike Göbel Ende 2010 in der F.A.Z., als das Wort von der Deutschen Gesellschaft für Sprache gerade zum »Unwort des Jahres 2010« gekürt worden war. »Das schafft Verdruss beim Wähler. Warum soll er überhaupt noch seine Stimme abgeben, wenn Regierungshandeln so alternativlos ist, wie behauptet?«6 Mit diesem »Totschlagargument«, das sie seither in verschiedenen Situationen immer wieder verwendet hat, wollte Merkel damals mit der größtmöglichen rhetorischen Wucht ihre politische Linie durchsetzen – man könnte auch sagen: durchdrücken – und den Wählern zugleich das Gefühl von Führungsstärke vermitteln. Auch »alternativlos« ist mithin ein Wort, das Vertrauen erzeugen soll: Vertraut mir, dass ich schon am besten weiß, was jetzt zu tun ist, weil ich die Einzigartigkeit dieser fundamentalen Krise einschätzen kann. Doch indem sie ihre Politik als »alternativlos« bezeichnete, bewies Merkel nach Einschätzung mancher ein »antipluralistisches Verständnis« von Politik, wie Astrid Séville einmal in der taz schrieb7: Sie wischte alle anderen Alternativen beiseite und tat sie als nicht weitsichtig und durchdacht genug ab. Notwendige Diskussionen über die besten Lösungen, wie sie für eine Demokratie konstitutiv sind, wurden durch das Wort als sinnlos diskreditiert. Auch ließ der Begriff jene Nuancen nicht mehr zu, die in einem nachhaltigen politischen Diskurs- und Entscheidungsprozess unabdingbar sind: Gegenüber einer »alternativlosen« Maßnahme oder Entscheidung wird alles andere bedeutungslos. Merkels Wort von der »Alternativlosigkeit« ist also schon deshalb problematisch, weil es faktisch den Diskurs abwürgt – und beim Wähler damit das Gegenteil von Vertrauen schafft. Das liegt im Übrigen vielleicht auch daran, dass die Menschen heutzutage gemeinhin deutlich mündiger sind als noch zu Adenauers Zeiten: Ihm hätte man einen solchen Satz in der damaligen paternalistischen Republik wohl noch eher durchgehen lassen – in unserer heutigen Gesellschaft wollen sich die meisten eine solche Bevormundung hingegen nicht mehr gefallen lassen.
Viel fataler als der entstandene Vertrauensverlust aber ist, dass es womöglich auch diese »alternativlose« Rhetorik Merkels war, die den Erfolg der Rechtspopulisten in Deutschland mit befeuert hat. Wenn ausgerechnet die Bundeskanzlerin mit ihrer Rhetorik einen Alleingeltungsanspruch formuliert und andere Meinungen damit für nichtig erklärt, ist das eine Steilvorlage für jene, die sich als Anwälte einer »schweigenden Mehrheit« gegen die »Meinungsdiktatur« inszenieren. »Es ist etwas für die Demokratie Wichtiges zurückgekommen, nämlich eine wirkliche Opposition«8, frohlockte denn auch die damalige AfD-Vizevorsitzende Beatrix von Storch im März 2016 nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, bei denen die AfD in allen drei Ländern mit zweistelligen Ergebnissen in die Landtage einzog und in zwei Bundesländern sogar die SPD hinter sich ließ. Dieser Aufstieg der AfD hat natürlich in erster Linie mit inhaltlichen Fragen zu tun, allen voran mit der Flüchtlingskrise seit dem Herbst 2015, in deren Zuge Hunderttausende Menschen vor allem aus Syrien nach Deutschland kamen und die den Rechtspopulisten seither immer mehr Anhänger bescherte. Aber es ist bei vielen eben auch ein latentes Gefühl der Machtlosigkeit, ein Gefühl des Nicht-mehr-gesehen-Werdens, das sie der AfD in die Arme treibt – und dieses Gefühl wurde womöglich auch von Merkels »alternativloser« technokratischer Rhetorik mit geformt.
»Ihre Reden sind wie dicke, wattige Schneeflocken, die aus einem grauen Winterhimmel fallen«, schrieb der taz-Journalist Ulrich Schulte einmal über Merkel. »Sie decken zu, dämpfen, zeichnen die Konturen weich. Und am Ende steht stets dieselbe Frage: Was hat sie jetzt eigentlich gesagt?«9 Egal, wo Merkel spricht, ob bei einem CDU-Parteitag, einem EU-Gipfel in Brüssel, der Eröffnung einer Handwerksmesse oder einem TV-Duell im Fernsehen, die Phrasen ähneln sich überall. Sie will »Gemeinsames in den Vordergrund stellen« (Neujahrsansprache 2017), sieht Deutschland »vor einem Jahrzehnt, in dem sich vieles für unser Land entscheiden wird« (Neujahrsansprache 2009), will »verlorenes Vertrauen zurückgewinnen« (nach der Bundestagswahl 2017). Und so weiter und so weiter. Merkel mache sich mit ihrer »Teflonsprache« nicht nur schwer angreifbar, sie verschleiere auch ihre Ohnmacht, schrieb Ulrich Schulte weiter – eine Einschätzung, die das Problem treffend auf den Punkt bringt. Indem Merkel viel redet, aber oft keine Stellung bezieht, und indem sie diskursive Details in technokratischen Phrasen nivelliert, bereitet sie den Boden für populistische Vereinfachungsformeln. Je gleichförmiger und wolkiger die Sprache der »etablierten« Parteien, umso leichter können Populisten mit ihrem vorgeblichen »Klartext« bei den Unzufriedenen punkten.
Die Frage ist allerdings, ob Angela Merkel mit ihrer politischen Ausdrucksweise wirklich so alleine dasteht. Ist es nicht auch nachvollziehbar, dass sie in ihrer Rhetorik wie viele andere Spitzenpolitiker so wolkig und floskelhaft wie möglich bleibt, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten? Wie könnte eine Sprache überhaupt aussehen, die klar, aber nicht populistisch ist und Debatten nicht herrisch in »Alternativlosigkeit« erstickt? Und wie müsste sich das Selbstverständnis der Politikerinnen und Politiker ändern, um authentischer zu kommunizieren? Das wird in diesem Buch noch an einigen Punkten eine Rolle spielen.