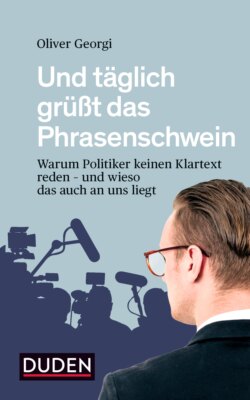Читать книгу Und täglich grüßt das Phrasenschwein - Oliver Georgi - Страница 8
Оглавление2 Ehrlichkeit
Wenn Vertrauen das wichtigste Gut von Politikern ist, dann ist das zweitwichtigste: Ehrlichkeit. Denn ohne die ist das Vertrauen der Wähler in ihre Volksvertreter schnell dahin – ehrlich zu sein oder zumindest vor Wahlen den Anschein von Ehrlichkeit zu erwecken ist für Politiker und Politikerinnen schon deshalb unerlässlich. »Wenn Sie einen anderen Menschen für Ihre Sache gewinnen wollen, müssen Sie ihn zuerst davon überzeugen, dass Sie sein aufrichtiger Freund sind«, hat Abraham Lincoln einmal gesagt. Es ist wie ein Geschäft, das der Wähler mit dem Politiker abschließt: Mit seiner Stimme schenkt er ihm sein Vertrauen. Im Gegenzug erwartet er nicht nur, dass der Politiker mit maximalem Einsatz für seine Ziele kämpft und keine Versprechungen macht, die er nicht einhalten kann, sondern auch, dass er offen über die Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns spricht. Maximales Wählervertrauen gegen maximale Aufrichtigkeit – im Idealfall wäre das eine für beide Seiten erquickliche Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe. Und was ist für einen Politiker zwingend erforderlich, um gegenüber seinen Wählern Aufrichtigkeit zu demonstrieren? Richtig: die Betonung offener Selbstkritik.
Kaum ein Wort wird in diesem Kontext so gern bemüht wie »schonungslos«. Politikerinnen und Politiker versprechen eine »schonungslose Analyse der Lage« wie Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung nach ihrer ersten Wiederwahl 2009, fordern nach Affären »schonungslose Aufklärung«, wollen den politischen Gegner in Untersuchungsausschüssen dazu bringen, »schonungslos« die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Auch nach verheerenden Niederlagen ist der Begriff eine Standardfloskel, wenn Politiker am Wahlabend mit sorgenvoller Miene vor die Kameras treten und sich reumütig geben. Als die SPD bei der Bundestagswahl 2017 eine krachende Niederlage eingesteckt hatte, forderte der damalige Erste Hamburger Bürgermeister, spätere Interims-Parteivorsitzende sowie Vizekanzler Olaf Scholz eine »schonungslose Betrachtung der Lage«. Es ist leicht ersichtlich, warum Politiker diese Floskel so lieben: »Schonungslos«, damit kann man mit größtmöglicher verbaler Verve den Eindruck vermitteln, dass man alle Tabus und Denkverbote, die im politischen Geschäft eine Rolle spielen können, beiseitezuwischen bereit ist. Das Thema ist zu wichtig für parteipolitische oder persönliche Befindlichkeiten, deshalb stelle ich diese jetzt selbstlos hintan.
Auch im politischen Nahkampf hat »schonungslos« rhetorisch viele Vorteile: Wer vom politischen Gegner »schonungslose Aufklärung« verlangt, der zeigt seinen Wählern, dass er nicht eher ruhen wird, bis der Schuft von der anderen Partei endlich die Hosen heruntergelassen und seine Verfehlungen bis hinters letzte Komma zugegeben hat. »Schonungslos« hat also viel mit der Illusion von Rücksichtslosigkeit zu tun: rücksichtslos gegenüber dem politischen Gegner und im Zweifel sogar gegenüber den eigenen Karriereplänen. Dabei ist der Begriff sprachlich durchaus entlarvend, weil Politiker mit ihm unbewusst auf einen Mangel hinweisen: Wer »schonungslos aufklären« will, impliziert damit im Umkehrschluss, dass der politische Gegner oder man selbst in der Regel bei der Suche nach dem Schuldigen oder der Aufklärung eines Missstands offenbar geschont wird. So ist es oft bei Phrasen: Indem sie Selbstverständliches über Gebühr betonen, verweisen sie auf das Gegenteil und werden dadurch umso inhaltsleerer. Das gilt auch für Horst Seehofer.
Nach dem Bekanntwerden des Skandals bei der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration (Bamf) im Frühjahr 2018, wo zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne Anspruch Asyl gewährt wurde, versprach der damalige Innenminister in fast jedem Interview eine »schonungslose Aufklärung« der Affäre. Seehofer stand zu diesem Zeitpunkt selbst unter immensem Druck, weil öffentlich die Frage im Raum stand, was er wann von den Vorgängen in Bremen gewusst hatte. Seehofer musste sich als Macher präsentieren, der mit unnachgiebiger Härte alle Missstände aufdecken wird – und sich zugleich maximal von den Geschehnissen in Bremen distanzieren. Eine Quadratur des Kreises, auch rhetorisch – aber auch dafür lieben Politiker das Wort »schonungslos«, das so trefflich nach Beharrlichkeit und Unbeirrbarkeit im Dienste der Wahrheit klingt: Es suggeriert selbst da objektive Distanz, wo es keine gibt.
In der Praxis haben Politiker und Politikerinnen diese Illusion schon so oft mutwillig selbst zerstört, dass »schonungslose Aufklärung« zu einer leeren Phrase verkommen ist. Sie wird zwar längst auch von den Medien und im allgemeinen Sprachgebrauch als Standardfloskel verwendet, doch mittlerweile dürften viele darunter eher das Gegenteil verstehen: Wo etwas »schonungslos« getan werden soll, sind oft gerade nicht größtmögliche Ehrlichkeit und erbarmungslose Selbstkritik zu erwarten, sondern: nichts. Selbst dann nicht, wenn es durch eine herbe Wahlniederlage offensichtlich ist, dass in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen ist, das es nun zu korrigieren gilt. Auch Angela Merkel ist eine große Meisterin in der Kunst, mit gebeugtem Haupt größtmögliche Ehrlichkeit bei der Suche nach den Fehlern der Vergangenheit zu versprechen, das Ganze danach aber mit nicht minder großer Nonchalance im Sand verlaufen zu lassen. Gerade bei ihr hat das eine lange Geschichte, was seit dem Beginn ihrer Karriere als CDU-Parteivorsitzende bei vielen in der Union für einen immer bohrenderen Unmut gesorgt hat, der sich danach mit jeder Wahlschlappe noch gesteigert hat. Schon als Merkel bei der Bundestagswahl 2005 trotz eines lange Zeit großen Vorsprungs im Wahlkampf zur großen Überraschung nur hauchdünn gegen Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD) gewann, war das Maulen in der CDU über die neue Parteivorsitzende groß, die sich erst wenige Jahre zuvor kaltschnäuzig von Helmut Kohl, dem langjährigen Übervater der Partei, emanzipiert hatte. Also versprach Merkel ihrer Partei, noch sichtlich angeschlagen von Schröders Aufholjagd, eine eingehende Analyse der Niederlage und spielte ansonsten auf Zeit. Mit Erfolg: Kurz darauf musste Schröder einsehen, dass seine vollmundige Ankündigung in der »Elefantenrunde« am Wahlabend, er werde Bundeskanzler bleiben, nicht mehr umzusetzen war. Merkel schloss eine Große Koalition ohne Schröder (was eine Bedingung der Union gewesen war), wurde die erste deutsche Bundeskanzlerin – und über eine Aufarbeitung der Wahlniederlage sprach plötzlich kein Mensch mehr. Auch die zahlreichen Merkel-Kritiker in der Union, die damals noch bezweifelten, dass eine Pfarrerstochter aus der Uckermark das Format und den Machtinstinkt für Kanzlerschaft und Parteivorsitz haben könne, schluckten ihren Ärger angesichts des Erfolgs der neuen Kanzlerin vorerst hinunter.
Auch bei vielen späteren schlechten Wahlergebnissen folgte Merkel diesem bewährten Muster: Vage andeuten, dass womöglich etwas schiefgelaufen ist (aber nur, wenn es sich wirklich nicht mehr vermeiden lässt), notfalls eine »ehrliche« oder gar »schonungslose« Debatte ankündigen und dann auf die Vergesslichkeit der Öffentlichkeit zählen – und auf das Machtkalkül ihrer Partei. Denn das ist schließlich der Hauptgrund dafür, warum Politiker mit großen Phrasen und kleinen Folgen so oft »durchkommen«: Vom Wahlvolk (und mitunter auch der eigenen Partei) müssen sie in der Regel so lange keine Konsequenzen erwarten, wie sie ein Garant für Wahlsiege und also, um mit Merkel zu sprechen, »alternativlos« sind. Man kann es vielleicht ein bisschen mit der Erziehung eines Kindes vergleichen: Wenn keine direkte Konsequenz folgt (wie im Fall Merkels 2005 etwa eine parteiinterne »Revolte«, die die Parteivorsitzende zu einer wirklich »schonungslosen« Aufarbeitung der Niederlage gezwungen hätte), muss sich ein Politiker seine folgenlosen Phrasen nicht abgewöhnen. In der Folge verpuffen sie und werden mit jedem Mal noch ein wenig hohler. Dem politischen Diskurs erweisen die Volksvertreter mit diesem immer stumpferen Vokabular aber einen Bärendienst, weil sie ihn inhaltlich immer mehr entkernen.
Dieses Phänomen lässt sich auch an einer weiteren Phrase verdeutlichen, die Politiker und Politikerinnen mindestens ebenso lieben wie »schonungslos«, wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht: die »Hausaufgaben«. Kaum ein Volksvertreter, der, angesprochen auf eine Wahlniederlage, eine Krise in seiner Partei oder ein dringend zu klärendes Sachthema, nicht schon reumütig in ein Mikrofon gesagt hätte, man müsse und werde jetzt dringend seine »Hausaufgaben machen«. Die Botschaft hinter der Phrase, die sich im Deutschen vom Fußballer bis zum Vorstandsvorsitzenden generell immer größerer Beliebtheit erfreut, ist klar: Wir haben verstanden, da ist etwas liegen geblieben, aber jetzt kümmern wir uns darum. Wie »schonungslos« ist auch der Begriff »Hausaufgaben machen« äußerst praktisch für Politiker: Er suggeriert nicht nur Ehrlichkeit in der Analyse eigener Versäumnisse, sondern auch Tatkraft, ist aber zugleich schwammig genug, dass man kaum dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Zudem erweckt er den Eindruck, es gehe gerade nicht um grundlegende Probleme wie die Zukunft der Partei oder gar des Landes, sondern lediglich um eine lästige, aber unvermeidliche Pflichterfüllung in der Schule. Durch diese Verniedlichung machen sich die Politiker mit ihren Wählern gemein: Haben die meisten von uns die Hausaufgaben nicht selbst schon einmal geschwänzt? Wer selbst im Glashaus sitzt, der soll bitte schön auch bei seinen Volksvertretern Nachsicht walten lassen – und wenn die ihre »Hausaufgaben« doch mal wieder vergessen, dann wird die Welt – wie in der Schule – deshalb schon nicht gleich untergehen.
Wieder ist es die Kanzlerin, die Großmeisterin der »alternativlosen« Worthülse, die eindrucksvoll die gewinnbringende Umsetzung der Floskel in die Praxis belegt. Nach der Bundestagswahl 2017, bei der die CDU mit 32,9 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt hatte, wurde die Kritik an Merkel in der Union immer vehementer. Viele nicht nur in der CSU lasteten das historisch schlechte Ergebnis ausschließlich Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik an. Aus München, wo die CSU mit 38,8 Prozent der Stimmen ebenfalls ihr bislang schlechtestes Ergebnis erreicht hatte, wurden abermals Forderungen laut, die Wahlniederlage jetzt »schonungslos« (!) aufzuarbeiten. Und was tat Merkel? Am Tag nach der Wahl verkündete sie im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, die CDU habe ihre »strategischen Ziele erreicht«. Im Übrigen könne sie, Merkel, »nicht erkennen, was wir hätten anders machen müssen«. War da was? Erst auf Nachfrage schob die Kanzlerin, sichtlich genervt, hinterher, ja, sie übernehme die Verantwortung für die Niederlage, »in Gottes Namen«. Trotzdem rieben sich die Hauptstadtjournalisten ungläubig die Augen – und die Presse für Merkel war verheerend. »Realitätsverlust«, »Paralleluniversum«, »unbelehrbar« – eine Kanzlerin verliere im Spätherbst ihrer Karriere den Kontakt zum Boden, schrieben viele. Merkel musste reagieren. Zwei Tage später, bei einer Wahlveranstaltung vor der anstehenden Landtagswahl in Niedersachsen in Hildesheim, gestand sie öffentlich ein, es sei »klar, dass wir eine ganze Reihe von Hausaufgaben haben«. Da war sie wieder, die Phrase: Mit ihrer Hilfe konnte Merkel mit größtmöglicher Vagheit einen Hauch von Zweifel andeuten – und die Lesart in der Berichterstattung der Medien war gesetzt: »Merkel gesteht Versäumnisse ein«, schrieb etwa Welt Online.
Doch das Fatale daran ist, dass Politikerinnen und Politiker mit solchen allgemeinen Phrasen nur den Ritualen der Berliner Blase aus Politik und Medien genügen. Der Eindruck, den sie damit bei den Wählern hinterlassen, ist aber verheerend. Denn denen ist längst klar, dass Begriffe wie »schonungslos« oder »seine Hausaufgaben machen« kaum noch mehr als leere, folgenlose Beschwichtigungsformeln sind. Viele Medien tragen an diesem fatalen Kreislauf eine gehörige Mitschuld. Trotz der offenkundigen floskelhaften Entleerung der Begriffe verbreiten sie diese in der Berichterstattung nicht nur weiter, sondern deuten sie allzu oft auch noch im Sinne der Politiker. Hatte Merkel wirklich »Versäumnisse eingestanden«, als sie davon sprach, man müsse jetzt seine »Hausaufgaben« machen? War das tatsächlich der Beginn einer konkreten Aufarbeitung der Gründe für ein desaströses Wahlergebnis, das die Bezeichnung »ehrlich« verdient hätte? Nein, natürlich nicht. Trotzdem setzten viele Medien mit ihren Schlagzeilen den Ton im Sinne der Kanzlerin.
Kann man das den Medien vorwerfen? Ja – und nein. Zur DNA der öffentlichen Inszenierung von Politik gehört es schließlich von jeher, dass Politiker und Politikerinnen nach einer Niederlage »in aller Deutlichkeit« davon reden, »schonungslos« aufklären und »ihre Hausaufgaben machen« zu wollen. Sie tun es, weil sie sich aus der Affäre ziehen wollen, das haben wir gelernt, aber nicht nur: Sie tun es auch, weil sie zu Recht davon überzeugt sind, dass es von ihnen erwartet wird und die Öffentlichkeit es ihnen als abgehobene Chuzpe auslegen würde, wenn sie sich in der ersten Stellungnahme nach einer Wahlschlappe nicht zerknirscht und maximal schuldbewusst geben. Doch damit kommt ein fataler Mechanismus in Gang: Die Politiker kündigen Aufarbeitung an, woraus viele Medien, auf der ständigen Suche nach neuen aufmerksamkeitsträchtigen Konflikten im immer hektischeren Nachrichtengeschäft, Schlagzeilen mit Begriffen wie »Fehler eingestanden« oder »Konsequenzen angekündigt« generieren. Weil die damit geweckten Erwartungen von den Politikern aber oft nicht eingelöst werden, die das vielleicht gar nicht im Sinn hatten, sondern mit ihren Äußerungen nur das beschriebene Ritual bedient haben, machen die Wählerinnen und Wähler eine weitere Enttäuschungserfahrung. Diese entfremdet sie wieder ein Stückchen mehr von der Politik oder treibt sie gar in die Arme der Populisten, die vorgeben, alles anders als die »etablierten« Parteien machen zu wollen. Doch es gibt kein Entkommen. Politiker, Journalisten und auch wir, die Wähler, sind, durch lange Jahre im Phrasendschungel längst auf den Austausch leerer Floskeln konditioniert, in der »Ritualspirale« gefangen. Beim nächsten Mal bemühen die Politiker wieder dieselben Floskeln, von denen sie glauben, dass ihre Wähler sie hören wollen, über die die Medien berichten und die wieder weitgehend folgenlos bleiben – und die Entfremdung zwischen den Politikern und ihren Wählern setzt sich fort. Für die Glaubwürdigkeit von Politikern ist das fatal: Sie verspielen bei ihren Wählern damit ebenjenen Eindruck, den zu erzeugen für sie doch mit am wichtigsten ist: den der Ehrlichkeit.
Wie ambivalent das Verhältnis von Politikern und Politikerinnen zum Begriff »Ehrlichkeit« schon immer war und weiterhin ist, hat keiner – wenngleich unfreiwillig – schöner auf den Punkt gebracht als Franz Müntefering, der langjährige SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende und spätere Arbeitsminister und Vizekanzler in der ersten Großen Koalition unter Angela Merkel. Müntefering wird die Prägung des Begriffs »sich ehrlich machen« zugeschrieben, den er schon auf dem SPD-Parteitag in Hamburg 2004 mit Blick auf die Notwendigkeit des Agenda-Kurses des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder verwendete. 2009 sprach sich Müntefering in der Rheinischen Post für den »ehrlichsten Wahlkampf in der Geschichte der Republik« aus und kritisierte Forderungen nach Steuersenkungen scharf. »Frau Merkel muss klipp und klar sagen, dass eine große Steuersenkungsreform nicht geht. Sie sollte sich ehrlich machen, und zwar bald«, sagte Müntefering.1 Seither taucht der Begriff als politische Floskel im Parlament und in den Medien immer wieder auf. In seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit verwendete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Begriff 2017 fast ein Dutzend Mal, als er über die Flüchtlingspolitik und die Zuwanderung nach Deutschland sprach. Auch andere politische Vertreter fordern seit Müntefering mit schöner Regelmäßigkeit, dass man sich jetzt, jetzt aber nun wirklich, »ehrlich machen« müsse.
Rhetorisch wie politisch ist auch dieser Begriff hochinteressant. Mit ihm möchten Politiker verdeutlichen, dass nun endlich ein »Ruck« durch das Land gehen muss, um mit dem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog zu sprechen. Dass es – ähnlich wie bei »schonungslos« und »Hausaufgaben machen« – Zeit für eine auch unangenehme Neubewertung der Lage ist und sie selbstverständlich dazu bereit sind, die Dinge »schonungslos« beim Namen zu nennen, auch wenn dafür große Hürden zu überwinden sind. Wenn Politiker und Politikerinnen ankündigen, sich »ehrlich zu machen«, hat das also nicht nur viel mit der Inszenierung von Verständnis zu tun, sondern auch mit der von Mut, der für sie ebenfalls ein elementarer Wert ist und auf den wir an anderer Stelle noch zu sprechen kommen werden. Gemeint ist vor allem der Mut, auch harte, unbequeme Wahrheiten auszusprechen oder, wenn man nicht selbst betroffen ist, alles dafür zu tun, dass der politische Gegner es endlich macht, was er in der Vergangenheit – dieser Subtext schwingt immer mit – offenkundig nicht deutlich genug getan hat. Aber: Warum sagen Politikerinnen und Politiker dann nicht einfach »wir müssen ehrlich sein«, wie Malte Lehming nach der Steinmeier-Rede zum 3. Oktober im Tagesspiegel fragte?2 In der Tat wäre das viel klarer – und sprachlich angemessener – als »ehrlich machen«, aber es würde eben bedeuten, dass sie zugeben, vorher gelogen zu haben, wie Lehming folgerichtig schloss. Die »gekünstelte« Formel »Wir müssen uns ehrlich machen« erlaube die »Suggestion, eine Gesellschaft könne sich nachträglich in einen ehrenhaften Zustand versetzen, ohne über den vorherigen unehrenhaften Zustand sprechen zu müssen«. Ehrlichkeit sei in dieser Lesart »keine Tugend oder innere Haltung, sondern ein Prozess«, so Lehming. Wenn man so will, versuchen sich Politiker mit Phrasen wie dieser also wieder an der rhetorischen Quadratur des Kreises: Fehler zuzugeben, ohne Fehler zuzugeben.
Nun könnte man sagen: Wozu die Aufregung? Genau das verlangen wir doch immer von unseren Politikern, dass sie lernbereit sind und Fehlentwicklungen, wenn nötig, auch öffentlich korrigieren. Das Problematische daran ist aber, dass auch »ehrlich machen« binnen kurzer Zeit zu einer so inflationären Floskel geworden ist, eben weil sie so mutig klingt und trotzdem so wenig Zugeständnis und Selbstoffenbarung erfordert, dass ihr gut gemeinter Impetus sich ins Gegenteil verkehrt. Und zumindest bei jenen, die ohnehin immer größere Vorbehalte gegenüber den Repräsentanten der »etablierten« Parteien haben, sind solche politischen Rechtschaffenheits-Floskeln dazu angetan, das Vertrauen in die tatsächliche Ehrlichkeit von Politikern noch mehr zu erschüttern. Angesichts der rechtspopulistischen AfD, die als größte Oppositionspartei im Bundestag sitzt und mit ihrer Forderung nach vermeintlichem »Klartext« in der politischen Debatte den etablierten Parteien zusetzt, müssten Politiker deshalb bestrebt sein, so klar und eindeutig zu kommunizieren wie nie zuvor, um das Argument der Populisten, sie wollten verschleiern, täuschen und vernebeln, zu entkräften. Sie dürften keine Scheu vor Zuspitzungen haben, ohne populistisch zu werden, sie müssten Missstände klarer denn je benennen und auch eigene Irrtümer ohne Angst vor dem nächsten »Shitstorm« offenlegen. Im Falle Steinmeiers hätte das bedeutet, in seiner Rede zumindest unmissverständlich zu sagen: Ja, wir haben manches an der Flüchtlingskrise unterschätzt, und deshalb ist es jetzt höchste Zeit, ehrlich zu sein. Wir haben die Flüchtlingskrise unterschätzt und den Menschen nicht genügend erklärt, was die Chancen, aber auch die Risiken sind. Vor allem haben wir nicht offen genug kommuniziert und die AfD damit erst mit stark gemacht. Das wäre »Klartext« im besten Wortsinn gewesen, ohne in populistische Reflexe zu verfallen.
Stattdessen flüchtete auch Steinmeier sich mit »ehrlich machen« in die Floskelwolke. »Steinmeier ist der Typ Politiker, der sich gerne reden hört, aber so, dass niemand daran Anstoß nimmt«, ätzte Jan Fleischhauer nach der Rede in seiner Kolumne auf Spiegel Online.3 In seiner Rede entdecke man »an jeder Ecke den Beraterstab, der zur Vorsicht rät, wenn etwas zu deutlich geraten« sei. »Die andere Seite hat eine Sprache«, schrieb Fleischhauer. »Sie mag einem nicht gefallen, weil man sie zu rüde und hetzerisch findet. Aber solange die Antwort Sprachlosigkeit ist, wird sich an dem Zustand, den man beklagt, nichts ändern. Man kann sich in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner der Polemik bedienen, des Spotts oder der kühlen Zurechtweisung – Floskeln sind das Letzte, auf das man vertrauen sollte.« Ob mit »schonungsloser« Aufklärung, der Erledigung dringender »Hausaufgaben« oder der Ankündigung, sich jetzt »ehrlich« zu machen: Es ist in der Tat ein Selbstmord aus Angst vor dem Tod, den Politikerinnen und Politiker mit der Verwendung von Floskeln ausgerechnet an jenen zentralen Stellen des politischen Diskurses begehen, an denen sie eigentlich authentisch und unmissverständlich sein müssten. Und es hat sich nicht erst in den Zeiten der fortgesetzten großen Koalitionen eine immer fatalere Risikoverweigerung und Scheu vor der Kontroverse eingeschlichen; vor deutlichen, manchmal auch provokanten und unbequemen Äußerungen, wie man nicht nur am Beispiel Steinmeiers sieht.
Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt hatten diese Scheu nicht. Wenn sie einander früher im Bundestag oder im Fernsehen Zigaretten qualmend beharkten, dann ging es oft deftig zu, ehrabschneidend und beißend polemisch. Das war vielleicht nicht immer die feinste englische Art, machte die politische Auseinandersetzung aber unterhaltsamer und auch viel klarer als heute, weil die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteien den Zuschauern und Wählern in aller Schärfe vor Augen geführt wurden. Wenn Strauß 1978 über den damaligen FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher sagte, dieser sei »eine armenische Mischung aus marokkanischem Teppichhändler, türkischem Rosinenhändler, griechischem Schiffsmakler und jüdischem Geldverleiher und ein Sachse«, dann war das auch nach damaligen Maßstäben schon antisemitisch, unsachlich und politisch höchst unkorrekt. Aber es zeigt eben, dass der Mut, öffentlich (zu) scharf zu formulieren und dafür womöglich auch herbe Kritik einzustecken, bei Politikern damals deutlich ausgeprägter war als heute. Auch Redner wie der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner sind wegen ihrer rücksichtslosen Schärfe in der politischen Debatte legendär. Wehner beschimpfte politische Gegner im Bundestag regelmäßig auf das Unflätigste (1970 etwa den damaligen CDU-Abgeordneten und Berliner JU-Chef Jürgen Wohlrabe als »Übelkrähe«) und sprach von »Strolchen«, »Schleimern« und »einstudierten Pharisäern«. Als sich der CSU-Abgeordnete Richard Jaeger, ein Befürworter der Todesstrafe, in einer Bundestagsdebatte dafür aussprach, Sexualverbrecher zwangsweise zu sterilisieren, ätzte der SPD-Mann: »Sie sollten nicht Kopf-ab-Jaeger heißen, sondern Schwanz-ab-Jaeger.«
In den Jahrzehnten nach Wehner war es neben dem früheren SPD-Vorsitzenden und späteren Linkspartei-Chef Oskar Lafontaine höchstens noch der Grüne Joschka Fischer, der vergleichsweise wenig auf Floskeln gab, dafür aber umso saftiger formulierte. Legendär ist Fischers Zwischenruf vom 18. Oktober 1984, als er dem Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen zurief: »Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.« 1985 sagte Fischer über das Kabinett: »Es gibt doch eine ganze Latte politischer Halbleichen bis Leichen, die hier auf Kabinettsposten herummodern.« Auch nach seiner Sponti-Zeit in den grünen Anfangsjahren, als er schon Grünen-Fraktionsvorsitzender war, behielt Fischer diese rhetorische Deftigkeit bei und nahm in Kauf, dafür in der Öffentlichkeit immer wieder scharf kritisiert zu werden. »Sie sind Geschichte, im guten und im schlechten Sinne«, ätzte er 1995 in einer Plenardebatte gegenüber Helmut Kohl. »Aber in Zukunft werden Sie nicht mehr sein – drei Zentner fleischgewordene Vergangenheit.«
Natürlich wäre es falsch, eine authentische, ehrlichere politische Sprache mit ehrabschneidenden Beleidigungen wie bei Strauß, Wehner und Fischer gleichzusetzen. Doch Polemik gehörte damals eben noch viel mehr zum politischen Geschäft als heute, und diese Überzeichnung hat der politischen Auseinandersetzung – und nicht zuletzt der politischen Willensbildung – womöglich besser gedient als die einlullenden heutigen Floskelwolken. Manche Politiker redeten nicht mehr »Klartext«, sondern seien nur noch darauf bedacht, nicht anzuecken, klagte auch Franz Müntefering im Juli 2018 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. »Das ist ein defensives Sprechen, was dann dabei rauskommt.«4 Joschka Fischer jedenfalls hielt von solchem »defensiven Sprechen« nichts. Wie sein Koalitionspartner und Kanzler Gerhard Schröder polarisierte er als Politiker sowohl durch seine Rhetorik als auch durch seine generelle Lust an der Konfrontation, sein teils rotziges Auftreten, seine oft unwirsche Mimik und seine launenhaften Attitüden, hinter denen mitunter derart deutlich die Freude an der Macht durchschien, dass beide bis heute mit dem Begriff »Generation Basta« verbunden werden. Mit Schröder und Fischer sei der »Patriarch« Helmut Kohl von zwei »Machos« abgelöst worden, die »mit Mut, Lust und Verve Konflikte suchten und sie durchfochten«, schrieb Holger Schmale 2014 in der Frankfurter Rundschau.5 Man könnte auch sagen, Schröder und Fischer hätten etwas verkörpert, das nicht jedem gefallen muss, heute aber leider nur noch selten so deutlich zur Schau gestellt wird: Sie waren auch als Spitzenpolitiker Menschen mit all ihren Widersprüchen. Es ist bezeichnend, dass am Ende der Ära Schröder/Fischer viele Politiker und Journalisten geradezu sehnsüchtig auf ein Gegenmodell zu so viel Machismo warteten und durchaus froh waren, als mit Merkel ein Anti-Basta-Modell in die deutsche Politik einzog. Nach fast 14 Jahren »neuer Sachlichkeit« schlägt das Pendel aber längst wieder in die andere Richtung aus.
Nun muss man zugestehen, dass die Lebendigkeit und Offenheit der politischen Debatten im Bundestag wieder zugenommen haben, seit mit der AfD eine Partei die stärkste Oppositionspartei ist, die im Plenum immer wieder mit populistischen Entgleisungen für kalkulierte Provokationen sorgt. »Es sitzen Rassisten im Bundestag«, sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir im Mai 2018 im Plenum, als die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel in der Haushaltsdebatte die Flüchtlingspolitik Merkels kritisiert und von »Burkas, Kopftuchmädels, alimentierten Messermännern und sonstigen Taugenichtsen« gesprochen hatte, die »unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern« würden. Nach Weidels Rede gab es im Bundestag – vielleicht zum ersten Mal seit Jahren – Buhrufe; Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) rief Weidel daraufhin formal zur Ordnung. Auch CDU-Fraktionschef Volker Kauder wählte so klare Worte wie selten, als er Weidel antwortete, ihre Äußerungen hätten »null« mit einem christlichen Menschenbild zu tun. »Was Sie heute gemacht haben, ist das glatte Gegenteil davon. Dafür sollten Sie sich schämen.«6
Es ist, als schärfe die Bedrohung von rechts außen nach langem Dösen in der sprachlichen Beliebigkeit wieder die rhetorischen Reflexe der anderen Parteien, die die Angriffe der AfD mit immer größerem Selbstbewusstsein parieren. Auf dem Weg zu mehr »Ehrlichkeit« und einer tatsächlich »schonungsloseren« Aufklärung von Sachverhalten ist das für die Politiker und Politikerinnen vielleicht ein Anfang, ihre rhetorischen »Hausaufgaben« zu machen und mehr »Klartext« zu reden. Das Problem ist nur, dass die Verschärfung des Diskurses durch die AfD auch eine große Gefahr birgt: Dass die anderen Parteien jene klarere Sprache, die von ihnen seit Langem gefordert wird, ebenfalls mit populistischen Parolen verwechseln und damit das Geschäft für die AfD erledigen. Dass sie selbst zu Populisten werden, statt »Klartext« zu reden. Mit diesem Dilemma werden wir uns in diesem Buch noch an einigen Stellen befassen.