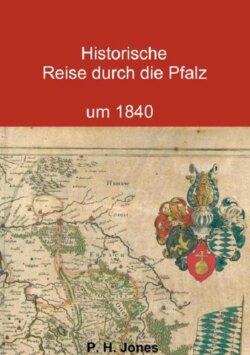Читать книгу Historische Reise durch die Pfalz um 1840 - P. H. Jones - Страница 6
Land Kommissariat Bergzabern Kanton Bergzabern
ОглавлениеDas Flüsschen Lauter oder Wieslauter, welches bei Merzalben entspringt, und sich in mancherlei Windungen durch das Wald und Wiesen reiche Dahn Tal nach dem französischen Gebiete hinschlängelt, beströmt hier die Stadt Weißenburg und bildet in seinem weiteren Laufe die Grenze der Kantone Bergzabern und Kandel, und so zugleich die des Kreises Pfalz, gegen Frankreich, worauf es sich, nachdem es den Reisbach und andere kleine Wasser aufgenommen, unweit Lauterburg in den Rhein ergießt. An der Lauter, zwischen Weißenburg und der letztern Stadt, befinden sich die 1706 von dem berühmten Baumann angelegten Linien, ein Meisterstück der Kriegsbaukunst, das man für unüberwindlich hielt. Im Revolutionskriege wurden sie, von den Vogesen bis an den Rhein, noch stärker befestigt. Nachdem aber die französische Moselarmee von den Preußen, bei Pirmasens geschlagen worden, gerissen diese die hier genommene Stellung der Rheinarmee in der linken Flanke an, während sie von den Österreichern rechts und in der Front gefasst war, wodurch denn diese Linien am 13. Oktober 1793, nach heftigem Widerstande , mit Sturm erobert wurden, welcher Sieg jedoch die Verbindung der beiden französischen Heere nicht unterbrach.
Bei Weißenburg die Grenze Frankreichs überschreitend, betreten wir das bayerische Land, und verfolgen unseren Weg längs dem Gebirge hin. Hier endet das eigentliche Elsass oder das niederrheinische Departement, welches ehemals noch die Kantone Bergzabern, Kandel und Landau umfasste. Der erste Ort des Kantons Bergzabern, den man auf der Poststrasse berührt, ist das 940 Seelen starke Gebirgsdorf Schweigen, nahe bei Weißenburg, zu welchem vor der letzten Grenzberichtigung sogar sein Bann gehörte. Unsere Wanderung geht über das, an 1100 Einwohner zählende, ehedem herzogliche zweibrückische Dorf Rechtenbach durch eine malerische und fruchtbare Gegend fort. Rechts erscheint die Ebene, mit üppigen Getreidefluren und Wiesen geschmückt, links erheben sich anmutige, mit Reben bepflanzte, Hügel, und die Gebirgsmassen, von herrlichen Waldungen bekrönt, welche sich in die Täler der westlichen und raueren Teile des Kantons hinab zieht. Der Flecken Oberotterbach, durch den jene Straße führt, liegt an der an dem nahen Gebirge herfließenden Otter, welche die Brücke, Spring und Brendelsmühlen treibt. Der Ort zählt 1756, grössen Teils protestantische, Einwohner Er kommt, nebst dem westlich davon entlegenen Niederotterbach (über 420 Einwohner), mit der Weidelmühle, schon in Urkunden des zehnten Jahrhunderts vor. Beide gehörten ehedem zu dem Zweibrücker Amte Guttenberg, welches nach dem Schlosse genannt war, dessen Ruine auf der westlichen Berghöhe steht. Dies war im Mittelalter eine Reichsfeste, und schon im zwölften Jahrhundert erscheinen Ritter von Gnttenberg oder Guttenburg, wie auch von Otterbach, unter dem Adel des Landes. Von hier geht der Weg nach der Stadt Bergzabern, die, zwei Stunden von Weißenburg, am Fuße der Vogesen oder des Wastchengebirges, in einer sehr romantischen Gegend liegt. Der Erlenbach, der aus dem wilden Tale, in dessen Eingange man eine schöne Pflanzung von Weißtannen sieht, hervorrauscht, durchfließt die Stadt, und eilt nach der Farben und fruchtreichen Ebene, auf die das grüne Gebirge mit seinen Wäldern und schönbelaubten, zum Teil in Terrassen aufgeführten, Rebengeländern herabschaut. Es ist sein Zweifel, das Bergzabern, wie schon sein Name beweist, auf oder bei der Stelle erbaut ward, wo in der Vorzeit römische Tabernae (Montanae), oder Etappenorte für den Marsch der Truppen, errichtet waren, obwohl dies nicht aus alten Schriften, sondern allein durch Überlieferungen, bekannt ist. Im Mittelalter hieß der Ort bloß Zabern, auch Kleinzabern. Urkundlich wird derselbe erst im Jahr 1l80 genannt, und zwar als Villa (offener Ort mit einem Schlosse) der Grafen von Saarbrücken, deren einer, Namens Heinrich, bald darauf als erster Graf von Zweibrücken erscheint. Durch Kaiser Rudolph von Habsburg erhielt Bergzabern Gemeinderechte und Freiheiten wie die Stadt Hagenau. Nach Erlöschung jenes gräflichen Stammes kam es (1390) an die Pfalzgrafen am Rhein, und ward 1410 mit dem Herzogtume Zweibrücken vereint, dessen erster Landesherr Pfalzgraf Stephan war, dem sein Sohn Ludwig der Schwarze 1459 in der Regierung folgte. Die Stadt befand sich schon zur damaligen Zeit durch gute Verwaltung, Fruchtbarkeit des Bodens und den Gewerbfleiß ihrer Einwohner in einem sehr blühenden Zustande. Allein der verheerende 30jährige Krieg schuf ihr große Drangsale durch die Raubsucht der Spanier und kroatischer Horden, durch Pest, Hungersnot, etc.. Im darauf folgenden Jahre worden sie (1676, während der Weihnachtstage) von den Franzosen rein ausgeplündert, und, nebst dem Schlosse, niedergebrannt. Erst nach dem Frieden von 1714 stellte man beide wieder her. Die Stadt gelangte nach und nach zu neuem Wohlstande, und als die Herzogin Caroline von Zweibrücken 1744 ihren Wittwensitz auf dem hiesigen Schlosse nahm, wo sie an dreißig Jahre zubrachte, ward dasselbe noch verschönt und bequemer eingerichtet. Doch der Revolutionskrieg zerstörte wieder einen großen Teil dieses Baues. Bergzabern ist der Sitz des königlichen Landkommissaramts, überdies befindet sich hier ein Friedensgericht, ein Dekanat, ein Forstamt, ein Rentamt, ein Kantons Physikat, ein Notariat, ein Steuerkontroleur, ein Tierarzt und eine Posterpedition. Zum Gebiete der Stadt gehören noch zwei benachbarte Meierhöfe (der Herrschafts und Frauenberger Hof), zwei Mahlmühlen, eine Schneid und Ölmühle, und zwei Waffenschmieden. Die Zahl der Einwohner beträgt 2564, großen Teils Protestanten, die zwei Geistliche haben, wovon Einer Dekan ist, dann Katholiken, deren Pfarrer in dem benachbarten Dorfe Pleisweiler wohnt, und einige Juden. Feld und Weinbau sind Hauptnahrungszweige, doch gibt es hier auch mancherlei Gewerbe, vorzüglich Gerbereien. Eine bemerkenswerte Erscheinung, die sich besonders in den Gebirgswaldungen dieser Gegend sind, sind die so genannten Böheimer, eine Art Strichvogel, welche sich manchmal zur Winterzeit in ungeheuerer Zahl niederlassen, wo man sie leicht mit dem Blasrohre schießt und dann häusig verkauft. Ihr brausender Flug und ihr seltsames Geschrei bei Nacht haben schon unkundige Wanderer zu dem Gedanken verleitet, es könne hier das wilde Heer vorüberziehen. Dem Forstmeisteramte zu Bergzabern sind sieben, Teils in diesem, Teils in den Nachbarkantonen Annweiler und Dahn liegende, Revierförstereien untergeordnet. Noch fügen wir bei, das diese Stadt, ehemals der Sitz eines herzoglichen zweibrückischen Oberamts war. Darauf wurde sie unter der französischen Regierung der Hauptort eines Kantons.
Durch Bergzabern geht jetzt die von Landau über Weißenburg nach Straßburg führende Poststraße. Vorher zog sie durch das östlich von hier auf der Ebene liegende Dorf Barbelroth (410 Einwohner), wo die Posterpedition war, über Schweighofen (740 Einwohner) an der französischen Grenze. Ersteres gehörte ehemals dem Hause Zweibrücken, letzteres nebst Hof und Mühle, dem Bischof von Speyer. Der protestantische Pfarrer in Barbelroth hat die Schulinspektion. Auf dem Seitenwege von der Kantonsstadt nach Barbelroth kommt man über Kapellen und Drusweiler, am Erlenbache, welche beide Dörfer eine Gemeinde von 642 Einwohnern bilden. Sie waren ehedem Zweibrückisch. Ihr Bann umschließt noch zwei Meiereien, den Dentschhof, auch Sünken-Thierbach genannt, und den Kaplaneihof. Erster gehörte dem deutschen Orden und zu dessen unter französischer Hoheit gestandener Komthurei Weißenburg. Bei diesem Hofe ergießt sich der Dörrenbach in den Dierbach. Den Namen Drusweiler wollen Einige von dem römischen Feldherrn Drusus herleiten. Auch hat man in dieser Gegend sehr interessante römische Altertümer gefunden, welche in dem Intelligenzblatte des Rheinkreises von 18l9 beschrieben sind. Ein anderer Weg führt von Bergzabern westlich durch das Gebirg über Birkenhördt, (560 Einwohner), das am Erlenbache, im so genannten Abtswalde, liegt, und dann weiter über Dahn etc., nach Zweibrücken. Der genannte Forst, und noch ehe die Mundat Waldungen im Süden des Kantons, gehören zu den bedeutendsten der pfälzischen Lande. Die Poststraße lenkt jenseits Bergzabern in die Ebene und geht über Niederhorbach (590 Einwohner), am Horbach, und Ingenheim nach der drei Stunden entfernten Stadt Landau. Ingenheim, ein beträchtlicher Ort am Klingenbach, zählt 1631 Einwohner wo von etwa ein Drittel Juden sind. Hier ist die stärkste israelitische Gemeinde in der ganzen Pfalz. Auch hat sich dieselbe in neuerer Zeit eine schöne Synagoge erbaut. Ehemals gehörte Ingenheim den Freiherren von Gemmingen Hurnberg, als Mitgliedern des rheinischen Ritterkreises, jedoch unter französischer Hoheit. Der Bach treibt hier eine Mühle. Virkenhördt (mit der Ölmühle) war vorher Kurpfälzisch, Niederhorbach aber Zweibrückisch. Der katholische Pfarrer in Birkenhördt ist Schulinspektor.
Unweit dieses Ortes, gen Osten, liegt das Städtchen Billigheim, in einer anmutigen, wahrhaft idyllischen, mit reichen Fluren, Wiesen und Bäumen geschmückten Gegend, welche oberhalb der Stadt von dem Wäsch oder Klingbach, und unterhalb derselben von dem Kaiserbach, durchflossen wird, die sich bei dem nahen Dorfe Rohrbach vereinigen. Jeder dieser Bäche treibt eine Mühle. Mit solchen zählt Billigheim 1731, größten Teils protestantische, Einwohner Man hat die Erzählung bewahrt, das Julius Cäsar in dieser Gegend den deutschen König Ariovist besiegt, und darauf hier ein Kastell errichtet habe, woraus sich eine Stadt gebildet, die von den Landes Einwohnern Belliheim genannt, aber nochmals durch die Hunnen zerstört worden sei. Allein diese Sage wird durch die historische Nachricht widerlegt, dass jene Schlacht in Burgund, und zwar bei der Stadt Vesontium (Besancon) vorfiel. Erst in einer Urkunde vom Jahr 1235 wird des gegenwärtigen Ortes unter dem Namen Bullinkeim gedacht, der sich später in Billigkheim und Billigheim verwandelte. Ursprünglich ein unmittelbares Eigentum des Reichs kam derselbe durch Verpfändung an die Pfalz. Kaiser Friedrich III erteilte ihm 1450 Stadtgerechtigkeit, und zugleich einen Jahr und Wochenmarkt, welcher erstere Purzelmarkt genannt, als ein Fest für die ganze Gegend, stark besucht, wird. Durch Kurfürst Friedrich I (den Siegreichen) ward das bisherige Dorf mit Toren versehen, auch der noch stehende Turm erbaut, an welchem die Wappen dieses Fürsten und des damaligen Fauts von Germersheim, Hans von Gemmingen, ausgehauen sind. Als 1552 König Heinrich II. von Frankreich mit einem großen Heerzug unter Elsass überfiel, ließ Kurfürst Friedrich II in dieser Not Billigheim, auf den Rat seines hier geborenen Geheimschreibers Georg Weisbrod, mit Wall und Gräben befestigen, wovon man noch einige Spuren sieht. In der zweiten Hälfte des l7. Jahrhunderts kam eine wallonische Kolonie aus der Landschaft Calleve, im französischen Flandern, hier her, die von Kurfürst Karl Ludwig verschiedene Privilegien erhielt, und der man vorzüglich den trefflichen Anbau der umliegenden Felder dankte. Auch ist Billigheim der Geburtsort des gelehrten Theodor Gerlach, Billicanus genannt, der als Professor der Veredtsamkeit und Weltweisheit auf der hohen Schule zu Marburg angestellt war. Vor seiner Bereinigung mit Frankreich und späterhin mit Bayern war das Städtchen der Sitz eines kurpfälzischen Unteramtes, das zum Oberamte Germersheim gehörte. Jetzo befindet sich daselbst ein Notariat. Die ehemalige, von Landau nach Altstadt und Weißenburg führende, Poststraße geht hier vorbei. Der ehemals zum Amte Billigheim gehörige Ort Rohrbach zählt etwa 1490 Einwohner
Der angenehmste Weg von Bergzabern nach Landau, besonders für den Fußwanderer, ist der längs dem Gebirge, wo sich an den mannichfachen Höhen und in der Aussicht auf die herrliche, nach dem fernen Rheinstrome hinziehende, Ebene eine sehr reizende und malerische Naturseen eröffnet. Man kommt zuerst nach dem oben erwähnten Dorfe Pleisweiler, ehedem kurpfälzisch, das mit Oberhofen eine Gemeinde von beinahe 2000 Seelen bildet, und dessen Bann auch eine Wappenschmiede und eine Ziegelhütte enthält, sodann nach Gleiszellen, am Krebsbächlein, das mit dem links am Horbache liegenden Gleishorbach nur eine Gemeinde bildet. Auf einer Rebenhöhe, die sich zwischen beiden Dörfern erhebt, steht die Kirche. Man glaubt, das sich ehemals ein Kloster und einige Häuser, Zelle genannt und zur Abtei Klingenmünster gehörig, hier befanden, und nach Zerstörung derselben die zwei Orte am Fuße des Berges erbaut wurden. Auch wird diese Vermutung durch einige noch dort vorhandene Überreste bestätigt. Die Gemeinde stand einst unter dem kurpfälzischen Amte Landeck, und zählt dermalen an 930 Einwohner. Von hier gelangen wir nach dem beträchtlichen Marktflecken Klingenmünster, der, eine Stunde von Bergzabern, am Fuße der Vogesen und am Klingenbache liegt, von dem er seinen Namen hat. Dieser Bach entspringt im Gebirge, oberhalb Sültz, treibt an gegenwärtigem Orte eine Säge, eine Öl, eine Papier und drei Mahlmühlen, und stieß nach dem Rhein. Klingenmünster, dessen Gemarkung auch zwei Meierhöfe umfasst, hat schöne Felder, Wiesen und Weinberge, und ist besonders reich an Waldung. Die Zahl der Einwohner beträgt dermalen 1541. Zur kurpfälzischen Zeit gehörte der Ort zu dem gedachten Unteramte Landecken, Oberamt Germersheim. Das Stift Klingenmünster, von dem der Flecken einen Teil seiner Benennung erhielt, so das derselbe in der umliegenden Gegend auch gewöhnlich Münster heißt, war wohl das älteste Kloster in der Pfalzgrafschaft am Rhein. Es hatte seinen von dem Orte abgesonderten Umfang, und gehörte, unabhängig von dem Unteramte, zu der gleichnamigen Stiftsschaffnerei. Nach einer Bestätigungsurkunde Kaiser Heinrichs IV vom Jahr 1080 ward es von dem fränkischen Könige Dagobert (ungewiss, ob vom ersten oder zweiten dieses Namens) gegründet. Wegen der heiteren und angenehmen Gegend nannte man es damals Blidenfeld (wie sich denn das alt germanische Wort blithe, fröhlich, noch im Englischen bewahrte), sodann Klinga von seiner Lage am genannten Bache, welchen Namen ihm auch jene Urkunde verleiht, bis endlich der gegenwärtige üblich ward. Das mit Benediktinern bevölkerte, Stift wurde sehr reich, da es fast Niemand zinsbar war, und nur, außer dem täglichen Gebet für des Kaisers und des Reiches Wohl, dem Erzbischof von Mainz in Kriegszeiten einen Klepper, nebst einem Scheffel Weizenmehl, senden musste. Mehrere Grafen und Edelleute, wie die von Spanheim, Leiningen, Ochsenstein etc., waren von demselben mit Dörfern und Grundgütern belehnt. Aber durch Üppigkeit, Verschwendung und Zuchtlosigkeit, die unter den Mönchen einrissen, kam das Kloster nach und nach in Verfall, so das endlich der größte Teil seiner Besitzungen an verschiedene Fürsten und Herren veräußert wurde. Von den Äbten des Stiftes, deren Erster, Adelbert, aus dem berühmten schwäbischen Benediktinerkloster Hirsau im Jahr 990 hier her berufen ward, sind mehrere in der Geschichte des Landes angeführt. Der Abt Bernhard, genannt Schilling von Surburg, ein frommer und gelehrter Mann, suchte die unter einigen seiner Vorgänger zerrüttete Disziplin wieder Herzustellen und die verkauften Güter neu zu erwerben. Wenn ihm auch das Letztere durch Ersparung und Tätigkeit zum Teil gelang, so konnte er doch seine moralischen Zwecke nicht erreichen, weshalb er auch 1457 das ihm anvertraute Amt niederlegte. Der Letzte dieser geistlichen Oberherren war Eucharius von Weingarten. Unter seiner Verwaltung kam wieder Beides in Rückgang, der Geldmangel riss ein, und die Mönche wollten sich der vorgeschriebenen Ordnung und Lebensart nicht mehr fügen. Diese Umstände bewogen endlich selbst den Papst Innozenz VIII , die Abtei in ein weltliches Stift zu verwandeln. Die Mönche legten l491 ihre geistlichen Gewänder ab, wurden Chorherren, und erhielten Eucharius zum Probste. Ihm folgten in dieser Würde nacheinander Rupert und Johann, beide aus dem pfalzgräflichen Hause, und Wolf Böcklein. In dem bekannten Bauernkriege erfuhr das Stift großes Unheil, indem es (1552) von den Bewohnern einiger nahe liegender Dörfer geplündert und verwüstet ward. Kurfürst Friedrich III von der Pfalz, der die protestantische Lehre in seinen Landen einführte, zog dieses, wie andere Klöster, ein, und ließ sich 1567 alle Urkunden und Register der Kirche ausliefern. In dem französischen Reunionskriege ward zwar ein gewisser Abbe de Cartigni zum neuen Prälaten von Klingenmünster ernannt, aber seine Trägheit war nicht geeignet, diese Probstei wieder in Aufnahme zu bringen. Endlich nahm Kurpfalz im Jahr 1700 alle Gefälle derselben in Beschlag, und überwies sie nachgehends dem katholischen Kultus im Oberamte Germersheim. Von dem ehemaligen Kloster blieb nur ein altes Gebäude übrig, welches zu Getreidespeichern diente. Dabei war für den Stiftschassner eine besondere Wohnung erbaut. Auch diese Anstalt ward durch den französischen Revolutionskrieg und die aus ihm erfolgte Änderung der Dinge aufgehoben. Neben dem Mönchskloster soll, der Sage nach, ehedem auch ein Nonnenkloster zu St. Magdalena gestanden haben, auf dessen Stelle jetzt Wiesen und Weingärten angelegt sind.
Von dem waldigen Berge, an dessen, Fuß die Überreste der ehemaligen Abtei liegen, schaut noch die Ruine der alten Burg Landeck auf den Ort herab. Ihr Ursprung verliert sich in fabelhafte Zeiten. Man findet in den mit Wahrheit und Dichtung gemischten, Altertümern des Königreichs Austrasien die Nachricht, das Landfredus, ein Stadthalter der fränkischen Könige, im Jahr 420 das Bergschloss Landfreduseck erbaut, König Dagobert I dasselbe 620 erweitert und zum königlichen Stuhl (auf dem man die Gaugerichte hielt) für diese Gegend erwählt habe. Wenn auch diese Kunde nicht historisch begründet ist, so könnte doch die Burg Landeck noch früher, als das Kloster erbaut worden sein, und letzterem nach dessen Stiftung zum Schutze gedient haben. Lag ja doch, wie wir schon anderswo, der Meinung eines berühmten Schriftstellers zufolge, bemerkten, in dem Freiheit und Natur liebenden Charakter unserer altdeutschen Vorfahren die Neigung, sich auf weit umsehenden Höhen, von grünen Wäldern, wiesenreichen Tälern und klaren Bächen umringt, anzusiedeln. Daher entstanden jene uralten Felsburgen, die man in der nachmaligen Fehdezeit zu Schutz und Trutz gebraucht und noch vermehrt hat. Der Name des gegenwärtigen Schlosses soll von seiner Lage auf der höchsten Spitze oder Ecke dieses Landes herkommen. Die geschichtliche Urkunde, welche der Burg Landhechen (später Landeggen, Lanteck und Landeck) zuerst gedenkt, ist vom Jahr 1237. Damals scheinen sie die Grafen von Zweibrücken und von Leiningen, als unmittelbares Reichslehen, gemeinschaftlich besessen zu haben. Als während des stürmischen und für Deutschland so verderblichen Zwischenreichs die Rheinischen Städte einen bewaffneten Bund zu ihrer Sicherheit und zur Aufrechthaltung des Friedens geschlossen, entbrannte hierdurch manche Fehde mit dem hohen und niedern Adel. Da geschah es auch, das der Graf Emich von Leinnigen die Gesandten dieses Bundes, welche im September 1255 von Mainz her nach Straßburg zogen, in dieser Gegend anhalten und an der Feste Landeck eine Zeit lang gesänglich verwahren ließ. Nachmals Fiel der Leiningische Anteil dieser Burgen die Herren von Ochsenstein, und das Ganze wird im 14. Jahrhundert als ein Lehn der Abtei Klingenmünster genannt. Der Zweibrückische Teil kam nachmals an Kurpfalz, der Ochsensteiner an das Bistum Speyer, welches Letztere den seinigen 1709 ebenfalls dem Kurhause gegen Tausch abtrat, so das dieses nunmehr den Besitz des gesamten, nach dem alten Schlosse benannten, Amtes erhielt. Östlich von hier liegt das Dorf Klingen (550 Einwohner), am Klingenbach, wovon im 13. Jahrhundert ein ritterliches Geschlecht benannt ist, und weiter landeinwärts gewahrt man die Dörfer Heuchelheim, mit 820, und Appenhofen, mit 270 Einwohnern am Kaiserbache, die beide in den Lorscher Urkunden vom 8. Jahrhundert, ersteres als Huglinheim und Heuchlenheim (Sitz des Hugelins), letzteres als Abbenhova (Hof des Abbo), vorkommen. Alle drei waren Kurpfälzisch.
Gleich unterhalb Klingenmünster betritt man den Kanton Landau, wo denn der weitere Weg über das Dorf Eschbach, an welchem sich auf dem Berggipfel die Ruine der Madenburg erhebt, und dann rechts durch das flachere Land, nach der Stadt Landau führt. Ehe wir jedoch den Kanton Bergzabern verlassen, sei besonders noch das beträchtliche Dorf Dörrenbach erwähnt, das, südwestlich von dem Hauptort, über, einem Bergtal und am Ursprung des Dörrenbaches gelegen ist. In der Nähe befindet sich die Kolbruunderger Kapelle mit einem Eremiten sitzend. Ein ähnliches, dem heiligen Wendelin geweihtes Kirchlein, nebst Einsiedelei, liegt oberhalb der Stadt Bergzabern. Dörrenbach ist dadurch historisch merkwürdig, das im Mittelalter hier ein Behmgericht soll gewesen sein. Der Ort zu dem eine Loh , Öl, und andere Mühlen, wie auch die so genannte Zöpfelslust Wohnung, gehören, zählt 1181 Einwohner die Feld und Wiesenbau treiben. In alten Urkunden heißt er Türrenbach. Noch übrige Orte des Kantons sind im Gebirge, Die ehemals Kurpfälzischen Dörfer Blankenborn (152 Einwohner) und Bellenborn mit Reichsdorf l290 Einwohner). Dann östlich in der Ebene Mühlhofen, 676, Oberhausen, mit einer Mühle am Erienbach, 500, Hergersweiler, 162, und Dierbach, 617 Einwohner zählend. Sämtlich vorher Zweibrückisch Ferner nach Süden Steinfeld, mit dem Weiler Klein Steinfeld, 16l2 Seelen stark und Kapsweier (1014 Einwohner), mit ersterem vor dem der Probstei Weißenburg unter französischer Hoheit gehörig.