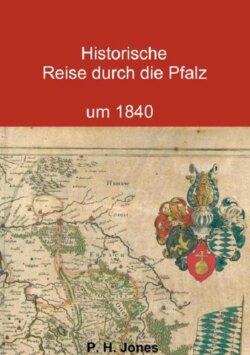Читать книгу Historische Reise durch die Pfalz um 1840 - P. H. Jones - Страница 7
Land Kommissariat Bergzabern Kanton Annweiler
ОглавлениеDieser sehr große Kanton, welcher den von Bergzabern südlich begrenzt, unterscheidet sich von demselben wesentlich dadurch, dass man hier keine fruchtbare Ebene, sondern grössen teils raue, gebirgige und mit Waldungen bedeckte, Gegenden sind. Darum ist auch das Klima weniger mild und der Boden lange nicht so ergiebig. Kartoffeln, Gerste und Hafer sind Hauptprodukte, doch gibt es auch Stellen, wo der Weinstock ziemlich gut gedeiht und schöne Baumfrüchte, sogar etwas Kastanien, erzielt werden. Was aber den Reisenden, der ein Freund der schönen Natur und der Denkmäler des Altertums ist, in diesem Landstriche besonders anzieht, sind die malerischen, wildromantischen Täler, ihre lieblichen Wiesen, von Bächen durchströmt, die schauerlichen Felsgruppen, und die hohen steilen Gebirge, auf deren Gipfeln man die Ruinen alter Burgen erblickt, die eben so seltsam durch ihre Lage, als merkwürdig in den Geschichten und Sagen der rheinischen Vorzeit erscheinen.
Wir treten zuerst unsere Wanderung nach dem herrlichen Annweiler Tale an, wohin gewöhnlich der Weg von Landau her über Sibeldingen, an Godramstein vorbei, genommen wird. Der erste Ort des Kantons, den man auf dieser Seite betritt, ist Albersweiler, ein Marktflecken von 2160 Seelen, grössen teils protestantischer Religion. Er liegt am Eingange des Tals, und wird von der Queich durchflossen, nach welcher jenes auch das Queichtal genannt ist, indem es von hier an derselben hin und bis hinter Falkenburg sanft bergan zieht, worauf es sich wieder längs dem Horbach gegen die Wieslauter herabsenkt. Die Queich durchläuft den ganzen Kanton, nimmt rechts im Gebirge den Rinn und Ebersbach, links den vereinten Fisch und Wellbach, sodann die Sülz, auf, und teilt sich bei Albersweiler in zwei Arme, wovon der linke das eigentliche Flüsschen bleibt, der rechte aber im Jahr 1686 durch den berühmten Ingenieur Bauban, zum Behuf des Festungsbaues von Landau, als Kanal angelegt wurde, der sich bei dieser Stadt wieder mit dem Gewässer des andern vereint. Albersweiler wird in einer Urkunde von 1254 Adelbrachteswilre genannt, da ein adliches Geschlecht dieses Namens vorkommt. Später hieß der Ort Älbrechtswilre, dann Albirswilre etc., bis er endlich den gegenwärtigen Namen erhielt. In dem nahen, von Rebenhügeln eingeschlossenen, Tälchen, am Schweltenbächlein, liegt der Weiler Kanskirchen oder St. Johann, der, nebst dem Steigerthof, (welcher sich am so genannten Steigert, einem über das Gebirge nach der Burg Scharfeneck führenden Wege befindet,) der Ziegelhütte und Waffenschmiede, zur Gemeinde Albersweiler gehört, (ehemals stand die Südseite des letztern Ortes unter Zweibrücken, die Nordseite aber, nebst Kanskirchen und dem Steigerhofe, besaßen die Fürsten von Löwenstein Werthheim wegen der Herrschaft Scharfeneck. Der schon im Anfang des l3. Jahrhunderts erwähnte, Name Kanskirchen entstand aus Johanniskirch den, wie noch jetzt die dortige Kirche heißt. In diesem Örtchen bestand auch einst ein Frauenkloster. Albersweiler hat schöne Weinberge und betreibt die Kultur derselben stärker, als irgendeine Gemeinde des Kantons. Auch ist dabei ein sehr ergiebiger Granitsteinbruch. Durch den Ort geht die Straße, welche von Landau über Annweiler und Pirmasens nach Zweibrücken zieht.
Unsern Weg auf dieser Straße, an dem Ufer der Queich hin, fortsetzend, kommen wir bald nach dem Städtchen Annweiler, das eine dreiviertel Stunde von hier und 2 Stunden von Landau entfernt ist. Mit Recht wird seine malerische Lage gerühmt. Ein anmutiges Wiesenthal, durch welches der starke helle Bach, an dessen beiden Ufern der Ort erbaut ist, heranfurtet, erstreckt sich zwischen waldreichen Höhen, auf welchen hier und da die Trümmer zerfallener Burgen emporragen. In mancher wunderlichen Form erscheinen die Felsen, Kolosse des Gebirges, deren einige wie alte Schlösser, andere, in größerer Masse, wie ganze Dörfer von der Natur gestaltet sind. Diesen seltsamen Anblick hat man besonders auf dem Fußwege, der von Annweiler aus durch die wilde Gegend nach Dahn führt. Die Stadt Annweiler (ehemals Anwilre, Annewil und Anninwilir) bestand, nach Urkunden, schon im Anfange des 12. Jahrhunderts als Dorf, welches Friedrich II Herzog in Schwaben, 1116 gegen Mornsbrunn (im Elsass, an der Sur) eintauschte. (Siehe Urgeschichte des Herzogtums Zweibrücken, nach Johaunis und Crollius Kalenderarbeiten) Kaiser Friedrich I (Barbarossa), Sohn des genannten Herzogs, umgab den Ort mit Mauern, und erklärte ihn somit zur Stad. Nach Herzogs klassischer Chronik wurde ihm zugleich Friedrichs Gemahlin Anna der lateinische Name Annae Villa erteilt. Der Enkel dieses Kaisers, Friedrich II verlieh demselben sogar die Rechte und Freiheiten der Stadt Speyer. Nach Abgang des Hohen, staufischen Hauses ward Annweiler (1269) eine Reichsstadt. Aber Kaiser Ludwig IV verpfändete diese 1330 an seine Neffen, die Pfalzgrafen. Jedoch mit Bestätigung ihrer Reichsfreiheiten, und endlich kam sie ganz in Besitz des Pfalzgräflichen Hauses, und namentlich der Herzöge von Zweibrücken, als eine zu dem Oberamte Bergzabern gehörigen Stadtschultheiserei, bis sie in neuerer Zeit das wechselnde Los der ganzen Gegend teilte. Dermalen ist Annweiler der Hauptort des Kantons, und es befinden sich hier ein Friedensgericht, zwei Notariate, eine Gendarmerie Station, ein Physikat, ein Rentamt und ein Forstamt, zu welchem letztern 5 Revierförstereien im Kanton gehören. Die Stadt, nebst dem Dorfe Sarnstal, mit welchem sie eine Gemeinde bildet, der Minken und Michelischen Papiermühle , zählt 2602, meist protestantische, Einwohner Weinbau, starke Obstpflanzung und Viehzucht, welche die grasreichen Täler sehr begünstigen, sind Haupterwerbzweige. Auch wird hier Holzhandel getrieben, und Leder, Papier und Kirschenwasser verfertigt. Der beste Gasthof ist der zum Trifels. Das genannte Dorf Sarnstal (von einigen auch Sarnstall geschrieben) liegt unweit der Stadt am Queichflusse. Professor Crollius konnte von ihm keine Nachrichten vor dem 15. Jahrhundert auffinden. Beide Konfessionen in Annweiler haben Pfarreien, mit der katholischen ist zugleich eine Schulinspektion vereint.
Wenden wir uns jetzt nach den östlich von hier aufsteigenden Höhen des Vogesischen Gebirges, wo auf dem erhabensten Gipfel des in drei Felsenspitzen geteilten Hag oder Sonnenbergs die uralte Feste Trifels steht. Ein schöner Waldweg, der unter Leitung des Königlich Bayrischen Herrn Forstmeisters Cramer angelegt worden, führt den Wanderer in einer kleinen Stunde von Annweiler zu dieser durch Geschichte und Sage so merkwürdigen Stelle hinauf. Dies war vorher ein schmaler Pfad für Fußgänger. Ehedem befand sich hier noch ein Weg, der Eselssteig genannt, auf welchem die Burgbewohner ihre Lebensmittel durch Esel hinaufbringen ließen, und ein Dritter, dort in Krümmungen am steilen Berg hinanlief und zum Reiten und Fahren gebraucht wurde. Man gelangt nun, an einem tiefen, in den Fels gehauenen und von einem Turme beschirmten, Brunnen vorbei, in das Innere der Burg. Ihr hoher, viereckiger, aus Quadersteinen erbauter, Turm, steht durch mehrere Bogen, wovon einer noch in gutem Stande ist, mit jenem in Verbindung. Einige Gemächer der Ruine sind ziemlich erhalten, und auf steinernen Treppen gelangt man zu den Überresten der Kapelle, wo, historischen Nachrichten zufolge, von 1125 bis 1273 die Reichskleinodien, oder der kaiserliche Krönungsschmuck, aufbewahrt wurden. Hinter diesen Gebäuden sind nur mächtige Trümmer. Doch bestehen noch einige unterirdische Gewölbe, die wahrscheinlich zu Gefängnissen bestimmt waren. Herrlich ist von dieser Bergkuppe die Aussicht auf das romantische, von der Queich durchströmte Annweiler Tal, wo sich eine mannichfache Naturseen von grünen Auen, Rebenhügeln, düsterer Waldung und grotesken Steinmassen ausbreiten, dann rings auf die wilden Höhen, welche enge Täler trennen, und endlich nach Osten hin, zwischen zwei Bergen hindurch, in die lachende, unübersehbare Ebene, diesernhin der stolze Rhein wie ein Silberband umwindet. Auf dem zweiten, von diesem durch ein kleines Tal geschiedenen, Gipfel des Sonnenberges blickt man die Trümmer der ehemaligen Feste Anebos. Oben ist eine Felsenplatte, zu der, wie an den Spuren erkenntlich, ehedem eine Treppe geführt hat. Einst nannte sich ein adliches Geschlecht von dieser Burg, wie denn in Urkunden von 1194 und 1197 zwei Brüder, Eberhard und Heinrich, als Marschälle von Anebos erwähnt sind. Gegenwärtig ist dieser Platz nur ein Chaos von Felsstücken und zerfallenem Mauerwerk, wo man noch den Schutt einer gewesenen Ringmauer und die Spur eines in den Stein gehauenen Grabens wahrnimmt. Die dritte und niedrigste Bergspitze trägt die Ruine von Scharfenberg, in der Gegend unter dem Namen die Münze bekannt. Das Hinansteigen durch das dichte Gebüsch, womit die Felsen bewachsen sind, während immer Steine herabrollen, geschieht mit vieler Mühe und Beschwerde. Auch bei dieser Burg befindet sich ein tiefer Brunnen, und ein, noch ziemlich erhaltener, viereckiger Turm, etwa 150 Fuß hoch. Man steht hier von düsterer Wildnis umgeben, aber die ringshin sich verbreitende Aussicht ist noch freier und mannichfaltiger, als auf dem Trifels. In der Nähe überrascht das Auge ein hoher Felsenkoloss, der Asselstein genannt, und in der Ferne ragt der Engelsberg empor, wo sich ein merkwürdiges Denkmal der Vorzeit befindet, nämlich zwei ungeheure Steine, über welchen horizontal ein drittes Felsenstück von gleicher Größe ruht. Mit Recht schließt man aus dieser Form, das das Monument altkeltischen Ursprungs sei. Schon in Urkunden des 12 und l3 Jahrhunderts kommen Ritter von Scharfenberg vor. Nach verschiedenen Wechseln wird die Burg ein Reichslehen, das aber Kaiser Ludwig IV. dem Abte zu Weißenburg überließ. Im 15. Jahrhundert bemächtigten sich ihrer die Pfalzgrafen des Zweibrückischen Hauses. Die deshalb entstandene Fehde, worin das Stift von Kurpfalz unterstützt wurde, beschloss ein Vergleich, wonach der Herzog von Zweibrücken dieses Schloss von Weißenburg zu Lehen nahm. Aber es ward, wie viele andere Burgen an den Vogesen, in dem Bauernaufstande um das Jahr 1525 durch Feuer verheert, und der damalige Inhaber und herzogliche Lehnsmann, Ritter Christoph Landschad von Steinach, war außer Stand, es wieder aufzubauen. Der dreißigjährige und der nach ihm erfolgte französische Reunions Krieg vollendeten die gänzliche Zerstörung dieser Feste.
Sowohl Scharfenberg als Anebos scheint immer von dem oben gedachten Trifels abhängig gewesen zu sein, welcher letztere, als die Hauptburg, vorzugsweise den Namen des dreigestalteten Felsenberges erhielt. Auch wird derselbe in Urkunden früherer Zeit Dreifels genannt, Er war lange Zeit eine Reichsfeste, und ist wichtig in der Geschichte des Landes. Wahrscheinlich hat Kaiser Konrad II aus dem Stamme der Salier, der mehrere Burgen gegen Lothringen hin erbaut, auch dieses Schloss im 11 Jahrhundert gegründet. Es diente zugleich als Schirm des Reichs und als Staatsgefängnis. Unter Heinrich V war hier der Mainzer Erzbischof Adelbert von Saarbrücken von 1113 bis 1115, auch der tapfere Graf Wipprecht von Groitsch, nachher Markgraf in Lausitz, drei Jahre lang eingekerkert. Die Hohenstaufischen Kaiser, namentlich Friedrich I, Heinrich VI und Friedrich II hatten den Trifels zu einem ihrer Lieblingssitze erwählt. Mehrere kaiserliche Urkunden sind daselbst ausgefertigt. Zudem ist diese Burg aus jener Zeit berühmt durch die Gefangenschaft des heldenmütigen König Richard Löwenherz. Dieser wurde, als ihn auf seiner Rückkehr von dem Kreuzzuge nach Palästina ein Sturm an die Küsten Dalmatiens verschlagen, durch den Herzog Leopold von Österreich, der, wegen einer Streitigkeit bei der Eroberung von Ptolemais, sein persönlicher Feind war, verhaftet und auf das Schloss Thierstein an der Donau gebracht. Aber Kaiser Heinrich VI auch ein Gegner Richards, ließ sich denselben sogleich ausliefen. Mit der Erklärung, das kein Herzog das Recht habe, einen König gefangen zu halten, worauf dieser, nebst seiner Begleitung, nach dem Trifels abgeführt ward, wo man ihnen Gemächer in dem beschriebenen hohen Turme, damals der schwarze Turm genannt, anwies. Obschon bewacht, fehlte es ihnen hier nicht an guter Bewirtung, und der König ward nach seinem Range geehrt. Eine geschichtliche Urkunde meldet, das er am 24. März 1193 hier eingetürmt, aber schon am 19. April nach dem Hoflager des Kaisers in Hagenau beschieden worden sei, wo ihn diese für 70,000 Mark Silber frei zu geben versprochen habe. Bald darauf wäre Richard durch die Bemühung seiner Mutter Eleonore und die Beiträge der ganzen englischen Nation, welche ihn sehr liebte, wieder gelöst worden und frei in sein Reich zurückgekehrt. Die schöne, romantische Sage, das ihn sein Freund und Minnesänger Blundel, mit Hilfe einiger treuen Ritter, aus dem Turme zu Trifels befreit habe, ist allgemein bekannt, und hat wohl, wie alle Dichtungen dieser Art, ihren historischen Grund. Ob übrigens Blundel den Aufenthalt des gefangenen Königs schon auf Thierstein aber erst hier entdeckt hat, darüber ist man nicht einig, weil die Geschichte keine bestimmte Nachricht erteilt. Im Mai 1294 hielt Kaiser Heinrich auf Trifels einen glänzenden Hof, wo der Herzog Simon von Lothringen, Otto, Pfalzgraf und Graf in Burgund, und Philipp (beide des Kaisers Brüder, der Bischof Otto von Speyer, Graf Sigebert von Frankenburg im Elsass, und viele andere Edle und Dienstmänner, gegenwärtig waren. Bald darauf trat er, durch das große, für König Richard erhaltene, Lösegeld in Stand gesetzt, den siegreichen Feldzug nach Neapel und Sizilien an. Die ungeheueren Schätze von Gold, Silber und andern Kostbarkeiten, die er dort gesammelt, wurden in seine Schatzkammer zu Trifels gebracht. Aber der Kaiser starb 1197 in Sizilien, und sein Bruder und Nachfolger, König Philipp, der die Vormundschaft über den noch minderjährigen Prinzen Friedrich II. führte, kam in Besitz dieser Reichtümer und der Reichsinsignien, die man zu Trifels aufbewahrte. Als aber Philipp, der die deutsche Krone gegen Otto von Braunschweig behauptete, im Jahre 1208 ermordet worden, zog sich dessen Kanzler Konrad von Scharfeneck, Bischof zu Speyer und Metz, in die Feste Trifels zurück, und wollte dem nunmehrigen Kaiser Otto IV, der sich mit Philipps Tochter Beatrix vermählte, die Reichsinsignien nicht herausliefern, als bis er in der Kanzlerwürde bestätigt sei. Allein der genannte Sohn Heinrich VI, Friedrich II, durch seine großen und edlen Eigenschaften einer der glänzendsten Sterne in der Geschichte aller Zeiten, machte jetzt (1212) seine Ansprüche auf das Reich geltend, und Otto musste ihm den Kaiserthron überlassen. Sieben Jahre später bewilligte er, aus besonderer Vorliebe für seine Burg Trifels, dem Orte Annweiler die Privilegien einer Stadt und eine Münze. Nach diesem Schlosse flüchtete sich auch sein Sohn Heinrich vor dem Zorne des Vaters, gegen den er sich empört hatte. Im Jahre 1246 nahm der zum römischen König erwählte Konrad VI, zweiter Sohn Friedrichs II, Besitz vom Trifels, und erhielt die darin bewahrten Reichskleinodien von Isengarde, Gemahlin Philipps von Falkenstein, deren Aufsicht sie der Kaiser anvertraut hatte. Wilhelm, Graf von Holland, der nach Konrad zum Reichsoberhaupt erwählt ward, schätzte sich sehr glücklich, das er durch die Einnahme des Schlosses Trifels die Zeichen kaiserlicher Majestät erhielt. Da der Papst Urban IV an denselben schrieb, das man die Städte und Festen, besonders die Feste Treveles, dem gekrönten römischen Könige anweisen würde, so liegt hierin schon ein deutlicher Beweis, das diese Burg sehr hoch geschützt und ausgezeichnet war. Ja, es erhellt aus den Urkunden jener Zeit, das sie dem neuen Beherrscher vom Tage seiner Krönung an, gleichsam als Unterpfand des Reiches, eingeräumt wurde. Sie stand damals noch unter Obhut der Herrn von Falkenstein, als kaiserlicher Burgvoigte, namentlich des gedachten Philipp, der mit seiner Gemahlin, als einer Erbin von Münzenberg, seit 1256 die Reichskämmerer Würde in dem rheinischen Franken erhalten hatte. Der gleichnamige Sohn desselben, dem er in der Teilung den Schirm der Burgen Trifels und Anebos übergab, stellte 1269, gegen einen Revers, dem neuerwählten Kaiser Richard, Bruder des Königs Heinrich III von England, die hier verwahrten Kleinodien (wahrscheinlich zur Feierlichkeit seines fürstlichen Beilagers in Kaiserslautern) zu. Als das unruhige Zwischenreich durch die Wahl Rudolphs von Habsburg (1273) ein Ende nahm, wurde, nach glaubhafter Nachricht, die ihm zu seiner Krönung übergebenen Reichsinsignien auf seinem Schlosse Ryburg, in der Schweiz hinterlegt. Doch unter Adolph von Nassau, dem Gegenkaiser Albrechts I, befanden sie sich wieder auf Trifels, und Kaiser Heinrich VII, aus dem Hause Luxemburg, verwilligte 1310 noch 1200 Pfund Heller zur Unterhaltung dieser und der Feste Neukastel. Doch ward Trifels damals nicht mehr von den Falkensteinern bewacht, sondern stand unter der Aufsicht besonderer Reichsvogte, oder auch der Landvögte des Speyergau. Im Jahre 1330 verpfändete Kaiser Ludwig IV diese Burg, so wie Annweiler, Germersheim, Gutenberg und andere Orte, an die Pfalzgrafen bei Rhein, wo sie denn 1444 nach der unter den Kurfürstlichen Söhnen geschehenen Teilung, dem Hauses Zweibrücken anheim Fiel. Im Jahre 1602 fuhr ein Blitzstrahl in das Schloss, wodurch es größtenteils ein Raub der Flammen wurde. Doch diente es, nebst den zwei benachbarten Burgen, im 30jährigen Kriege noch dem Landvolke zur Wohnung, ward aber, als 1635 eine pestartige Krankheit ausbrach, gänzlich verlassen. Seitdem ist Trifels ein verödetes Denkmal der Vorzeit, und der gefühlvolle Wanderer, der die großartigen Trümmer besteigt, erfreut sich noch an den wilden Schönheiten der ihn umgebenden Natur, während ihn zugleich wehmütige Erinnerungen an die Vergänglichkeit alles irdischen Glanzes umschweben. Südwärts von hier, in einem Seitentälchen und am Osterbächlein, liegt das Dorf Bindersbach, ehedem Löwenstein Werthheimisch, mit 207 Einwohnern.
Unsere Wanderung in den nördlichen Teil des Kantons antretend, kommen wir zuerst nach dem schon auf dem Wege von Albersweiler nach Annweiler berührten Dorfe Queichhambach, mit 278 Einwohnern, am linken Ufer der Queich, das in Urkunden des Mittelalters bald Hambach , bald Hahnenbach genannt ist. Den letztern Namen hat es von dem seine Gemarkung durchfließenden Hahnenbächlein. Dieses Dorf darf aber mit dem auf der andern Seite in die Queich fallenden Hahnenbach nicht verwechselt werden. Ehemals von der Reichsvogtei zu Trifels abhängig, Fiel der Ort nachher an Zweibrücken, und gehörte zum Amte Neukastel. Im Queichhambacher Banne, zu dem die Kaisers und Neumühle gehört, lag vordem das Dorf Steinbach, welches aber längst eingegangen ist, und nur noch durch die Steinbacher Wiesen, die das Bächlein gleiches Namens bewässert, in der Erinnerung lebt. Der nächste Ort ist Grävenhausen, 700 Einwohner schon in einer Urkunde von 817 Grazelveshusen genannt, am Hahnenbach. Es gehörte im 18. Jahrhundert von adligem Hause von Metz, worauf es (1189) an das Kloster Eußertal, und später mit diesem an Kurpfalz kam. Gleiches Schicksal hatten die benachbarten Höfe Mettenbach und Rotenbach, ehedem Dörfer, aber schon zur Blütezeit des Klosters in Meiereien verwandelt. Auf den umliegenden Bergen wird ein guter roter Wein gebaut. Rechts von Grävenhausen geht der Weg nach Ramberg, einem großen Dorfe, von beinahe 12l0 Einwohnern, am Fuße des gleichnamigen Berges liegend, wo sich die Ruine des alten Schlosses Ramberg auf Felsen erhebt. Wahrscheinlich ist dasselbe von 1150 bis 1163 erbaut worden. Von dieser Zeit bis in das 16. Jahrhundert kommen Ritter Dietlieb von Ramesberg vor. Ihr Name erlosch 1520. Eine schauerliche Kunde von dieser Burg, nach welcher einst ein berüchtigter Räuber, der sich Ritter nannte, hier eingekehrt, und, um den Geldschatz des Eigentümers zu erbeuten, diesen Nachts im Schlafe durch seinen Knecht ermorden lassen wollte, letzterer aber, der das ihm bezeichnete Gemach verfehlte, in der Dunkelheit den Bösewicht selbst erstach, ist in Schreibers Volkssagen, wie auch in meinen Sagen und Geschichten des Rheinlandes, mitgeteilt. Der letzte Sprössling der Ramberger Hans, verkaufte seine Burg und Güter an die Grafen von Dalberg, welche sie aber bald darauf dem Grafen Friedrich von Löwenstein, Herrn von Scharfeneck, überließen, dessen Haus auch bis zum Revolutionskriege die Herrschaft besaß. In den Feldern des Dorfes Ramberg werden viele Kirschen gepflegt. Diese und das daraus bereitete Kirschenwasser sind ein Haupterwerbszweig der Einwohner Auch werden hier eine Menge Bürsten verfertigt und auswärts verkauft. Zu dem Orte gehört der Hof Modeck, auch Modenberg, und Modenbacher Hof genannt, der ehemals ein Dorf war. Er liegt am Modenbach, jenseits der bei der Ruine von Meistersel hinziehenden Rothsteig, und an der Modenbacher Steig, die in das Gebirge zur Hochstraße führt. Die Burg, Meistersel, deren graue Trümmer von dieser Anhöhe herabschauen, war zu Ende des 11 Jahrhunderts ein Eigentum des Bischofs Johann von Speyer, der sie seinen Nachfolgern im Hochstift vermachte. Als Lehensmänner desselben sind 1186 Ritter von Meistersel (auch Meistersal, Meisterfelden) und späterhin Ritter von Modenbach, genannt. Die letzten gehörten zu dem adlichen Geschlechte von Kopf. Im 14 Jahrhundert, wo Schloss und Dorf ein Lehen der Abtei Klingenmünster waren, befanden sich die Herren von Ochsenstein, sodann die Landschaden von Steinach, die Dalberge, etc., in deren Besitz. Endlich brachten 1662 und 1665 das gräfliche Haus von der Lehen und Kurpfalz die Oberlehnsherrschaft häuslich an sich, so das ersteres siebenachtel und letzteres einachtel davon erhielt.
Das benachbarte, ehemals Löwensteinische Dorf Derenbach, 520 Einwohner am gleichnamigen Bache, in der Bürgermeisterei und im Tale von Ramberg liegend, kommt in Urkunden des 12 Jahrhunderts als Tegerenbach und Deirenbach vor. Zu ihm gehört der Pfalzhof, auch Breitwiese genannt. Nordöstlich von diesem Orte zeigt sich auf den wilden Höhen die schöne Ruine der Burg Scharfeneck, welche aber, da sie in der Gemarkung von Flemlingen liegt, zu dem angrenzenden Kanton Edenkoben gerechnet wird. Ehedem war sie das Haupt einer unmittelbaren Herrschaft, deren Besitzer unter den hohen Adel des Reichs gehörten. Auch waren die Herren von Scharfeneck von den Kaisern mit der Feste Scharfenberg bei Trifels beliehen, und fügten darum deren Namen zu ihrer Würde. Ein Ritter aus diesem Hause verband sich in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit einer Dame aus dem herrlichen Geschlechte von Metz, wodurch, ihm noch eine große Erbschaft zufiel, und im Jahre 1274 erscheint ein Johann von Scharfenect, der sich zugleich Herr von Metis oder Mez nannte. Nach Abgang der kurpfälzischen Erbtruchsesse, Herren von Alzey, erhielt diese Familie ihr Amt. Aber sie erlosch um das Jahr 1430 und die Herrschaft Scharfeneck kam an Kurpfalz. Friedrich der Siegreiche belehnte damit, 1477 seinen und der schönen Klara von Detten natürlichen Sohn Ludwig, von dem das gräflich und fürstliche Haus Löwenstein Werthheim abstammt. In den pfälzischen Lehnbriefen wird die Besitzung als „Herrschaft und Schloss Alt und Neu Scharfeneck in dem Gebirge des Wasgaues“ angeführt.
Nordwestlich von Grävenhausen kommt man nach Eußertal, einem Dorfe mit 800 und etlichen Einwohnern, das in einem Wiesentale, zwischen zwei steilen Bergen, und an dem Sülzbächlein liegt. Dieses, auch Gevaiden und Mühlbach genannt, entspringt, eine Stunde von hier, in der obern Haingeraide treibt im Dorf eine Mühle und fließt nach der Queich. Das Eußerstal, welches dem Ort seinen Namen verlieh, hieß im 12. Jahrhundert Uterstal (Tal des Uter's), etwas später Uzers auch Usersund Ufserstal, welches letztere Manche, wegen seiner Entlegenheit, für äußerstes Tal erklären. Aber in lateinischen Urkunden wird es Uterina Vallis und Usterinae Valles genannt, was den Grund der ersten Benennung, das vielleicht in grauer Vorzeit ein Ritter oder Einsiedel, Uter, daselbst gehauset, zu erweisen scheint. Jenes Dorf ist berühmt durch die bei ihm stehende Ruine des Zisterzienserklosters Eußerstal, welches eine Kolonie der Abtei Weiler Betnach (Metzer Diöces) war, und demnach zur Zisterzienser linte Morimund gehörte. Es ward 1148 von einem Ritter Stephan von Merlheim gestiftet, dessen Bruder Konrad ihm bereits 1l09, als er in das Kloster Hirsau trat, sein Erbteil überlassen hatte. Schon wenige Jahre nach der Gründung des Stiftes mehrten sich dessen Besitzungen, und die Anstalt gelangte nach und nach durch zahlreiche Schenkungen der Kaiser, Fürsten, Grafen und Herren zu unermesslichen Gütern und Gerechtsamen. Auch wussten sich die Mönche das Prärogativ einer Obhut der Reichskleinodien auf dem Trifels zu erwerben, welche mit großen Vorteilen verbunden war. Durch alles dies kam die Abtei in einen sehr blühenden Zustand. Allein die ganze Umgegend verarmte, weil jene das Feste an sich gebracht und am Ende Niemand mehr Grundeigentum besaß. Darum fügte sich jeder vernünftige Bewohner in die traurige Notwendigkeit, seinen Herd zu verlassen, und siedelte sich in besseren Gefilden an. So gingen mehrere Dörfer ein, und andere wurden in bloße Höfe verwandelt. Aber endlich begann auch die Unglücksperiode des Klosters. Herzog Ludwig der Schwarze von Zweibrücken kam in Fehde mit dem Kurfürsten Friedrich I von der Pfalz, der damals Schirmherr des Klosters war. Er überfiel im Jahre 1455, sodann wieder, den päpstlichen Bann nicht achtend, 1460 das Kloster, wo es starke Plünderung erlitt und das Letztem sogar in Brand gesteckt wurde. Doch ward noch, als die wilden Krieger sich entfernt, mit Hilfe dienstfertiger Einwohner der benachbarten Dörfer, die prachtvolle Kirche und Einiges von den Wohnungen vor dem Feuer gerettet, so das die Mönche in kurzer Zeit wieder ihren Sitz einnehmen konnten. Als aber im Anfange des 16 Jahrhunderts der Krieg wieder den Kurfürsten Philipp von der Pfalz, wegen der bayrischen Erbfolge, ausbrach, ließ Herzog Alexander von Zweibrücken diese Abtei abermals plündern und anzünden. Das dritte Unheil erfuhr sie im Jahre 1525 durch die aufrührerischen Bauern, welche, im Sturm hinein, dringend, raubten und verheerten, was ihnen vorkam. Auch wurden, bei den damals erfolgten Religionsveranstaltungen, die Mönche von ihren eigenen Beschützern so gedemütigt, das der größte Teil seinen Gelübde entsagte oder sich nach anderen Klöstern wandte. Endlich zog (1565) Kurfürst Friedrich III auch dieses Kloster ein, um, wie Crollius sagt: „dessen Einkünfte zu besseren Bestimmungen anzuwenden.“ Von Äbten, die ihm seit der Gründung bis zum Verfalle seiner geistlichen Macht vorgestanden, nennt Widder 17, Remling (urkundliche Geschichte der ehemaligen Abteien und Klöster) aber 3l Namen. Der erste hieß Eberhard, der (wahrscheinlich) letzte Martin II, genannt Zydel. Dieser ward 1551 erwählt, und suchte mit allem Eifer die verwüsteten Gebäude wieder herzustellen, was noch eine lesbare lateinische Inschrift an dem so genannten runden Abtturme bezeugt. Während des 30jährigen Kriegs fanden sich wieder einige Mönche hier ein und erwählten sogar einen Abt. Darauf übergab Kaiser Ferdinand II das Kloster den Jesuiten, deren Herrschaft auf diesem Boden nicht gedeihen wollte. Durch den westphälischen Frieden kam das Stift wieder an Kurpfalz, und warb den Evangelisch Reformierten neuerdings eingeräumt. Der Kurfürst überließ die Gebäude und Güter meist piemontesischen Auswanderern, wo denn allmählig das jetzige Dorf Eußertal entstand. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die Franzosen in die Pfalz ein Fielen, und, auf den Grund gestützt, das vordem dieses ganze Land zum Königreich Austrosien gehört, das Oberamt Germersheim in Besitz nahmen, erhielt der Zisterzienser Abt de Poissons das hiesige Kloster, vertauschte es aber an de Crecy Bischof von Grasse, den auch eine päpstliche Bulle darin bestätigte. Allein nach dem Ryswiker Frieden (1697) Fiel es an die Pfalz zurück, und ward durch die bekannte Religionserklärung von 1705 mit allen seinen Einkünften der katholisch geistlichen Verwaltung einverleibt. Späterhin ward daselbst eine Probstei errichtet, welche man 1716 dem Domherrn Heinrich Wilhelm Freiherrn von Sickingen, kurpfälzischem Oberstkämmerer und Oberamtmann zu Bretten, übertrug, der auch bis zu seinem 1757 erfolgten Tod in ihrem Besitze war. Alsdann kam sie wieder an die genannte geistliche Verwaltung, bis die französische Revolution alle diese Wechsel beendigte. Von den Klostergebäuden sind nur einige Reste, und von der prächtigen Kirche noch das Chor, übrig. Eine steinerne Platte oberhalb der Kanzel zeigt den Namen des Stifters an. Zu dem Dorfe gehören zwei Meierhöfe, der Stockwieser, gewöhnlich Vogelstock genannt, und der Pfalzhof, welche in dem Eussers Taler Walde liegen. Dieser bildet einen Teil der großen Forstalmende, die unter dem Namen Ober Haingeraide bekannt ist.
Wir kehren nach Annweiler zurück, und folgen nach Westen, die Queich aufwärts, der Landstraße, so nach Pirmasens und Zweibrücken führt. Auf ihr betritt man das Dorf Rinntal (an 450 Einwohner), welches schon in einer Urkunde von 817 erwähnt ist, und, nebst dem Geistopferhofe, ehedem Zweibrückisch war, und kommt dann nach Wilgartswiesen, zu dessen Bürgermeisterei letzteres gehört, es ist kein Zweifel, das im 8 Jahrhundert hier eine Dame von hohem fränkischem Adel, Namens Wiligart (deren Gemahl Weringer Stifter des Klosters Hornbach, in der Gegend von Zweibrücken war), einen Wohnhof besaß, der nach ihr Wilgarthawise genannt wurde. Dieses bemerkt eine von Kaiser Ludwig dem Frommen im Jahre 828 zu Ingelheim ausgestellte Urkunde, worin die gleichnamige Urenkelin dieser Frau, nebst ihrem Neffen Werinher, den gedachten Hof, mit Gerichtsbarkeit und Gütern, dem heiligen Pirminius, d. h. dem Kloster Hornbach schenkte, woher man auch die umliegende Gegend den Pirmanns auch Pfirmesbezirk nannte. Das nachmals hier entstandene Dorf Wilgartswiesen war der Hauptort des Amtes Falkenburg, welches Zweibrücken und Leiningen gemeinschaftlich besaßen. Es halte seinen Namen von der Reichsfeste Falkenburg oder Falkenberg, deren Ruine bei dem Orte, auf einem Vorsprunge des Waldgebirges, steht. Sie erscheint zum ersten Mal in einer Urkunde des Jahres 1330, wo Kaiser Ludwig IV, dieselbe an seine Neffen die Pfalzgrafen, verpfändet. Da die Vogtei über des heiligen Pirmins Gut dieser Feste Zustand, so ward solche nunmehr als Landeshoheit erklärt und das Gut säkularisiert, wo denn Sämtliches an Pfalz Zweibrücken, doch bald darauf auch ein Teil an Leiningen, kam, so das Ersteres dreiviertel und Letzteres einviertel der Domänial Einkünfte, die Gerichtskosten aber jedes zur Hälfte bezog. Die Burg ward 1674 von den Franzosen zerstört. Das nachher, als Sitz des Amtmannes, unten am Berg, erbaute Schloss hatte das nämliche Schicksal im Revolutionskriege. In dieser wilden Gegend liegen, zwischen Bergschluchten, Felsklüften und dichten Wäldern, in einer Ausdehnung, welche mehr denn eine geographische Meile breit und 2 Meilen lang ist, verschiedene, zur Gemeinde Wilgartswiesen gehörige, Weiler, Höfe, Mühlen, Häuser und Hütten, mit welchen der Ort eine Bevölkerung von etwa 1083 Seelen hat. Solche sind: Eine Mahl, Öl und Sägemühle, beim Falkenburger Schloss die Wetthöhe, auch Vogelhütte und Nagelschmiede genannt. Der Horbacher Hof, an der Straße und dem Falkenburger Walde, wo der von dem Horberge herabfließende Bach sich mit dem Kaltenbach vereint, beim Hermersberger Hof, mit der Wüsten oder Hochstätter Mühle, auf welcher Stelle, den entdeckten Ruinen nach, in der Vorzeit das Dorf Herboldesberg stand. Ederbach, nördlich von hier, am Bache gleichen Namens, die einsame Wohnung des Gemeindeförsters von Annweiler. Hochstätten, auf der Höhe des Wasichen, über eine Meile nordwärts von Wilgartswiesen ein Weiler, der ehemals ein Dorf gewesen, und wo jetzt einer der Grundeigentümer zugleich Adjunkt jener Gemeinde ist. Ferner Speyerbrunn, an der eben so benannten Quelle des Speyerbachs (auch niederer Speyer und Erlenbach genannt), dann Schwarzbach und Erlenbach, einige Häuser und Hütten an den gleichnamigen Bächen, die sich in den Speyerbrunn ergießen, enthaltend. Die Bewohner dieser Stellen ziehen ihren Erwerb aus den Waldungen und der hier statt habenden Holzflößerei. Der letzte Punkt in dieser Wildnis ist das Forsthaus am Johanniskreuz, die Wohnung des Revierförsters für den Tauberwald, im Kanton Kaiserslautern, der hier beginnt, und einen Teil der Forste, die man obere Frankweide nennt. Es steht auf der Schneeschmelze des Wasichen, an der alten Straße, die von Annweiler über Eußertal nach Trippstadt und Kaiserslautern zieht. Nahe dabei erscheint das alte, steinerne Johanneskreuz, welches dermalen als Grenzstein dient, und nicht weit von diesem liegen 4 nach Trippstadt gehörige Hütten in den Privatwaldungen dieser Gemeinde.
Des malerischen Weges von Wilgartswiesen nach dem Dahner Tale sei in der Folge, bei Schilderung des letztern, gedacht. Wenden wir uns jetzt von hier nach dem südlichen Teile des Kantons Annweiler, und betreten das, sowohl durch seine romantischen Schönheiten als in geologischem Betracht merkwürdige Gossersweiler Tal. Es bildet gleichsam einen Kessel zwischen zwei Ästen des Vogesischen Gebirges, und Besteht aus mehreren. nach Süd, West und Nord auslaufenden Tälern, worin 12 kleine Landgemeinden enthalten sind. Der Ort, von dem das Tal seinen Namen hat, ist Gossersweiler, auf einer Hochebene, wo der Klingbach entspringt. Nebst ihm standen ehemals noch 5 umliegende Dörfer unter Kurpfalz, und hatten mit jenem nur ein Gericht. Diese sind: Schwanheim, am Riundache, Lueg, an demselben, zur Bürgermeisterei Schwanheim gehörig, und schon in Urkunden von 1046 als Luoch erwähnt. Stein und Sülz, nebeneinander am Klingbach liegend, und Völkersweiler, am Kaiserbache, alle drei in der Bürgermeisterei Gossersweiler begriffen. Der Bann des im 30jahrigen Kriege untergegangenen Dörfleins Bolloch ist noch umsteint und mit Völkersweiler verbunden. Die Gesamtzahl der Bevölkerung dieser 6 Ortschaften, welche, nach Widder, im Jahre 1785 nur 1118 Seelen betrug, hat sich seit dieser Zeit sehr vermehrt, so das sie jetzt auf mehr denn 2600 Einwohner meist katholischer Religion, gerechnet wird. Die romantische Sage der Vorzeit erzählt von einem Ritter von Huneberg aus den Vogesen, der arm, aber sehr tapfer, rechtschaffen und wohltätig gewesen, und am Ende dafür gut belohnt worden sei, denn ein Waldgeist habe ihn auf der Jagd nach einem einsamen, schönen Tale geführt, wo ihm ein in der Bergschlucht aufbewahrter Schatz und die Hand des reizenden und tugendsamen Fräuleins von dem Schlosse Schwann, das hier an einem von Schwänen besegelten Teiche stand, zu Teil geworden wären. In meiner Bearbeitung dieser Sage habe ich die Vermutung geäußert, das vielleicht unter jener Gegend das wahrhaft arkadische, mit Felsenhöhen, Wald und Wiesen geschmückte, Gossersweiler Tal gemeint, und der Ort Schwanheim nach dem gedachten Schlosse benannt sei. Seitwärts von Sülz erscheint das Dorf Münchweiler (212 Einwohner), vorher Zweibrückisch unter französischer Hoheit.
An der südlichsten Spitze des Kantons liegt das Dorf Vorderweidenthal, am Schlettenbach, mit 612, meist protestantischen. Einwohnern, deren Pfarrer zugleich Schulinspektor ist. Seine Gemarkung umschließt den Hof Lindenborn und eine Sägemühle. Dieses und die benachbarten Dörfer Darstein, 142, Dimbach, 202, und Oberschlettenbach, 232 Einwohner zählend, waren ehemals Fürstlich Leiningisch. Nahe bei Vorderweidenthal, in einer Hochebene, ragt ein wilder Berg von Pyramidischer Form in die Luft empor, dessen Gipfel mit überhängenden Felsmassen gekrönt ist. Auf diesen erblickt man noch die Ruine der Burg Lindelborn, welche ursprünglich Lindelboln (Lindenberg) hieß. Sie war eine Reichsfeste, mit der 1274 Kaiser Rudolph von Habsburg die Grafen Emich und Friedrich von Leiningen belehnte. Nachmals kam die Hälfte desselben und der mit ihr verbundenen Herrschaft an das gräfliche Haus von Zweibrücken Bitsch. Nach Abgang dieser Linien erhielt Leiningen wieder das Ganze, und das Amt, zu welchem die erwähnten Orte gehörten, ward nach der Feste Lindelborn genannt. Die Burg selbst aber war schon im Jahre 1523 durch die aufrührerischen Bauern erobert und verbrannt worden.
Uns wieder nordwärts richtend, betreten wir noch Waldhambach (422 Einwohner) östlich von Gossersweiler, am Kaiserbache und hinter den Bergen liegend, auf denen sich das Schloss Madenburg erhebt, und wandern dann über Waldrohrbach (277 Einwohner ) und Weruersberg (578 Einwohner), dessen Talgründe von dem Ebersbach und dem Riundach, der eine Waldmühle treibt, durchströmt werden, gegen Westen nach Spirkelbach und Rausckelbach fort. Beide Dörfer liegen einander gegenüber, an dem Brandsbache. der ein Seitentälchen des Queichtales durchrauscht und aus dem so genannten Pirmannsbrunnen entspringt. Sie kommen schon in Urkunden des 8 und 9 Jahrhunderts vor, und bilden dermalen eine Gemeinde von etwa 390 Seelen Waldhambach und Waldrohrbach gehörten ehemals zu dem Bistum Speyer, Wernersberg und Nanschelbach zu Zweibrücken, und Spirkelbach zu der zwischen Zweibrücken und Leiningen gemeinschaftlich gewesenen Herrschaft Falkenburg. Von hier nehmen wir auf der durch das Gebirge führenden Straße unseren Weg nach Sarnstal, und von da wieder über Annweiler zurück.