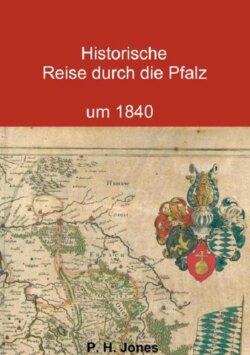Читать книгу Historische Reise durch die Pfalz um 1840 - P. H. Jones - Страница 8
Land Kommissariat Bergzabern Kanton Landau
ОглавлениеDie Kantone, von welchen dieser begrenzt wird, sind nach Süden Bergzabern, nach Westen Annweiler, ostwärts Germersheim und ein Teil von Kandel, und nordwärts Edenkoben. Die gewöhnlichen Wege, so uns den zwei ersten nach dem Hauptorte Landau führen, sind schon bei denselben angezeigt. Geben wir daher zuerst eine Schilderung dieser merkwürdigen Stadt und Festung, und wenden uns dann nach den übrigen Teilen des Kantons.
Landau liegt unterm 49° 13' 10" der Breite, und 25° 54' 7" der Länge, in einer reizenden Gegend, unweit des Vogesischen Gebirges. Die Landschaft bildet eine fruchtbare Ebene zwischen zwei sanften Hügeln, so von der Queich durchflossen wird. Dieser starke Bach, an dessen beiden Ufern die Stadt gebaut ist, vereint sich wieder, wie bereits oben erwähnt, nahe vor derselben mit dem von Albersweiler hergeleiteten Kanale, teilt sich noch einige Mal in seinem ferneren Lauf, und fällt dann bei Germersheim in den Rhein. Jener Kanal ist als solcher von keiner Bedeutung mehr, und wird nur noch zum Treiben einiger Mühlen gebraucht. Die Entfernung Landaus von Straßburg betrügt 18, von Speyer 6, und von Mainz 20 Stunden. Hierdurch führt die, zum Teil am Gebirge hin ziehende, Straße von Mainz nach Straßburg, sowie die bereits angeführte, durch das Annweiler Tal nach Zweibrücken.
Den Namen der Stadt wollen Einige von Lando, einem Alemannen, der den Ort erbaut haben, oder doch einer seiner ersten Besitzer gewesen sein soll, ableiten. Auch erwähnt man aus der frühern Ritterzeit ein Geschlecht der Edlen von Landau. Doch lässt sich vermuten, das, nach der Lage dieser Stadt, Landes Aue, der wahre Grund ihrer Benennung sei, wie denn auch der alte Hübner in seinem Zeitungs Lexicon die Gegeni eine schone Aue nennt. Die älteste Urkunde, welche ausdrückliche Nachricht von Landau enthält, ist vom Jahr 1268. Es stand anfänglich unter der Herrschaft der Grafen Leiningen, welche sehr ansehnliche Besitzungen im Speyergau und Elsass hatten. Nach dem Ableben des Grafen Emich und seines Sohnes (1289) Fielen ihre Lehne dem Reiche anheim. Unter diesen befand sich auch Landau, welches nun von Kaiser Rudolph von Habsburg und dann von dessen Nachfolger Albrecht mit Stadtrechten and verschiedenen Freiheiten begabt ward. Im vierzehnten Jahrhundert erscheint es unter der Zahl der freien Reichsstädte. In dem Streite, der zwischen Ludwig IV (dem Bayern) und Friedrich von Österreich wegen der Kaiserwürde entstand, trat Landau auf die Seite des Letztern. Aber nach dem Siege bei Mühldorf, wodurch Ludwig die Oberhand behielt und sogar seinen Gegner gefangen bekam, ließ er die Stadt ihre feindliche Gesinnung entgelten, denn er verpfändete sie 1319 erst an die Stadt und nachher an das Hochstift Speyer um 6000 Pfund Heller (11000 Gulden), wovon sie erst Kaiser Maximilian I im Jahr 1511 wieder befreite. Dieser Fürst erklärte Landau zu einer Reichsstadt des Elsasses. Sehr merkwürdig war die 1522 in ihren Mauern gehaltene Versammlung des rheinischen Adels, der einen Bund zur Unterstützung der Reformatoren und der Geistesfreiheit Schloss. Der heldenmutige Ritter Franz von Sickingen ward zum obersten Hauptmann desselben erwählt. Auch gehörte der Rat und die Bürgerschaft von Landau unter die ersten auf dem linken Rheinufer, welche sich zu Luthers Lehre bekannten. Die Gegend war damals schon in blühendem Zustande und sehr bevölkert, denn man zählte hier im Umkreise von 4 Stunden, 350 Flecken, Dörfer und Weiler. Auch wenn die Stadt nach alter Art ziemlich gut befestigt, und durch Ringmauern und Gräben gegen einen ersten Anfall geschützt. Doch erlitt sie, wie das umliegende Land in den unruhigen Zeiten, die jetzt folgten, manche Bedrängnis. Dahin gehört der Überfall, welcher durch den streitbaren Fürsten Albrecht von Brandenburg, Markgrafen zu Bayreuth, genannt Alcibiades, im Jahr 1552 geschah. Noch größeres Unglück erfuhr Landau im 30jährigen Kriege, wo es von den gegenseitigen Heeren siebenmal erobert ward. Durch den westphälischen Frieden wurde zwar den 10 Reichsstädten im Elsass die fortwährende Reichsunmittelbarkeit zugesichert, doch hielten die Franzosen noch drei Jahre nach demselben Landau besetzt. Als der zwischen Frankreich und Holland ausgebrochene Krieg durch den Frieden zu Nimwegen (1680) beendigt ward, verlor das Letztere keine seiner Besitzungen. Desto mehr jedoch seine Alliierten, namentlich Spanien, aber auch der Kaiser und das deutsche Reich. Denn Ludwig XIV wusste die Reichsritterschaft im Elsass, und jene 10 Städte, somit auch Landau, durch List und Gewalt der französischen Herrschaft zu unterwerfen. Jetzt wurde Landau, nach Bauban's kunstreichem Plan und neuen Systeme, stark und regelmäßig befestigt. Im Jahr 1689 legte eine Feuersbrunst den größten Teil der Stadt in Asche. Doch bald ward sie schöner und symmetrischer wieder aufgebaut. Durch den Ryswikischen Frieden, der (1697) den unseligen Krieg beschloss, erhielt Frankreich die Stadt Straßburg und die Herrschaft über Alles im Elsasse, was ihm noch nicht durch den westphälischen zugesprochen war. Demnach ward es auch im Besitze der Stadt und Festung Landau bestätigt. Doch behielt sie ihre eigene Verfassung, nur wurden in den Rat auch katholische Mitglieder aufgenommen und demselben ein königlicher Prätor vorgesetzt. Der spanische Successionskrieg brachte neue Drangsale über Landau. Es ward 1702 von der Kaiserlichen und Reichsarme, dann 1703 wieder von den Franzosen, und 1704 abermals von den Kaiserlichen und Alliierten, erobert. Jetzt kam es wieder unter die Zahl der Reichsstädte, und hatte von 1706 bis 1713, in der Person seines Bürgermeisters Schattemann, Sitz und Stimme bei dem Reichstage zu Regensburg. Aber im letzten Jahre nahmen die Franzosen, nach einer zweimonatlichen Belagerung, die Stadt wieder ein, und sie ward ihnen im Rastadter Frieden von 1714 definitiv überlassen. Auch jetzt blieb ihre alte städtische Verfassung und dauerte bis zur französischen Revolution, wo das ganze Land eine gleichförmige Einrichtung erhielt und nach gleichen Gesetzen regiert wurde. Obschon zum Unter Elsass gerechnet, war doch die Stadt nebst ihrem Gebiete von Kurpfälzischem Land umgeben. Während des Revolutionskriegs bestand Landau (1793) eine neunmonatliche Belagerung, und ward vier Tage lang von den Preußen heftig, jedoch vergebens, bombardiert, im 28. Dezember aber durch die französische Armee wieder entsetzt. Eine fürchterliche, den 20. Dezember 1794, am Zeughause erfolgte, Pulverexplosion richtete große Verheerung in einem Teile der Stadt an, und auch mehrere Menschen kamen dabei um. Nach dem Rheinübergange der Alliierten im Jahr 1814 schlossen die Russen drei Monate lang die Festung ein, doch blieb sie, vermöge des Pariser Friedens vom 30. Mai, bei Frankreich. Aber Napoleons Niederlage bei Waterloo änderte ihr Schicksal. Denn durch den zweiten Pariser Frieden ward diese Stadt, so wie das Land zwischen der Queich und Lauter, von Frankreich getrennt, und Fiel an Deutschland, worauf die Krone Bayern sämtliches im Jahr 1816 erhielt. Es ist schon anderswo sehr richtig bemerkt worden, das die Bürger Landaus noch jetzt eine gewisse altreichsstädtische Kraft und Tüchtigkeit auszeichnet. Beweise davon gaben sie vorzüglich in der Belagerung ihrer Stadt vom Jahr 1793, und zeigten namentlich während des preußischen Bombardements einen unerschütterlichen Mut und rastlose Tätigkeit. Sie erwarben sich dadurch ein solches Vertrauen, das ihnen die Regierung im Jahr 1796, als Moreau das französische Heer über den Rhein führte, die Verteidigung dieser so wichtigen Festung (damals der Schlüssel des Reichs von dieser Seite), gegen einen allenfalligen Angriff, der nach diesseits stehenden feindlichen Truppenschar, fast ganz allein überließ. Nicht weniger Eifer und Entschlossenheit haben die Landauer in den Blockaden 1814 und 1815 bewährt.
Der ganze Bau der Festung ist ein Meisterstück Bauban's. Sie hat die Form eines Achtecks, worin acht regelmäßige Bastionen und eben so viele Ravelins enthalten sind. Durch mehre Vorwerke gelangt man zu den beiden Haupttoren der Stadt. Die Gräben empfangen ihr Wasser durch die Queich, über welche acht kleine Brücken führen, wovon aber nur drei aus Steinen erbaut sind. Die Stadt, deren Umfang eine Stunde beträgt, zählt etwa 650 Häuser, l300 Feuerstellen und an 7000 Einwohner ohne die starke Garnison, welche gewöhnlich aus mehreren Infanterieregimentern und einigen Abteilungen Kavallerie und Artillerie Besteht. Ihre Fläche wird auf 634, mit Einschluss des Bannes und der Festungswerk aber auf 370O Morgen geschätzt. Die Straßen und Gassen, deren man 50 zählt, sind zum Teil gerade und von freundlichem Ansehen, zum Teil auch enge und unregelmäßig gebaut. Landau hat sieben freie Plätze, unter welchen sich der schöne, mit einer Akazienallee umschlossene, Paradeplatz auszeichnet. Auch find man hier mehrere hübsche, sowohl öffentliche als Privat Gebäude. Unter jenen bemerken wir: Die große, den Evangelischen und Katholiken gemeinschaftliche, Stadt und ehemalige Stiftungskirche. Den stattlichen Turm derselben umläuft eine Gallerte, von der man die weiteste Aussicht auf die herrliche, ringsum liegende Gegend hat. Das ehemalige Augustiner Kloster, mit der dabei stehenden Kirche. Das schöne Kommandantschafts Gebäude. Das Stadt oder Gemeindehaus. Das Bezirksgerichtshaus. Die zwei wohlgebauten und gut eingerichteten Civil und Militär Hospitäler. Zudem befinden sich im Gebiete der Stadt fünf Kasernen (worunter eine für die Kavallerie), zwei Zeughäuser und drei Pulvermagazine.
Landau ist der Sitz des Bezirksgerichts für die Landkommissariate Bergzabern, Landau und Germersheim, eines Landkommissariats, eines Friedensgerichts, einer Domänen Juspection, eines Militär Brigadecommando's, eines Hypotheken und Rentamts, einer Bezirkskasse, eines Kantons Physikats und einer Postverwaltung. Zudem sind hier drei Notäre, ein Steuerkontroleur, eine Gendarmeriestation, ein Bezirksingenieur, ein Baucunducteur, ein Tierarzt, ein Bezirksgefängnis, eine Verisication für Maß und Gewicht etc.. Die städtische Verwaltung und Polizei wird von dem Bürgermeister, zwei Adjunkten, dem Stadtrat und Polizeikommissar geleitet. Für die evangelische Kirche sind zwei Pfarrer, wovon der eine zugleich Schulinspektor ist, für die katholische ein Pfarrer mit zwei Kaplanen angestellt. Was Bildungsanstalten betrifft, so bestehen hier eine lateinische Schule, der ein Subrektor und fünf andere Lehrer vorgesetzt sind, ein Privatinstitut für junge Frauenzimmer und verschiedene Bürgerschulen. Auch hat Landau eine Buchhandlung, zwei Buch und eine Steindruckerei, einige Leihbibliotheken, und ein Casino für Lektüre und gesellige Unterhaltung, welche letztere durch das neuerrichtete Theater noch mehr gewinnt. Es erscheint hier ein Wochen oder Lokal Anzeigenblatt. Als vortreffliche Wohltätigkeitsanstalt ist das Hospital zu betrachten, welches ein Vermögen von 194,000 Fl. besitzt. Auch Besteht hier die sehr lobenswerte Kleinkinder Verwahranstalt, welche ein Ausschuss des Frauenvereins leitet. Während der französischen Verfassung war diese Stadt durch ihre Lage in einer gesegneten Landschaft und durch mancherlei Verkehr, zu dessen Förderung eine zahlreiche Garnison noch vieles beitrug, stets in besonderem Wohlstande, welcher durch die Stürme der Revolution und das Ungemach des Krieges einige Mal unterbrochen ward, aber sich immer von neuem erhob. Ihn gewahrt man auch unter der königlich bayerischen Regierung, deren Milde und Weisheit dieser neuerworbenen Grenzstadt ein fortwährendes Gedeihen verspricht. Die Einwohner nähren sich von Landbau, Handel und mancherlei Gewerben. Seit mehreren Jahren hat man auch hier sehr bedeutende Bierbrauereien und Essigsiederein errichtet. Zudem hat Landau sehr reichliche Frucht und Wochenmärkte, welche oft die Bewohner von 150 Dörfern besuchen. Vorzügliche Gasthöfe sind das goldene Schaf und der Schwan. Zum Gebiete der Stadt gehören noch die in ihrem Banne liegenden 3 Ziegelhütten, die Hospitalmühle und eine Hammerschmiede, so wie 6 bewohnte Gartenhäuser, wie sich denn mehrere, und darunter einige recht schön angelegte, Gärten bei ihr finden. Auch ist in der Nähe eine Heilquelle, der Schwefelbrunnen genannt. Ein unweit Landau liegendes Haidenfeld, der so genannte Horst, ist zum Teil angebaut.
Außer den bereits erwähnten Landstraßen führt von hier eine nach Germersheim, eine andere nach Speyer. Auch die neue Schiffbrücke bei Knielingen bringt die Straße von Karlsruhe über Landau, Annweiler, Pirmasens, Zweibrücken, Blieskastel, Saargemünde nach Metz mit der Kaiserstraße in gleichen Rang. Sie ist die die billigste und direkteste Reiseroute nach Paris und von da nach Baden, Württemberg, Bayern und Österreich. Täglicher Eilwagen Kurs. An der ersten liegt Queichheim (735 Einwohner). Nur eine starke Viertelstunde von dem Hauptorte entfernt, weshalb es auch die Franzosen le petit Landau (Klein Landau) nannten. An der zweiten Dammheim (385 Einwohner), und nordwestlich davon das beträchtliche, in der Kriegsgeschichte neuerer Zeit oft genannte, Nußdorf (1370 Einwohner), wo starke Verschanzungen waren. Diese drei Dörfer standen ehemals unter der städtischen Hoheit von Landau. Weiterhin am Gebirge erscheint Frankweiler, ein ansehnliches, etwa 925 Seelen starkes. Dorf, von welchem in der oben gedachten, zum Teil fabelhaften, Beschreibung des Königreichs Austrasien oder Klein Frankreich gemeldet wird, das es die Franken erbaut, die Normannen bei ihrem Streifzuge in diese Gegenden zerstört, die Kaiser aber späterhin der alten Burg Trifels einverleibt und den Rittern von Scharfeneck zu Lehen gegeben hätten. Mit Gewissheit ist bekannt, das dieser Ort, samt der vom Reiche verpfändeten Feste Trifels, geriet an Kurpfalz, sodann, durch die Teilung von 1410, an Pfalz Zweibrücken kam, bis er 1769 durch Austausch wieder mit jener vereint wurde. Auf dem weiteren Wege durch den Kanton Landau nach Germersheim liegt seitwärts Merlenheim oder Mörlheim (470 Einwohner), ehedem kurpfälzisch, von welchem sich, wie gemeldet, der erste Stifter des Klosters Eußertal nannte, nebst zwei Mühlen an der Queich, die ehemals zu dieser Abtei gehörten. Sodann folgt Offenbach, ein großer Ort von 1545 Einwohnern, ebenfalls an der Queich, die hier einige Abflüsse hat, deren einer drei Mühlen treibt. Ursprünglich gehörte Offenbach dem Stifte Klingenmünster, und kam nach verschiedenen Wechseln an Kurpfalz. Auf der Straße nach Speyer gelangen wir noch zu den Dörfern Bornheim, 635, und Oberhochstadt, 620 Seelen stark, am linken Ufer des Flüßchens, beide ehedem kurpfälzisch. Ganz nahe bei letzterem liegt Niederhochstadt mit mehr denn 1140 Einwohnern, das als pfälzisches Lehen dem Johanniterorden gehörte. Es scheint nach Urkunden des achten und elften Jahrhunderts, mit ersterem in der Vorzeit ein Ort gewesen zu sein. Beide Wege eröffnen den Prospekt auf die schöne und reiche Ebene, welche die Queich durchströmt, einen der angebautesten und bevölkertstem Striche des ganzen diesseitigen Rheinlandes.
Westlich von Landau kommt man auf dem bereits gemeldeten Wege, der nach Annweiler führt, in das so genannte Siebeldinger Tal, welches drei Ortschaften, Godramstein, Birkweiler, und Siebeldingen enthält. Dieses Tälchen ist historisch merkwürdig. Es war ehedem ein unmittelbares Eigentum des Reichs, welches Kaiser Rudolph von Habsburg in seinen besonderen Schutz nahm und ihm sogar die Freiheiten der Stadt Speyer verlieh. Aber im vierzehnten Jahrhundert ward es mit andern Reichsdörfern an den Grafen von Leiningen verpfändet, von welchem es Pfalzgraf Ruprecht I im Jahr 1361 einlöste, wodurch dieser Landbezirk an Kurpfalz kam. Noch in neueren Zeiten bestand hier ein eigenes Talgericht, welches nach altdeutschem Herkommen, drei bis viermal des Jahrs seine ordentlichen Sitzungen in dem Hauptorte Godramstein halten musste. Es führte in seinem besondern Siegel den doppelten Reichsadler. Das große, über 1300 Seelen starke, Dorf Godramstein liegt nahe bei Landau, und ist unstreitig sehr alt. Weil man an der aus grauer Zeit herrührenden Kirche sechs Steine fand, worauf die Bilder der Gottheiten Merkur, Herkules, Juno und Minerva ausgehauen waren, so führte dies Einige auf die Vermutung, das der Name des Ortes so viel als Götter am Stein bedeuten möchte. Eine andere Sage meldet, das unter König Dagobert I im Jahr 610, ein Stadthalter in Austrasien, Namens Godram, Herr zu Lauterburg, in einem reizenden Lustwald des Wasgaues, am Bache Quaiata (Queich) eine Burg nebst Kirche gebaut und nach sich benannt habe, woraus endlich dieses Dorf entstanden sei. Geschichtliche Nachrichten über seinen Ursprung kennt man nicht. In einer Urkunde des Klosters Lorsch von 767 wird es Godmarstaine, in einer späteren Contemaristeine, sodann Goderamistein genannt. Die Abtei Hornbach bei Zweibrücken, welche von Kaiser Ludwig dem Kinde im Jahr 900 mit einigen Höfen an diesem Orte beschenkt war, hatte in der Folge eine Probstei hier angelegt. Diese ward nach der Reformation von Pfalz Zweibrücken in eine Hellnerei verwandelt, und kam 1769 durch Austausch an Kurpfalz. Auf der südlichen Seite des Ortes fließt die Queich vorbei, und treibt eine Öl und Mahlmühle. Dorthin zieht auch der erwähnte Landauer Kanal. Die Talgerichte oder Dingtage wurden ehedem unter freiem Himmel gehalten. Als dies nachher in dem Orte geschah, ward der Dingplatz, auch Stalbohel genannt, so an der nordwestlichen Grenze der Gemarkung, gegen Frankenweiler hin, auf einer Höhe liegt, mit Wald und Gebüschen bepflanzt, dermalen ist er größtenteils in Weingärten verwandelt. Auf dem gegenüber stehenden, etwas höheren Assolterberge soll vor Zeiten der peinliche Gerichtsplatz gewesen sein. Der im Umfange des Bannes von Siebeldingen liegende Geilweiler Huf war im zwölften Jahrhundert ein Dorf, Geilrewilre genannt. Durch die oben gedachte Grundbereicherung und luxuriöse Wirtschaft der Mönche in Eußertal sank es, wie andere, zu einem Hofgute herab. Die Kunde spricht von einem unterirdischen Gange, der von hier nach jenem zwei Stunden entfernten Kloster führen soll. Ist dies auch unrichtig, so fand man doch Spuren eines solchen Ganges, der den gegenwärtigen Ort einst mit St. Johann bei Albersweiler verband. Auch sollen hiervon manche schauerliche Geschichten erzählt werden. Siebeldingen ist nach Godramstein das Feste Dorf des Tals, und zählt über 930 Einwohner. Die Queich treibt hier die zwei so genannten Kindinger Mühlen. Gegenüber, an der rechten Seite des Baches und an jenem Kanal, liegt das Dorf Birkweiler 485 Einwohner), das von der in der Gegend häusig wachsenden Birken benannt sein soll. Zwischen ihm und Siebeldingen stand ehemals der Weiler Kolchenbach, der als vierter Ort zum Tale gerechnet wurde. Aber er ging in den französischen Kriegen des siebenzehnten Jahrhunderts ein, und seine Gemarkung ward mit der von Birkweiler vereinigt. An seine Stelle kam Gleisweiler, jetzt im Kanton Edenkoben, in den Bereich des Talamtes das durch Birkweiler fließende, bei Siebeldingen in die Queich fallende, Wasser wird noch Kolchenbächlein genannt. Auch hier befindet sich eine Mahl und Ölmühle. Die drei Ortschaften sind, nebst mehreren, in die Waldungen der obern Haingeraide berechtigt.
Von hier nach dem Saume des Gebirges hin südwärts wandernd, kommen wir nach dem Dorfe Eschbach (385 Einwohner), durch welches, wie oben erwähnt, eine Straße von Bergzabern nach Landau führt. Über demselben, auf einer steilen Höhe, prangt die herrliche Ruine der Madenburg (Magdenburg), auch Eschbacher Schloss genannt. Von dem 1,5 Stunden entlegenen Trifels geht ein Fußweg zu derselben durch wildes Gehölz über die Berge, wo sich hier und da ein Blick auf lichte Fels und Waldstellen eröffnet. Eine etwas schroffe, aber doch gut zu ersteigende Bahn führt von Eschbach hinauf. Der Gipfel, auf dem die Ruine steht, ist ein Vorsprung des Rodenbergs, so vermittelt der übrigen Höhen mit dem Trifels zusammenhängt. Unstreitig gehört dieses Schloss zu den ältesten am Oberrhein. In Urkunden erscheint 1107 ein Madelberg unter den Dynasten des Landes, und um 1150 eine Gräfin Ida von Maddenberg, deren Sohn Herrmann Domherr in Speyer war. Nach Erlöschung dieses Geschlechtes muss die Feste an das gräflich Leiningische Haus gekommen sein denn Crollius meldet Folgendes: Graf Friedrich von Leiningen, der auch von 1299 bis 130l Landvogt im Speyergau war, besaß diese Burg, die dann seinem älteren Sohn und dessen Nachkommen anheim Fiel. Der letzte Sprössling dieser Linie, Landgraf Hesso, veräußerte sie in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts an Friedrich von Fleckenstein, der sich nun auch Herr zu Madenburg nannte, und Johann von Sickingen. Darauf kam das Schloss an ihre Söhne, und nach diesen an die Edlen von Haideck und Landeck, von welchen Letztern es Herzog Ulrich von Württemberg im Jahr 1525 erkaufte. Aber fünf Jahre später überließ er dasselbe dem Bischof von Speyer, wo denn auch die umliegenden, davon abhängigen Dörfer Arzheim, Eschdach, Ranschbach, Waldhambach und Rohrbach dem Hochstifte zu Teil wurden. Was nun die weitere Geschichte der Madenburg betrifft, so hatte sie schon im Bauernkriege einige starke Anfälle und Beschädigungen erfahren. Doch stellte sie der Bischof wieder her. Aber im 30jährigen Kriege ward dieses Schloss von dem tapfern Grafen von Mansfeld (l622) heftig beschossen, und 1634 von den Franzosen, zu gleicher Zeit mit der Stadt Landau, erobert. Der Westphälische Friede gab es zwar dem Hochstifte zurück, allein der Orleansche Successionskrieg brachte ihm das letzte Verderben denn es wurde 1680, auf Befehl des französischen Commandanten Monclair, gänzlich zerstört. Die Reste dieser stolzen Burg sind nun Privateigentum. Noch haben sich, trotz der Verheerung, einige Türme, festes Gemäuer, Terrassen, Überbleibsel von Treppen und anderem Bau, erhalten. Alles gewährt noch in seinen Trümmern ein Bild der ehemaligen Pracht und Größe des uralten Schlosses. Seine Lage und die über alle andern emporragende Berghöhe, auf der es steht, eröffnet eine so weite, reiche und mannichfaltige Aussicht, als man sie auf irgend einem Punkte dieser Art finden kann. Denn von der Terrasse überblickt der Wanderer nach Osten hin die ganze, mit fruchtbaren Feldern, Waldungen und Anen geschmückte, Gegend von Straßburg bis nach Mainz herab, welche der silberne Rhein in seinen Windungen durchströmt. Ganz fern gewahren wir das dunkele Schwarzwälder Gebirge, an welches sich die Bergkette des Odenwaldes, mit dem aufsteigenden Melibocus, anschließt, von den Höhen des Taunus nördlich begrenzt. Wendet man sich nach Westen, so erscheint ein mit dieser umfassenden und prachtvollen Naturseen contrastirendes, aber in seiner Art eben so anziehendes, Gemälde. Man erblickt hier die wilde Landschaft der Vogesen, wo anmutige Wiesentäler mit klaren Bächen durch das Gebirge ziehen, groteske Felsmassen und schauerlichen Wald und die grauen Bergtrümmer, unter welchen sich stolz der Trifels auf seinem kegelförmigen Gipfel erhebt. Unweit der Madenburg, nordwärts, auf einer Vorhöhe des Gebirges, steht die Ruine der Feste Neukastel, welche Schöpflin in seiner Alsatia illustrata für ein ursprünglich römisches Kastell erklärt. Aus Urkunden weiß man, dass Sie im Mittelalter ein Eigentum der Salischen und Hohenstaufischen Kaiser war, deren Burgmänner sich von ihr benannten. Nach Abgang des letztern Hauses ward das Schloss Neukastel eine Reichsfeste, kam aber 1330 vermöge der schon oft erwähnten Verpfändung mehrerer Städte, Burgen und Dörfer, an die Pfalzgrafen, worauf es durch Familienvertrag an Zweibrücken fiel. Diese Burg diente lange Zeit als Wohnsitz appanagirter Prinzen, ward aber 1680 von den Franzosen, unter Monclair, geschleift. Ein zum Oberamte Bergzabern gehöriges Zweibrücker Unteramt hatte davon seinen Namen. Dermalen befindet sich hier eine schöne landwirtschaftliche Einrichtung. In der Nähe beider Schlösser liegen der 1174 Seelen starke Flecken Arzheim und das Dorf Ranschbach (390 Einwohner), ehemals Bischöflich Speyerisch, dann Leinsweiler, 465, Ilbesheim, 990, und weiter gen Osten Wolmersheim, am Flurbache, 746 Einwohner darr. Die zwei ersteren vordem zu Zweibrücken, letzteres zu Kurpfalz gehörig. Die Kirche von St. Moriz in Wolmersheim ist wegen ihres Altertums merkwürdig, da sie, nach der lateinischen Inschrift eines zwischen dem Langhaus und Chor eingemauerten Steins, im Jahr 1040 durch den Bischof Sigibodo von Speyer erbaut ward.
Wandert man von hier südwärts durch die Ebene des Kantons, so kommt man zuerst nach Mörzheim (865 Einwohner), mit reichen Feldern und Weinbergen, sodann nach Göcklingen (1520 Einwohner), am Klingenbache, mit einer Mühle, und nimmt darauf seinen Weg östlich über Impflingen (670 Einwohner), an der Poststraße von Landau liegend, nach Herxheim, einem großen, ehedem Speyerischen Marktflecken, wo das schöne Gemeinde und Schulhaus bemerkenswert ist. Hier hatte Pichegrü, als er sich im November 1795 nach dem Verluste der Linien an die Queich zog, sein Hauptquartier. Der hiesige katholische Pfarrer ist auch Schulinspektor. Zum Ort gehört eine Öl und Mahlmühle, am Klingenbache. Nördlich davon liegt das Dorf Herrheim Weyer, 450, und südwestlich Insheim, 995 Einwohner stark, am Quatbach und dem von Lauterburg nach Landau ziehenden Wege. Ersteres war vor dem Speyerisch, letzteres, so wie Mörzheim, Eicklingen und Impflingen, Kurpfälzisch.
Wir kehren nach Landau zurück. Schon zeigt sich hier das nahe Vogesische Gebirge, mit den ehrwürdigen Burgruinen, die von seinen waldreichen Höhen in die Gefilde herabschauen, wo denn besonders der herrliche Trifels den Blick des Wanderers auf sich zieht. Auch ist kein Zweifel, dass, wie ich schon in einer früheren Schilderung bemerkte, in diesen Gegenden so sehr als irgendwo das wahre Leben und Treiben der alten Ritterzeit war. Indem man von hier seinen Weg nordwärts verfolgt, erscheint jenes Gebirge in anderer Gestaltung, da es südwestlich nach dem Elsass hin, sich in einzelnen grotesken Massen erhebt, jetzt aber mehr als eine zusammenhängende Bergkette sich darstellt. Im Kanton Landau bemerken wir noch rechts in der fruchtbaren Ebene den reichen, ehemals Freiherrlich Dalbergischen, Flecken Essingen (1460 Einwohner), der an dem eine Mühletreibenden Haimbache liegt, und dessen Almosen ein Vermögen von 8800 fl. besitzt, und am Fuße des Gebirges, neben diesem, in der mittleren Haingeraide entspringenden, Bache, das Dorf Walsheim (630 Einwohner), schon in den Lorscher Urkunden des achten Jahrhunderts genannt. Noch sei bemerkt, das die im Kanton Landau befindlichen Walddistrikte, nach ihren verschiedenen Lagen, unter den Forstämtern von Annweiler, Neustadt und Langenberg stehen.