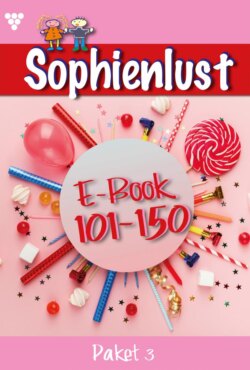Читать книгу Sophienlust Paket 3 – Familienroman - Patricia Vandenberg - Страница 18
Оглавление»Warum weinen Sie denn?« Pünktchen war rein zufällig an dem kleinen Raum vorbeigekommen, in dem Besen, Schrubber und Bohnermaschine verwahrt wurden. Sie hatte im Musikzimmer ihre Federtasche vergessen und war rasch über die Seitentreppe der Schule gelaufen, weil sie damit den Weg abkürzte. Dabei hatte sie die weinende Maria Cortez entdeckt. Sämtliche Schüler des Gymnasiums in Maibach hatten die hübsche und sonst immer fröhliche Spanierin mit den dunklen Augen gern. Deshalb war Pünktchen auch ganz entsetzt, sie in Tränen zu finden.
»Ich weiß nicht, was ich machen soll, Angelina.«
Pünktchen hieß mit vollem Namen Angelina Dommin. Aber es gab nur wenige Leute, die sie so nannten. Maria Cortez tat es, weil ihr der Name Angelina gut gefiel. Außerdem konnte sie als Spanierin das Wort Pünktchen nicht gut aussprechen, obwohl sie die deutsche Sprache schon recht gut beherrschte.
»Ist etwas passiert?«, erkundigte sich Pünktchen mitleidig. »Sind Sie etwa krank?«
»Ich nicht, aber mein Mann.« Maria Cortez, die mit ihrem Mann auf der Suche nach Arbeit aus Spanien nach Deutschland gekommen war, sah verzweifelt aus.
»Dann muss er ins Krankenhaus«, erklärte Pünktchen resolut. »Es nützt bestimmt nichts, wenn Sie hier herumsitzen und weinen.«
»Er liegt ja im Krankenhaus. Aber in Barcelona.«
»Ach so, und jetzt möchten Sie schnell hinfahren und haben kein Geld? Wir könnten für Sie sammeln, Frau Cortez.«
»Nein, Angelina, am Geld liegt es nicht. Dafür haben wir genug auf dem Sparbuch. Es ist wegen Manuela, unserer kleinen Tochter. Ich habe ein Telegramm bekommen, dass ich sofort abreisen soll, weil es sehr schlecht steht mit meinem Mann. Aber ich kann Manuela nicht allein lassen. Sie ist ja noch nicht einmal vier Jahre alt.« Maria Cortez schluchzte auf. Die Angst um ihren Mann und die Unmöglichkeit, zu ihm zu fahren, schüttelte sie.
Pünktchen, die ihren Namen den vielen lustigen Sommersprossen auf ihrer Nase verdankte, stemmte die Arme in die Hüften. »Aber, Frau Cortez, das ist doch gar kein Problem. Manuela kommt nach Sophienlust, und Sie reisen ab.«
Maria Cortez hörte vor Schreck auf zu weinen. »Sophienlust ist ein Schloss für feine reiche Kinder, Angelina. Meine Manuela ist ein armes Mädchen. Das geht nicht.«
Pünktchen schnaufte ein bisschen, denn sie war über so viel Unwissenheit regelrecht empört. »Denken Sie vielleicht, ich wäre ein feines reiches Kind?«, fragte sie. »Von der Straße hat Nick mich aufgelesen und nach Sophienlust gebracht. Wer Hilfe braucht oder in Not ist, kann immer zu Tante Isi kommen. Tante Isi ist Nicks Mutti. Warten Sie mal, ich hole Nick rasch. Wir haben ja noch Pause.«
Pünktchen trabte davon. Sie entdeckte Dominik von Schoenecker, einen lang aufgeschossenen Buben mit sehr dunklem Haar und ebensolchen Augen, im Gespräch mit Irmela, die gleichfalls ein Sophienluster Kind war. Temperamentvoll und mit sich überstürzenden Worten berichtete Pünktchen, in welcher Situation sich die nette Spanierin befand. Sofort schlossen sich Nick und Irmela ihr an.
»Sie glaubt nicht, dass Manuela bei uns bleiben kann«, seufzte Pünktchen. »Vielleicht kannst du es ihr klarmachen, Nick.«
Maria Cortez erschrak ein wenig, als nun gleich drei Kinder erschienen. Was Nick ihr erklärte, erschien ihr vollkommen unglaubhaft, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, dass der sympathische Junge so faustdick schwindeln sollte.
»Sophienlust gehört mir, Frau Cortez«, versicherte Nick. »Meine Urgroßmutter hat es mir vererbt. Es ist für Kinder bestimmt, die in Not sind. Auch Erwachsene werden in Sophienlust aufgenommen. Wer kein Geld hat, braucht nicht zu bezahlen, denn es gehört ein großes Vermögen und ein Landgut zu dem Haus. Wenn Sie wollen, rufen wir meine Mutti an. Es wäre am einfachsten, wenn wir Ihre kleine Manuela gleich im Schulbus mit nach Sophienlust nehmen würden.«
Maria Cortez war nicht so leicht zu überzeugen. »Ihr meint es gut und wollt mir helfen. Aber das geht nicht. Meine Manuela passt nicht in ein Schloss.«
Die Schulglocke, die die nächste Stunde ankündigte, machte der fruchtlosen Unterhaltung zunächst ein Ende. Und nach Schulschluss hielten Nick, Pünktchen und Irmela vergeblich nach Maria Cortez Ausschau. Die Putzfrau war nach Hause gegangen.
»So was Dummes«, ärgerte sich Nick.
»Wir wollen uns vom Hausmeister ihre Adresse geben lassen«, schlug die praktische Irmela vor. »Anrufen kann man sie wahrscheinlich nicht. Aber es muss ja etwas geschehen, damit sie zu ihrem Mann kann.«
»Sonnenklar, dass etwas geschehen muss«, bestätigte Pünktchen. »Ich spritze zum Hausmeister. Sagt dem Chauffeur Bescheid, damit er nicht ohne mich abfährt.«
Fünf Minuten später brauste der knallrote Schulbus mit der Aufschrift »Kinderheim Sophienlust« davon. Jeden Tag brachte er die größeren Kinder nach Maibach zum Gymnasium. Ein zweiter Bus transportierte die jüngeren Kinder zur Grundschule in Wildmoos.
Allzu lange dauerte die Fahrt nach Sophienlust nicht. Wer das schöne alte Herrenhaus zum ersten Mal erblickte, hatte tatsächlich den Eindruck, dass es sich um ein Schloss handeln müsse. Insofern waren die Vorstellungen der jungen Spanierin nicht verwunderlich.
Kaum hielt der Bus, stieg Nick auch schon aus und begab sich im Dauerlauf ins Haus. Er klopfte an die Tür des Zimmers, das als Büro diente, und seufzte erleichtert auf, als er Frau Rennert, die Heimleiterin, darin vorfand.
»Was gibt’s denn, Nick? Du bist ja ganz außer Atem.«
»Ich muss mit Mutti sprechen, Tante Ma. Da ist ein kleines Mädchen aus Spanien, das wir sofort nach Sophienlust holen müssen. Es ist sehr eilig.«
Frau Rennert, von den Kindern liebevoll Tante Ma genannt, war sofort bei der Sache. Ein Kinderschicksal war in diesem Hause immer wichtig.
»Deine Mutti ist in Schoeneich, Nick. Ihr sollt zum Essen nach Hause kommen. Ich glaube, es ist Besuch da.«
Nick schilderte in kurzen Worten, worum es ging. »Wir haben die Adresse gleich mitgebracht«, fügte er hinzu. »Das war Irmelas Idee.«
»Natürlich nehmen wir die kleine Manuela auf«, bestätigte Frau Rennert. »Die arme Frau tut mir leid. Wer weiß, was ihr noch alles bevorsteht. Sprich mit deiner Mutti darüber. Jemand muss am Nachmittag nach Maibach fahren, um mit Manuelas Mutter zu reden.«
»Wenn sie nicht so stur gewesen wäre, hätten wir die Kleine gleich im Schulbus mitgebracht«, äußerte Nick.
»Stur ist nicht das rechte Wort, Nick. Wahrscheinlich ist die arme Frau zu bescheiden.«
In der Halle ertönte der Gong, der die Kinder zum Essen rief. Frau Rennert, die am Schreibtisch gesessen hatte, stand auf. »Du wirst deiner Mutti ja gleich alles erzählen, Nick. Da brauche ich nicht erst zu telefonieren. Rufe Henrik und beeilt euch. Der Chauffeur weiß Bescheid.«
»Ja, Tante Ma.«
Draußen wartete der Wagen Denise von Schoeneckers. Leider gab es noch einen kurzen Aufenthalt, weil Nicks jüngerer Bruder Henrik erst nach längerem Suchen bei der Köchin Magda in der Küche gefunden wurde, wo er mit unschuldsvollem Gesicht Pudding naschte.
»Fresssack«, schimpfte Nick. »Los, wir haben’s eilig.«
Die Entfernung von Sophienlust nach Schoeneich, dem Wohnsitz der Familie von Schoenecker, war nur kurz. Auf einer schmalen gepflegten Privatstraße, die Nicks Großvater vor einigen Jahren hatte bauen lassen, erreichte man das andere Gut.
Eine Viertelstunde später saßen die beiden Jungen mit ihren Eltern am Esstisch. Der Besuch, von dem Frau Rennert gesprochen hatte, war kein anderer als Sascha von Schoenecker, der große Bruder, der bereits in Heidelberg studierte. Die Überraschung war gelungen. Nick und Henrik stimmten ein freudiges Indianergeheul an, als sie Sascha erblickten.
Dann aber kam Nick sofort auf Manuela zu sprechen.
»Schade«, meinte Alexander von Schoenecker mit gutmütigem Lächeln. »Nun werde ich dich heute Nachmittag wohl entbehren müssen, Isi.«
Denise von Schoenecker legte die Hand auf die ihres geliebten Mannes. »Ist es nicht unsere Pflicht zu helfen, Alexander? Stell dir vor, du und ich, wir wären getrennt, und einer von uns wäre schwerkrank …«
»Ich weiß, Isi. Wahrscheinlich hätten wir alle dich nicht so lieb, wenn du anders dächtest.«
*
Sascha bot sich als Fahrer an, was Denise gern annahm, obwohl sie ihren Wagen auch oft selbst steuerte.
»Da kannst du mir unterwegs von dir erzählen, Sascha«, meinte sie fröhlich. »Wir haben jetzt doch so wenig von dir.«
Sascha stammte aus der ersten Ehe Alexander von Schoeneckers. Doch das Verhältnis zwischen ihm und Denise war nicht anders als zwischen Mutter und Sohn. Mit Andrea, ihrer bereits verheirateten Stieftochter, fühlte sich Denise ebenfalls innig verbunden. Andererseits erblickte Dominik, Denises Sohn aus ihrer kurzen Ehe mit Dietmar von Wellentin, in Alexander von Schoenecker durchaus seinen Vater. Und Henrik, der blonde Benjamin der glücklichen Familie, bildete sozusagen das Bindeglied zwischen allen. Er war Alexander und Denise in ihrer von tiefer Liebe erfüllten Ehe geschenkt worden.
Sascha setzte sich ans Steuer und betrachtete seine schöne dunkelhaarige Mutter mit beinahe verliebtem Blick. »Du wirst immer jünger, Mutti. Wie machst du das nur? Dabei bist du von früh bis spät auf den Beinen und arbeitest mehr als manche Frauen, die von sich behaupten, dass sie berufstätig seien.«
»Mach mir keine Komplimente«, meinte Denise lachend. »Wahrscheinlich bleibt man auch äußerlich jung, wenn man sich ein junges Herz bewahrt. Erzähle mir lieber von Heidelberg.«
Sascha berichtete von seinem Studium, und Denise hörte aufmerksam zu. Sie hielten in einer schmalen Straße. Das Haus war altmodisch und nicht sonderlich gepflegt. An der Tür waren verschiedene Karten mit ausländischen Namen befestigt.
»Ich komme lieber mit«, beschloss Sascha. »Wer weiß, wie es da drinnen aussieht.«
Doch sie sollten angenehm überrascht werden. Auf ihr Klingeln öffnete ein Kind mit bildschönen kohlschwarzen Augen.
»Zu Frau Cortez wollen Sie?«, fragte es in tadellosem Deutsch. »Das ist ganz oben links.«
Das Treppenhaus war kahl, aber sauber. Oben klopften sie an eine Tür und betraten ein ziemlich kleines Zimmer, das mit viel Liebe und Sorgfalt eingerichtet war. Maria Cortez war eben dabei, einen Koffer zu packen. Der einzige Schrank im Zimmer stand offen. Denise stellte auf den ersten Blick fest, dass darin mustergültige Ordnung herrschte. Der einfache Fußboden des Zimmers, in dem nicht einmal ein Teppich lag, war spiegelblank.
Denise von Schoenecker hatte eine eigene Art, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen.
»Grüß Gott, Frau Cortez«, sagte sie herzlich. »Ich bin Nicks Mutter. Und das hier ist mein ältester Sohn Sascha. Wir sind hier, um Manuela nach Sophienlust einzuladen.«
»Dann hat Dominik es Ihnen also erzählt«, flüsterte die Spanierin. »Wollen Sie sich nicht setzen? Ich habe meine Bekannten hier im Haus gefragt, ob sie Manuela aufnehmen könnten. Aber es ist nicht möglich, weil sie alle arbeiten und nicht die Zeit haben, für ein fremdes Kind zu sorgen. Aber Manuela ist noch klein. Sie kann sich mittags nicht selbst etwas zu essen machen.« Maria Cortez seufzte.
»Es ist schlimm genug, dass Ihr Mann krank ist, Frau Cortez. Sie müssen selbstverständlich sofort abreisen. In Sophienlust ist genug Platz für Ihr Töchterchen. Wo steckt es denn?«
»Manuela spielt irgendwo im Haus oder draußen.«
»Uns hat ein Kind die Tür aufgemacht …«
»Das muss Manuela gewesen sein. Es ist alles so schwierig«, meinte Maria Cortez mutlos. »Wir wollten alle gemeinsam nach Spanien fahren, weil die Schwester meines Mannes heiratete. Mein Schwiegervater ist tot. Deshalb sollte wenigstens mein Mann da sein, um die Braut zum Altar zu führen. Aber zwei Tage vor der geplanten Abreise bekam Manuela eine böse Halsentzündung. Der Arzt sagte, die Reise sei zu anstrengend für das Kind. Deshalb bin ich hier geblieben. Und nun dieses Unglück. Mein Mann wollte in ein paar Tagen zurückkommen.« Sie wischte sich hastig eine Träne aus dem Augenwinkel. »Ich weiß nicht einmal, was ihm fehlt.«
Denise nickte ihr ermutigend zu. »Ihr Mann ist doch noch jung wie Sie, Frau Cortez. Wir wollen den Mut nicht sinken lassen.«
»Sie sprechen sehr gut deutsch«, wunderte sich Sascha.
»Wir sind schon seit fünf Jahren hier. Manuela ist hier geboren. In Spanien hatte mein Mann keine Arbeit. Hier können wir beide verdienen. Wenn wir genug gespart haben, gehen wir zurück und kaufen uns ein kleines Haus und ein Stück Land. Aber das dauert noch ein Weilchen.«
»Haben Sie genug Geld für die Reise?«, fragte Denise rasch. »Ich helfe Ihnen gern aus. Sophienlust verfügt über ein Konto für solche Zwecke.«
»Danke, Frau von Schoenecker. Wir haben unser Erspartes. Das Reisegeld war schon beiseite gelegt. Ich brauche nichts. Was kostet es, wenn Sie Manuela in Sophienlust aufnehmen?« Diese Frage klang ein wenig ängstlich, denn Maria Cortez rechnete mit jedem Cent.
»Manuela ist eingeladen«, antwortete Denise freundlich. »Das sagte ich doch schon. Wenn Sie zurückkommen, schauen Sie sich unser liebes Sophienlust einmal an. Dann werden Sie verstehen, dass Manuela uns nicht arm essen kann. Gefallen wird es ihr auch bei uns, denke ich. Wir haben viele Tiere. Vor allem Ponys zum Reiten für die Kinder. Sie brauchen sich um Manuela gewiss keine Sorge zu machen.«
»Die Kinder aus Sophienlust, die ins Gymnasium gehen, sind sehr freundlich. Das habe ich längst gemerkt«, versetzte Maria Cortez. »Darf ich denn Ihre Einladung für das Kind wirklich annehmen?«
»Wenn Sie mir Manuela anvertrauen wollen, liebe Frau Cortez?«
Maria Cortez lächelte scheu. »Ja, ich spüre, dass Sie gut zu ihr sein werden, Frau von Schoenecker.«
Denise stieß einen heimlichen Seufzer der Erleichterung aus. Es war geschafft. Sascha nickte ihr verstohlen zu.
Nun gab es keinen unnötigen Aufenthalt mehr. Die praktische Denise half, Manuelas Sachen zu packen. Sie konnte sich nun selbst davon überzeugen, wie sauber und ordentlich die bescheidene Frau alles hielt.
Maria Cortez verließ das kleine Zimmer und kam mit dem Kind zurück, das den Besuchern die Haustür geöffnet hatte. Denise beugte sich nieder und streckte dem kleinen Mädchen die Hand hin.
»Grüß dich, Manuela. Deine Mutti hat erlaubt, dass du mit uns nach Sophienlust fährst, weil sie zu deinem Vater fahren muss.«
»Papa ist krank«, antwortete Manuela leise. »Deshalb weint Mutti.«
»Wir wollen hoffen, dass er bald gesund wird, Manuela. Hast du Lust, mit uns zu fahren?«
»Wohin?«, fragte Manuela und sah dabei ziemlich ängstlich aus.
»Zu vielen Kindern, mit denen du spielen kannst.«
»Das möchte ich schon«, überlegte das Kind halblaut. »Aber ich werde mich nach Papa und Mutti sehnen.«
»Du möchtest doch sicher deiner lieben Mutti helfen, damit sie zu deinem Papa reisen kann, nicht wahr?«
»Ja, das schon, aber …«
Sascha hob die kleine Person hoch in die Luft. »Du brauchst dich nicht zu fürchten, Manuela«, versicherte er. »Es ist wunderschön in Sophienlust. Wenn du willst, darfst du auf unseren kleinen Pferden reiten oder bei Magda in der Küche die Kuchenschüssel ausschlecken.«
Das Kind lächelte. »Kuchenteig mag ich. Ich glaube, ich komme mit.«
Maria Cortez überschüttete Manuela sofort mit einer Flut von Ermahnungen, dass sie immer brav sein müsse. Doch Denise legte ihr die Hand auf die Schulter.
»Halt, halt«, bat sie. »Da bekommt Manuela ja Angst. Wichtig ist, dass sie gern bei uns ist. Mein Sohn Nick nennt Sophienlust das Haus der glücklichen Kinder.«
»Das klingt wie ein Märchen«, flüsterte Maria Cortez und kämpfte schon wieder mit den Tränen. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Cortez. Sophienlust ist ein Vermächtnis einer alten Dame, die längst unter der Erde schlummert. Wenn wir Manuela jetzt für eine Weile aufnehmen, tun wir nichts als unsere Pflicht.«
»Wie leicht Sie es mir machen, Frau von Schoenecker.«
Denise nahm eine Visitenkarte aus ihrer Tasche und reichte sie der Spanierin. »Hier ist unsere Adresse, damit Sie wissen, wie Sie Ihr Kind erreichen können, Frau Cortez. Ich glaube, damit ist alles geordnet, und wir sollten jetzt abfahren, damit Sie in Ruhe Ihre eigenen Reisevorbereitungen treffen können. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt und dass es Ihrem Mann bei Ihrer Ankunft schon ein wenig besser gehen möge.«
Maria umarmte ihr Kind. Manuela ließ sich küssen, drängte sich dann jedoch an Denise, weil die weinende Mutter ihr etwas unheimlich war.
»Du kannst mich Tante Isi nennen«, sagte Denise, als sie Hand in Hand mit dem Kind die Treppe hinunterstieg. »Willst du?«
»Ja, Tante Isi.«
Hinter den beiden ging Sascha. Er trug Manuelas Gepäck. »Du wirst staunen, Manuela«, rief er dem kleinen Mädchen zu. »In Sophienlust gibt es nämlich sogar einen Papagei, der sprechen kann.«
»Was ist das, ein Papagei?«
»Ein großer bunter Vogel.«
»Gibt es das, Tante Isi? Oder macht er bloß Spaß?«
»Wenn wir da sind, kannst du dir Habakuk anschauen, Manuela. Er redet wie ein Mensch, und er ist ziemlich frech.«
Als sie ins Auto stiegen, spähten aus einigen Fenstern neugierige Gesichter. Maria Cortez aber ließ sich nicht mehr blicken. Denise dachte voller Mitleid an sie. Was würde die tapfere fleißige Frau am Ziel erwarten?
*
Es war ein warmer, strahlend schöner Frühsommersonntag. Denise und Alexander von Schoenecker saßen auf der Terrasse in Schoeneich und genossen dankbar den Frieden, der sie umgab. Nick und Henrik waren mit den Rädern nach Sophienlust gefahren, Sascha hatte sich mit seinen Lehrbüchern in einen stillen Winkel des Parks zurückgezogen, um sich auf eine wichtige Klausurarbeit vorzubereiten.
»Vielleicht sollten wir für ein Stündchen nach Bachenau zu Andrea fahren«, schlug der Gutsherr vor. »Während der Woche hat Hans-Joachim ja doch nie Zeit.«
Andrea hatte von der Schulbank weg den jungen Tierarzt Dr. Hans-Joachim von Lehn geheiratet und war nun schon stolze Mutter eines Buben. Die junge Familie lebte im unweit gelegenen Städtchen Bachenau.
»Wenn du meinst …« Denise zögerte ein wenig, denn es kam selten genug vor, dass sie mit ihrem Mann wirklich allein und ungestört blieb. Zwar liebte sie ihre Stieftochter innig und vergötterte den kleinen Peterle, doch sie hatte sich auf diesen Nachmittag mit Alexander nun einmal gefreut.
Alexander hob jetzt lauschend den Kopf.
»Da kommt ein Wagen, Isi. Möglich, dass Andrea und Hans-Joachim die gleiche Idee hatten wie wir.«
Doch es war weder der schwere Wagen des Tierarztes noch das kleine Auto seiner jungen Frau. Viel zu schnell bog ein fremder Wagen auf die Einfahrt ein und hielt mit schleifenden Rädern vor dem Haus. Hinter dem Steuer saß eine junge Frau, der das schwarze Haar wirr in die Stirn hing. Sie stieg nicht etwa aus, sondern ließ den Kopf schwer vornüberfallen, wobei sie mit der Stirn hart auf das Lenkrad aufschlug. Doch das schien sie gar nicht zu spüren.
Alexander und Denise sprangen gleichzeitig auf und eilten zu dem Auto, dessen Motor noch lief.
»Reni«, rief Denise bestürzt aus. »Was hast du?«
Nun erkannte auch Alexander die Fahrerin. Sie wirkte so fremd und verändert, dass er zutiefst erschrak. Reni und Bodo von Hellendorf lebten nicht allzu weit von Schoeneich entfernt auf dem Gut Hellendorf, das sich seit Generationen im Besitz der Familie befand.
Reni antwortete nicht, sondern verharrte regungslos auf dem Fahrersitz. Denise und Alexander tauschten besorgte Blicke. Was war hier geschehen?
Alexander öffnete schließlich die Wagentür, um Reni beim Aussteigen behilflich zu sein und den Motor abzustellen. Die schlanke junge Frau trug nur ein leichtes Gartenkleid und an den nackten Füßen ein Paar offene Sandalen. Es passte durchaus nicht zu ihr, so unkorrekt gekleidet wegzufahren, noch dazu an einem Sonntagnachmittag. Immerhin stieg sie nun aus, bewegte sich aber wie eine Marionette. Ihr Gesicht war blass und verkrampft.
»Komm«, sagte Denise herzlich. »Wir trinken gerade Tee.«
Willenlos ließ Reni von Hellendorf sich zum Tisch führen. Dort sank sie in einen Sessel. Als Denise ihr eine gefüllte Tasse reichte, entglitt diese den Händen des verstörten jungen Gastes und zerbrach auf dem Steinboden. Doch Reni schien gar nicht zu bemerken, dass ihr ein Missgeschick passiert war. Sie starrte vor sich hin und schwieg.
»Reni«, bat Denise und nahm die Hand der Freundin. »Sag uns, was los ist. Du bist doch sicher hierhergefahren, weil wir dir helfen sollen.«
Reni war eine rassige Schönheit von vierundzwanzig Jahren. Man sah ihr an, dass ihre Mutter Spanierin gewesen war. Jetzt aber war sie ein Zerrbild ihrer selbst. Teilnahmslos saß sie da. Ihre dunklen Augen waren blicklos und ohne Glanz, das Gesicht von unnatürlicher Starrheit. Sie hielt die Schultern nach vorn gebeugt wie eine uralte Frau, und um ihren Mund grub sich eine Linie bitteren Grams.
Volle fünf Minuten verstrichen. Alexander und Denise warteten und schwiegen, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Endlich schöpfte Reni tief Atem. Ohne den Kopf zu heben, begann sie zu sprechen:
»Gitti ist ertrunken. Es war Bodos Schuld. Kann ich bei euch bleiben? Ich will Bodo nie mehr sehen.«
Gitti war das entzückende dunkelhaarige Töchterchen des glücklichen Paares. Die Mitteilung über den Tod der Kleinen erschütterte Alexander und Denise zutiefst.
»Ich hasse ihn«, fuhr Reni mit tonloser, rauer Stimme fort. »Wie kann ein Vater tatenlos zusehen, wenn das eigene Kind ertrinkt?«
Alexander ging ins Haus und kam mit einem gefüllten Glas zurück. Er hatte sich mit seiner Frau ohne Worte verständigt. In dem süßen kühlen Fruchtsaft war ein starkes Beruhigungsmittel aufgelöst.
»Hier, Reni, das wird dir gut tun.«
»Kann ich hierbleiben?«, fragte Reni und trank wie eine Verdurstende.
»Natürlich bleibst du bei uns«, antwortete Denise und streichelte ihr über das verwirrte Haar. »Es ist gut, dass du gleich zu uns gekommen bist.«
»Hätten wir doch das Schwimmbad nicht gebaut«, stöhnte Reni. »Gitte könnte noch leben …« Sie schlug die Hände vors Gesicht, doch sie weinte nicht.
So verging etwa eine halbe Stunde, in der kaum ein Wort gesprochen wurde. Dann begann das Medikament zu wirken. Auf Alexander und Denise gestützt, ließ Reni sich ins Gastzimmer bringen, wo Denise ihr Kleid und Schuhe abstreifte und ihr eines ihrer eigenen Nachthemden überzog. Dann lag Reni wie eine Tote im Bett.
Wieder hatte ein Blick von Denise genügt, um Alexander dazu zu bringen, nunmehr in Hellendorf anzurufen.
Bodo von Hellendorf konnte die entsetzliche Nachricht nur bestätigen. Die kleine Gitti lebte nicht mehr.
Denise verließ Reni, die unter der Wirkung des Medikaments eingeschlafen war.
Alexander hatte schon auf sie gewartet. »Bodo ist unterwegs. Ob wir für Reni einen Arzt rufen sollten?«
»Sie steht unter einem schweren Schock«, versetzte Denise ernst. »Ich denke, wir müssen ihr jetzt Ruhe gönnen. Ein Arzt würde sie nur erneut erschrecken und aufregen. Solange sie schläft, kann sie das Schreckliche vielleicht für ein paar Stunden vergessen. Sie tut mir wahnsinnig leid. Kannst du dir vorstellen, dass Bodo achtlos oder leichtsinnig gewesen ist? Gitti war doch sein ein und alles.«
»Es gibt tragische Unglücksfälle, Isi. Wir müssen abwarten, was Bodo uns zu sagen hat.«
Jetzt fuhr ein Auto vor. Bodo von Hellendorf, baumlang, blond und sonst stets von mitreißender Fröhlichkeit, stieg mit müden, schwerfälligen Bewegungen aus. Stumm reichte man einander die Hände.
Denise und Alexander führten den Gast auf die Terrasse, wo er in Renis Sessel Platz nahm. Zu seinen Füßen lagen die Scherben der zerschlagenen Tasse. Doch niemand achtete darauf. Wie unwichtig wurde ein Stück Porzellan in solchen Stunden.
»Ich wusste nicht, wohin sie gefahren war«, erklärte Bodo matt. »Sie war gar nicht fähig, einen Wagen zu steuern. Ein Wunder, dass sie ohne Unfall bei euch angekommen ist.«
»Sie schläft jetzt«, warf Denise ein. »Vielleicht geht es ihr morgen schon besser. Es war zu viel für sie.«
»Renie war wie von Sinnen.« Das Grauen zitterte noch in der heiseren Stimme des Mannes nach. »Es sei meine Schuld gewesen, schrie sie immer wieder. Gitti ist nicht ertrunken. Das beschwöre ich. Ihr Gesicht veränderte sich plötzlich. Ich hielt sie ja ganz fest. Zuerst dachte ich, dass sie über etwas erschrocken sei. Dann merkte ich, dass sie ganz leblos war, und nahm an, dass sie ohnmächtig geworden sei. So hob ich sie hoch und trug sie aus dem Wasser. Auf einmal sah ich ihre halb geöffneten, starren Augen und erkannte, dass sie tot war. Ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen.«
Er presste die Hände zusammen.
»Hast du einen Arzt geholt?«, fragte Alexander leise.
»Ja, wir haben einen bei uns im Ort. Er war kaum fünf Minuten später zur Stelle. Reni fuhr weg, während ich telefonierte. Deshalb war es mir auch nicht möglich, sie zurückzuhalten. Ich hoffte ja noch, dass der Arzt etwas tun könnte. Bis er eintraf, versuchte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es war nichts zu machen.«
»Wie ist so etwas möglich?«, fragte Denise mit Tränen in den Augen.
Bodo hob die Schultern. »Die Todesursache wird noch festgestellt werden. Aber kommt es darauf jetzt noch an?«
Was sollte man ihm antworten. Es war für Bodo fast noch schlimmer als für Reni. Denn der Vorwurf, dass er die Schuld am Tod des kleinen Mädchens trage, wog wie eine Zentnerlast auf seiner Seele.
Alexander und Denise kannten das Erlebnis des Abschieds für immer. Sie hatten beide in erster Ehe einen Partner durch den Tod verloren. So wussten sie, was im Herzen des Freundes vorging. Trost gab es in einer solchen Stunde nicht, und Worte wären leer und sinnlos gewesen. Sie konnten nur hoffen, dass Bodo ihre Teilnahme und Freundschaft fühlte und daraus die Kraft schöpfte, das Furchtbare zu überstehen.
Der Abend dämmerte. Sascha, dem Alexander ein paar erklärende Worte gesagt hatte, störte nicht, sondern ging auf einem Umweg ins Haus, um sich bei der Köchin etwas zu essen zu holen. Er kannte die Hellendorfs gut und empfand aufrichtiges Mitleid mit ihnen.
Die Einladung, mit ihnen eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen, lehnte Bodo von Hellendorf ab. Gegen neun Uhr stand er auf. »Ich will zurück«, erklärte er in plötzlichem Entschluss. »Reni ist bei euch in guter Hut. Aber Gitti liegt ganz allein. Morgen früh werden sie sie holen. Ich will bei ihr sein in dieser Nacht.«
»Soll ich dich begleiten?«, erbot sich Alexander.
»Danke, ich möchte allein sein. Darf ich Reni noch sehen?«
Denise führte ihn zum Gastzimmer. Leise öffnete sie die Tür. Reni rührte sich nicht. Ihr Gesicht war bleich, um ihre Augen lagen tiefe Schatten.
»Wird sie jemals einsehen, dass ich keine Schuld habe?«, fragte der blonde Hüne ohne Hoffnung. »Soll ich sie und mein Kind verlieren?«
»Reni liebt dich, Bodo. Es war nur der Schock. Verliere nicht den Mut.«
»Ich habe keinen Mut mehr, Denise. Wir waren so glücklich …«
Denise drückte ihm die Hand. Sie vermochte nicht mehr zu sprechen. Dann begleitete das Ehepaar von Schoenecker den Besucher zu seinem Wagen.
»Wie grausam das Schicksal sein kann«, flüsterte Denise und lehnte sich an ihren Mann, als müsste sie Schutz bei ihm suchen.
*
Das Gutshaus von Hellendorf war unheimlich still. Bodo stieg die Treppe hinauf und betrat das helle, freundliche Zimmer mit den lustigen Gardinen und dem kleinen weißen Kinderbett, zu dessen Häupten jetzt Kerzen in Silberleuchtern brannten. Gitti lag in dem Bett, als schlafe sie nur.
Bodo von Hellendorf stand lange im Zimmer und blickte auf sein totes Töchterchen nieder. Ein Luftzug ließ endlich die Kerzenflammen flackern. Bodo wandte sich um. Leise war die alte Emmi hereingekommen, die einst sein Kindermädchen gewesen war und jetzt die Zügel des großen Gutshaushaltes fest in ihren harten tüchtigen Arbeitshänden hielt.
»Es ist Gottes Wille«, sagte sie mit weicher Stimme. »Lassen Sie dem Kind den Frieden, der ihm bestimmt ist. Wir müssen es ertragen lernen.«
»Ich werde mich nie damit abfinden, Emmi«, stöhnte er auf. »Nie.«
Die treue Haushälterin brachte es dennoch fertig, ihn aus dem Zimmer zu führen. Dann nahm sie selbst den Platz am Bett des Kindes ein und hielt Wache, während Bodo ruhelos in seinem Arbeitszimmer umherwanderte und sich grenzenlos verlassen fühlte. In wenigen Sekunden war sein Glück zerbrochen. Vergeblich wehrte er sich gegen diese Erkenntnis. Doch das Alleinsein quälte ihn bis zur Unerträglichkeit.
Jetzt fiel ihm Asta ein, Asta Berner, mit der er einmal verlobt gewesen war. Astas Vater hatte dafür gesorgt, dass diese Verlobung rückgängig gemacht worden war, weil er sich als Schwiegersohn und Nachfolger für seine riesige Maschinenfabrik einen Ingenieur wünschte. Asta, heute siebenundzwanzig Jahre alt, war nicht stark genug gewesen, sich gegen ihren herrschsüchtigen Vater durchzusetzen. Sie hatte sich ins Ausland schicken lassen und auf ihre Liebe verzichtet. Ihr Vater aber hatte Bodo zu verstehen gegeben, dass sie sich anderweitig gebunden habe. Daher hatte sich der junge Gutsherr von Hellendorf der liebenswerten dunkeläugigen Reni zugewandt und sie geheiratet. Als Asta nach Deutschland zurückgekehrt war, hatte sie vor vollendeten Tatsachen gestanden.
Dem alten Berner war es jedoch nicht gelungen, eine Ehe zwischen seiner Tochter und einem der leitenden Ingenieure seiner Fabrik zu erzwingen. Asta war durch das schmerzliche Erlebnis zur inneren Selbstständigkeit erwacht. Sie war allein geblieben, obwohl es ihr an Bewerbern nicht fehlte.
Ein neuer Kontakt zu Bodo hatte sich bei einer zufälligen Begegnung ergeben.
Seither bestand zwischen dem Ehepaar von Hellendorf und Asta Berner eine herzliche Freundschaft.
Bodo wählte trotz der späten Stunde Astas Nummer. Er wusste, dass er immer auf Asta zählen konnte.
»Hast du schon geschlafen?«, fragte er, als sie sich meldete.
»Nein, Bodo. Was ist? Deine Stimme klingt ganz fremd.«
»Gitti ist tot, Asta.«
»Bodo – das ist unmöglich«, stieß Asta hervor. »Ich kann es nicht glauben.«
In abgehackten Sätzen berichtete er ihr, was geschehen war.
»Soll ich zu dir kommen?«, fragte sie leise.
»Kann ich das von dir verlangen – jetzt – mitten in der Nacht?«, entgegnete er zögernd und wünschte doch, dass sie bei ihm wäre.
»Ich fahre gleich los, Bodo. In einer Stunde bin ich bei dir.«
Bodo wollte Einspruch erheben, doch sie hatte bereits den Hörer aufgelegt. Auf einmal war es gut und tröstlich für ihn, zu wissen, dass sie zu ihm unterwegs war.
Die glühende Stirn gegen die kühle Scheibe gepresst, wartete er am Fenster und sah in die Dunkelheit hinaus, bis ihm die Augen brannten. Endlich tauchten die Scheinwerfer von Astas schwerem Wagen wie zwei Sonnen aus der Nacht auf. Bodo lief hinaus.
Asta nahm seine Hand und drückte sie in warmer Freundschaft. In ihren großen graublauen Augen las er, dass sie mit ihm trauerte.
Seite an Seite gingen die beiden ins Haus.
»Wenn Reni doch nicht so ungerecht wäre«, brach es aus dem Mann hervor. »Gittis Tod ist schlimm genug für mich. Es war nicht meine Schuld. Glaubst du mir wenigstens, Asta?«
»Schuld hast du sicher nicht, Bodo.« Asta bemühte sich, ihre Tränen zurückzuhalten. Ihr Herz schlug auch jetzt noch für Bodo. Dennoch wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, die glückliche Ehe zwischen Reni und Bodo zu stören. Sie hatte sich mit dem Verzicht abgefunden. Deshalb versuchte sie jetzt sogar, eine Brücke zu schlagen, indem sie für Reni eintrat.
»Warum kannst du mir glauben und Reni nicht?«, stöhnte Bodo.
»Weil Reni die Mutter ist, Bodo. Der Schicksalsschlag war zu hart für sie. Du darfst ihr keinen Vorwurf machen. Sie wird erkennen, dass sich dieser schreckliche Verlust von euch beiden nur gemeinsam ertragen lässt. Lass ihr ein wenig Zeit.«
Astas Nähe wirkte beruhigend auf Bodo. Sie holte Rotwein aus dem Schrank und nötigte Bodo ein paar Schlucke auf. Sie sprach mit ihm, wenn er reden wollte, und sie konnte schweigen, sobald er nichts mehr hören wollte. Sie schien weder Müdigkeit noch Erschöpfung zu kennen.
Bis zum Morgen saß Asta bei dem Freund. Sie stand auch neben ihm vor dem Gutshaus, als sie das Kind holten.
»Ein Segen, dass Sie bei uns sind, Fräulein Berner«, raunte Emmi ihr zu. »Sie dürfen unseren Herrn jetzt nicht im Stich lassen. Es ist zu viel auf ihn eingestürmt.«
Asta nickte ihr zu. Sie waren Verbündete, denn sie liebten ihn beide, doch jede auf ihre Weise und ohne ihn für sich zu begehren.
*
Manuela hatte sich in Sophienlust erstaunlich gut eingelebt. Zwischen den Kindern, die ihr freundlich entgegenkamen und sie mit der größten Selbstverständlichkeit in ihren Kreis aufnahmen, fühlte sie sich geborgen und glücklich. Ihre Begeisterung und besondere Liebe galt den Tieren. Sie streifte gern durch die Stallungen, fütterte die zutraulichen Ponys mit frischen Möhren und bestaunte die goldgelben Küken, die den Geflügelhof bevölkerten. Die flaumigen piepsenden Tierchen hatten es ihr besonders angetan. Wenn man Manuela suchte, brauchte man nur beim Hühnervolk Ausschau zu halten.
Pünktchen war stolz darauf, dass sie für Manuelas Anwesenheit in Sophienlust verantwortlich zeichnete. Manuela schenkte dem Mädchen mit den lustigen Sommersprossen dafür ihr ganzes Vertrauen und kam mit ihren kleinen Sorgen grundsätzlich zu Pünktchen.
So hätte Denise eigentlich recht zufrieden sein können, denn Manuela schien unter der Trennung von ihren Eltern kaum zu leiden. Dennoch machte sich die Herrin von Sophienlust sorgenvolle Gedanken. Denn bisher war von Manuelas Eltern keinerlei Nachricht eingetroffen. War das ein gutes oder ein schlechtes Omen? Erkundigungen in der Wohnung der Spanier blieben ohne Ergebnis. Maria Cortez hatte die Miete für das Zimmer für mehrere Monate im Voraus bezahlt. Aber niemand wusste, wie es Manuelas Vater ging. Man musste also das Schlimmste befürchten.
»Es ist, als gäbe es nur noch Leid und Unglück auf der Welt«, seufzte Denise mutlos.
»Das Kind ist glücklich, Isi«, tröstete Alexander seine Frau und küsste sie. »Was die Zukunft bringt, müssen wir in Ruhe abwarten.«
»Ja, Alexander. Manuela kann lachen, weil sie ahnungslos ist. Aber eines Tages wird sie nach ihren Eltern fragen. Und was soll mit Reni werden?«
Das Ehepaar wanderte Seite an Seite durch den Park von Sophienlust. Alexander wollte sich überzeugen, ob einige neu angepflanzte Sträucher gut angewachsen waren. Vom Herrenhaus hörte man Kinderstimmen und fröhliches Gelächter.
»Wir wollen abwarten, was der Nervenarzt morgen früh sagt«, meinte Alexander bedächtig. »Ich fürchte, Reni ist bei uns in Schoeneich nicht am rechten Ort.«
»Glaubst du, dass sie den Verstand verlieren könnte?« Denise erschauerte bei dieser Vorstellung.
»Das wollen wir nicht hoffen, Isi. Aber sie wird kaum in der Lage sein, am Begräbnis der kleinen Gitti teilzunehmen.«
»Wenn sie wenigstens glauben würde, dass Bodo keine Schuld trifft! Ich habe mit dem Arzt telefoniert und erfahren, dass das Kind an einer unheilbaren unentdeckten Herzkrankheit litt und an einem plötzlichen Herzversagen gestorben ist. Der Tod hätte ebenso gut in der Nacht eintreten können. Gitti war nicht zu retten. Aber Reni legt sich die Hände auf die Ohren, sobald man darauf zu sprechen kommt. Sie klagt Bodo an, leidenschaftlich, verzweifelt und ungerecht.«
»Ja, Isi. Im Augenblick haben wir keine Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Vielleicht weiß Dr. Volkert einen Rat. Er soll sehr gut sein.«
Sie gelangten zu den neuen Sträuchern, und Alexander war mit deren Zustand recht zufrieden. »Hier gedeiht alles«, meinte er in dem Bestreben, Denise ein wenig aufzuheitern, »Blumen, Bäume und Sträucher, Tiere und natürlich die Kinder.«
»Das ist nicht unser Verdienst, Alexander. Wir verdanken es Sophie von Wellentin.«
»Du darfst nicht gar zu bescheiden sein, Isi. Sophie von Wellentin hatte die Idee zu diesem einzigartigen Vermächtnis. Doch du bist es gewesen, die die Idee verwirklicht hat.«
»Trotzdem frage ich mich oft, ob das, was man tut, genug ist, Alexander. Ich hätte mir zum Beispiel die Adresse von Manuelas Eltern notieren müssen. Spanien ist weit. Falls ihren Eltern etwas zugestoßen sein sollte, erfahren wir es möglicherweise nie. Aber es ging alles so schnell mit der Abreise der jungen Frau. Jetzt mache ich mir Vorwürfe wegen meiner Vergesslichkeit.«
»Man kann Erkundigungen einziehen, Isi. Aber ich meine, wir sollten noch eine Weile Geduld haben. Es sind schlichte Menschen, die nicht ans Briefeschreiben denken.«
»Auch bei Reni bin ich nicht sicher, ob wir das Richtige getan haben. Vielleicht hätte es einen Weg gegeben, sie sofort zu Bodo zurückzuführen. Wie soll das enden, wenn sie ihn nie mehr sehen will?«
»Du bist zu gewissenhaft, Isi. Eines Tages wird dir die Last, die du dir täglich freiwillig aufbürdest, zu schwer werden.«
Denise von Schoenecker sah ihren Mann an und schüttelte den Kopf. »Solange ich dich habe, wird meine Kraft immer ausreichen, Alexander.«
Arm in Arm kehrten die beiden zu ihrem Wagen zurück. Nick und Henrik warteten dort schon auf ihre Eltern, um mit ihnen nach Schoeneich zu fahren.
»Wenn Manuelas Eltern nicht wiederkommen, bleibt die Kleine in Sophienlust, nicht wahr, Mutti?«, fragte Nick, als alle im Auto saßen.
»Möglich, Nick. Ich weiß es nicht«, erwiderte Denise.
»Sie hat so schwarze Kulleraugen«, äußerte der blonde Henrik. »Mir gefällt sie. Tante Reni hat auch solche Augen.«
»Stimmt«, pflichtete Nick seinem kleinen Bruder bei. »Das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen.«
»So erstaunlich ist das gar nicht«, meinte Alexander. »Die Mutter von Tante Reni war auch Spanierin, genau wie die der kleinen Manuela.«
»Sind sie dann verwandt?«, erkundigte sich Henrik gespannt.
»Nein, Henrik. Bei uns sind doch auch nicht alle Leute miteinander verwandt, die blondes Haar und blaue Augen haben.«
»Ach so.«
Der kleine Henrik hatte eine stille Liebe zu Reni von Hellendorf. Er schlich gelegentlich zu ihr ins Gästezimmer und führte kindliche Gespräche mit ihr. Da Reni seine Gegenwart duldete, erhob Denise keinerlei Einspruch, denn sie glaubte, dass Henriks unbefangene Art sich möglicherweise günstig auf Renis Zustand auswirken könne.
»Vielleicht würde Tante Reni Manuela gernhaben«, warf Nick nachdenklich ein. »Ein kleines bisschen schaut Manuela aus wie Gitti. Findet ihr nicht auch?«
»Mag sein, Nick«, erwiderte Denise rasch. »Es wäre aber auch möglich, dass Tante Reni noch trauriger werden würde, wenn sie das Kind sehen würde. Wir dürfen keine Experimente wagen. Tante Reni ist krank.«
»Ich glaube nicht, dass sie krank ist«, widersprach Henrik mit seiner hellen Stimme. »Sie ist nur ganz furchtbar traurig. Das kann man ja auch verstehen, da ihre kleine Gitti tot ist.«
Sie hatten Schoeneich erreicht. Der Tisch war gedeckt, und das Tablett für Reni, die ihr Zimmer kaum verließ, stand schon bereit.
»Du kannst Tante Reni das Essen hinauftragen, Henrik«, sagte Denise liebevoll zu ihrem Jüngsten. »Ich glaube, sie nimmt es von dir besonders gern entgegen. Sag auch dazu, dass sie wenigstens ein kleines bisschen essen soll.«
»Ich sag’s ihr, Mutti. Weißt du, ich nehme meinen Teller mit. Zu zweit schmeckt es bestimmt besser.«
Selbstbewusst und voller Eifer machte Henrik sich mit dem Tablett auf den Weg.
Eine halbe Stunde später kehrte er mit Siegermiene zurück. Reni hat alles verzehrt, was für sie zurechtgemacht worden war.
»Du bist ein Ass mit drei Sternen, Kleiner«, stellte Nick neidlos fest.
Denise umarmte Henrik und gab ihm einen Kuss. »Lieb von dir, Henrik.«
»Ich mag sie eben gern leiden, Mutti. Etwas Besonderes hab’ ich gar nicht gemacht. Nur ein bisschen geredet und dabei gesessen. Ich glaube, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie auf einmal auch zu essen anfing.«
Später, als Henrik schon schlief, ging Denise zu Reni hinauf. Sie fand die junge Frau vollständig angekleidet am Fenster.
Emmi, die Haushälterin auf Gut Hellendorf, hatte dafür gesorgt, dass zwei Koffer mit ihren Sachen gekommen waren.
»Morgen kommt Dr. Volkert zu dir, Reni. Ich hoffe, dass er dir helfen kann.«
Reni wandte langsam den Kopf. »Wieso könnte er mir helfen, Denise? Er hätte Gitti helfen sollen. Jetzt ist alles zu spät und hat keinen Sinn mehr.«
»Wirst du ihm trotzdem erlauben, mit dir zu sprechen?«, bat Denise besorgt.
»Dir zuliebe, Denise. Ich weiß, dass du glaubst, ich wäre krank. Aber ich bin ganz in Ordnung. Niemand kann von mir verlangen, dass ich zu Bodo zurückgehe. Keine Mutter in meiner Lage würde das tun. Darüber, dass Gitti durch die Schuld ihres Vaters den Tod gefunden hat, werde ich nie hinwegkommen.«
Denise wagte es nicht, Einspruch zu erheben und Bodo in Schutz zu nehmen. Ihr tat das Herz weh, weil sie der jungen unglücklichen Freundin nicht helfen konnte.
*
Dr. Ulrich Volkert war Anfang der Dreißig und hatte ein kluges, sensibles Gesicht. Er hörte zu, sprach selbst wenig. Ergriff er aber das Wort, dann klang das, was er sagte, stets freundlich und so, als gäbe es für ihn nur diesen einen Patienten, mit dem er gerade beschäftigt war. Obwohl er unendlich viel zu tun hatte, verstand er es, für seine Kranken genug Zeit aufzubringen.
Bei Reni von Hellendorf hielt er sich volle anderthalb Stunden auf. Dann folgte die unvermeidliche Unterredung mit Bodo von Hellendorf, der nach Schoeneich gekommen war. Auch Denise und Alexander nahmen an dem Gespräch teil, weil sie von Bodo darum gebeten worden waren.
»Es handelt sich um einen schweren Schock und eine tiefe Depression«, erklärte Dr. Volkert. »Am besten wäre die Patientin in einer Nervenklinik aufgehoben.«
Denise hob den Kopf und machte eine abwehrende Handbewegung. »Das dürfen wir ihr nicht antun, Doktor. Sie hat bei uns Zuflucht gesucht. Sofern keine unmittelbare Gefahr für Reni besteht, möchte ich sie hier im Haus behalten.«
»Sie nehmen damit viel auf sich, gnädige Frau«, erwiderte Dr. Volkert bedachtsam. »Allerdings muss ich zugeben, dass Ihr Anerbieten den Wünschen von Frau von Hellendorf entgegenkommt. Sie wehrt sich dagegen, in eine Klinik zu gehen. Wie die meisten psychisch Kranken hält sie sich für gesund. Selbstverständlich liegt es mir fern, irgendwelche Forderungen aufzustellen. Frau von Hellendorf wird gesund werden. Nur kann viel, viel Zeit vergehen, bis sie aus dieser Depression herauskommt und sich ihrem Mann wieder zuwendet.«
»Das ist für mich schwer zu ertragen, Dr. Volkert«, warf Bodo bitter ein.
»Gewiss. Aber Sie müssen geduldig sein und dürfen es Ihrer Frau nicht übelnehmen, wenn sie heute ungerecht urteilt. Das ist ein Teil ihrer Krankheit. Ich habe ein Medikament, von dem ich mir einigen Erfolg verspreche. Es muss regelmäßig injiziert werden. Das gibt mir zugleich die Möglichkeit, häufig mit der Patientin in Kontakt zu kommen. In einer Klinik wäre diese Behandlung weniger aufwändig. Aber ich will die Fahrten hierher gern auf mich nehmen. Die größere Last wird auf Ihren Schultern liegen, verehrte Frau von Schoenecker.«
Denise nickte ihm zu. »Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Behandlung hier durchführen wollen, Dr. Volkert. Es wäre für mich unerträglich zu wissen, dass Reni irgendwo allein in einer Klinik von aller Welt abgeschlossen ist, obwohl sie doch in ihrer Not zu uns kam und hier Hilfe erhoffte.«
Ulrich Volkert stand auf. Er warf einen kurzen Blick auf seine Uhr. »Ich muss weiter. Morgen bin ich wieder hier. Vielleicht haben Sie recht. Echte Menschenliebe und Herzenswärme können manchmal mehr vollbringen als unsere medizinische Kunst.«
Bodo von Hellendorf begleitete den Arzt zu seinem Wagen. Alexander von Schoenecker legte die Hände auf Denises Schultern. »Warum lädst du dir diese Bürde auf, Isi?«, fragte er besorgt. »Du denkst nie an dich und glaubst, dass deine Kräfte Berge versetzen könnten.«
»Meine Kräfte sicherlich nicht, Alexander«, erwiderte Denise mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Aber vielleicht mein inniger Wunsch, Reni ins Leben zurückzuführen.«
»Ach, Isi, du bist unverbesserlich«, seufzte Alexander. »Ich liebe dich jeden Tag ein wenig mehr um deines goldenen Herzens willen.«
Denise bekam heiße Wangen. »Wer hat schon ein goldenes Herz, Alexander? Vergiss nicht, dass auch ich einmal in großer Not war und mir wie durch ein Wunder geholfen wurde, als Nick Sophienlust erbte und ich dich fand. Muss ich da dem Schicksal nicht ab und zu ein wenig zurückzahlen?«
*
Am folgenden Tag wurde Gitti von Hellendorf in einem weißen Sarg zur letzten Ruhe gebettet. Eine große Trauergemeinde stand an dem offenen Grab. Frühlingsblumen und die ersten Blüten des beginnenden Sommers bildeten einen überwältigend schönen tröstlichen Anblick. Selbstverständlich war auch das Ehepaar von Schoenecker gekommen.
Reni von Hellendorf war dagegen in Schoeneich geblieben. Sie hatte es abgelehnt, an der Feier teilzunehmen, denn sie wollte ihrem Mann nicht begegnen.
»Sie werden vom Schicksal reden und von Gottes Willen, Denise«, hatte sie erklärt. »Aber von Bodos Schuld wird nicht die Rede sein. Ich würde es ihnen allen ins Gesicht schreien. Deshalb ist es besser, wenn ich nicht mitgehe.«
Um die gleiche Stunde, zu der Blumen und Erde auf Gittis Sarg geworfen wurden, saß Dr. Volkert bei Reni. Es hatte ihn einige Mühe gekostet, sie dazu zu bringen, sich mit seiner Behandlung einverstanden zu erklären.
»Ich bin Ihnen dankbar, lieber Dr. Volkert, dass Sie nicht mit mir reden, als hätte ich den Verstand verloren«, sagte Reni mit ihrer klanglos gewordenen Stimme. »Wissen Sie, ich habe über das, was geschehen ist, gründlich nachgedacht.
Wissen Sie, es gibt da eine Frau. Mit ihr war Bodo verlobt, ehe ich ihn kennen lernte. Diese Verlobung wurde vom Vater des Mädchens aufgelöst. Asta sollte einen Mann heiraten, der später seine Fabrik übernehmen konnte. Doch dieser Plan von Astas Vater misslang. Asta Berner blieb unverheiratet, und ich bin sicher, dass sie meinen Mann auch heute noch liebt. Wahrscheinlich wäre es für beide ein Glück, wenn ich mich scheiden ließe. Ich will mich nicht rächen an meinem Mann. Nur könnte ich nie mehr mit ihm unter demselben Dach leben. Nie mehr.«
Dr. Volkert schwieg und hörte weiterhin zu. Er erfuhr von der Freundschaft, die zwischen dem Ehepaar von Hellendorf und Asta Berner bestand. Diese Dreieckskonstellation bereitete ihm einige Sorgen. Er äußerte sich jedoch nicht dazu.
»Eine Scheidung soll man nicht überstürzen, liebe Frau von Hellendorf«, sagte er nur.
»Dazu ist immer noch Zeit. Im Augenblick sind Sie räumlich von Ihrem Mann getrennt. Das ist sicher gut und richtig für jetzt und heute. Was später geschehen soll, werden wir abwarten. Dass Sie nicht bis in alle Ewigkeit zu Gast auf Schoeneich bleiben können, ist Ihnen gewiss klar.«
Reni warf ihm einen verwunderten Blick zu. »Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, Doktor. Bei Denise und Alexander fühlt man sich wunderbar geborgen und sicher. Sie würden mich niemals wegschicken.« Etwas wie Angst flackerte in ihren dunklen Augen auf.
»Gewiss nicht, Frau von Hellendorf. Trotzdem ist Schoeneich nicht Ihre Heimat. Jeder Mensch hat einen festen Platz im Leben.«
»Ich habe keinen Platz und keine Heimat mehr. Niemand braucht mich.« Reni barg das Gesicht in den Händen und weinte leise.
Dr. Volkert nickte zufrieden vor sich hin. Nun konnte sie wenigstens schon weinen. Das war ein erster winziger Schritt zur Genesung.
Obwohl er in Eile war und noch zu anderen Kranken fahren musste, blieb er geduldig eine Weile neben Reni sitzen und wartete, bis sie sich etwas gefasst hatte. Als er sich verabschiedete, lächelte er ihr ermutigend zu. »Morgen bin ich wieder hier, Frau von Hellendorf. Hoffentlich können Sie in der Nacht gut schlafen.«
*
Henrik schien ein Zaubermittel zu besitzen, das seine Wirkung auf Reni von Hellendorf so gut wie nie verfehlte. Mit den Jungen ging sie bei gutem Wetter im Park spazieren, mit ihm unterhielt sie sich, und wenn er sich zu ihr setzte, aß sie sogar ein wenig.
Da Dr. Volkert diese Freundschaft zwischen dem blonden Buben und seiner Patientin für heilsam und segensreich hielt, ließ Denise ihren Jüngsten nur zu gern gewähren. Sie machte ihm keinerlei Vorschriften, sondern beobachtete nur unmerklich, was geschah. Da sie jedoch durch ihre Pflichten in Sophienlust und in ihrer eigenen Familie stark in Anspruch genommen war, konnte sie nicht ständig über Renis Tun und Treiben wachen. Vielleicht hätte sie sonst an diesem sonnigen Mittag Einspruch erhoben, als Henrik die Kranke zu einem gemeinsamen Ritt über die Felder aufforderte.
»Magst du mit mir reiten, Tante Reni? Du kannst Muttis Pferd haben. Sascha sagt immer, dass es viel zu wenig bewegt wird.«
Reni stand auf und schaute in den Wandschrank. Sie stellte fest, dass Emmi ihr das Reitzeug mitgeschickt hatte – aus welchem Grund auch immer. Die Vorstellung, mit dem blonden Jungen ein bisschen durch die warme Frühsommerluft zu traben, hatte eine gewisse Verlockung für sie. In Hellendorf war sie täglich ausgeritten.
»In Ordnung, Henrik. Reiten wir«, sagte sie leise. »Ich muss mich nur umziehen.«
»Ich auch, Tante Reni. In zehn Minuten hole ich dich ab.«
Unbemerkt verließen die beiden das Haus. Ein Stallbursche sattelte Denises Pferd und Henriks Pony. Henrik legte dabei mit Hand an, wie es sich für einen richtigen Reiter gehörte. Er kramte sogar ein Stück Zucker für sein Pony aus der Tasche seiner Reithose.
Im strahlenden Mittagssonnenschein ritten die beiden Seite an Seite langsam vom Hof. Reni tat die körperliche Betätigung gut. Sie spürte den weichen Wind auf ihren Wangen und empfand vielleicht zum ersten Mal seit Gittis Tod, dass sie noch jung und voller Leben war.
Henrik fand das Tempo zu beschaulich und verfiel in Trab. Reni schloss sich ihm an. Auf einer Wiese wurde der Trab sogar zum Galopp. Erst als sie den Wald erreichten, zügelten sie ihre Tiere.
»Da drüben kommt Irmela«, rief Henrik plötzlich aus. »Sie ist die beste Reiterin von Sophienlust. Nach Nick natürlich.«
Reni erblickte das blonde Mädchen, das in tadelloser Haltung zu Pferde saß, nun auch. »Sie war früher in Indien«, berichtete Henrik mit wichtiger Miene. »Dort hat sie in einer englischen Schule reiten gelernt. Ihre Mutti und ihr zweiter Vati sind immer noch in Indien. Aber Irmela bleibt bei uns in Sophienlust, weil sie in Deutschland studieren möchte.«
Irmela war nun herangekommen und hob grüßend ihre kleine Gerte. Sie gehörte zu den größeren Kindern von Sophienlust. Nick hatte ihr erzählt, dass Reni von Hellendorf bei seinen Eltern zu Gast sei. Auch der tragische Tod von Renis Tochter war ihr bekannt.
»Du kannst gut reiten«, sagte Reni freundlich zu Irmela. »Henrik hat mir gerade erzählt, wieso.«
Irmela lächelte. »Ich tu’s schrecklich gern. Wenn ich mit den Schularbeiten fertig bin, muss ich in den Sattel.«
Das blonde Mädchen schloss sich den beiden an, und Reni empfand Irmelas Nähe durchaus nicht störend. Am Ufer des großen Sees legten sie eine Rast ein. Die Pferde rupften junges Gras, die Reiter saßen auf einem gefällten Stamm. Reni fragte Irmela ein wenig aus und erfuhr vom Tod ihres Vaters, der in Indien als Arzt tätig gewesen war.
»Jetzt ist Mutti wieder glücklich«, schloss Irmela lächelnd ihren Bericht. »Zuerst war ich eifersüchtig, als sie zum zweiten Mal heiraten wollte.«
Reni hörte zu und versuchte, sich das Schicksal dieses sympathischen Mädchens vorzustellen. Ob sie nicht manchmal Sehnsucht nach der Mutter habe, fragte sie.
»Nächstes Jahr kommen meine Eltern nach Europa auf Urlaub«, berichtete Irmela fröhlich. »Und im Jahr darauf werde ich vielleicht in den großen Ferien nach Bombay fliegen.« Irmela warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und stieß einen kleinen Schrei aus. »Höchste Zeit, Henrik! Wir sitzen hier gemütlich und erzählen, während in Sophienlust eine Geburtstagsfeier ist.«
Henrik sprang sofort auf die Füße. »Mensch, dass ich das vergessen konnte! Wo doch heute Magdas Geburtstag ist. Was soll ich jetzt bloß machen, Tante Reni?«
»Wieso?«, fragte Reni etwas verständnislos.
»Na, ich muss natürlich so schnell wie möglich nach Sophienlust. Erstens gehört es sich, weil es ausgerechnet Magdas Geburtstag ist, und zweitens hat sie bestimmt fantastische Torten gebacken. Aber ich darf dich auch nicht allein lassen. Ein Herr muss eine Dame immer nach Hause bringen.«
Irmela und Reni tauschten einen Blick. Sogar um Renis sonst so ernsten Mund spielte der Anflug eines Lächelns, denn es war wirklich rührend, dass Henrik sich als »Herrn« betrachtete.
»Warum kommen Sie nicht einfach mit zur Geburtstagsfeier, Frau von Hellenbach?«, fragte Irmela unbefangen.
Reni zögerte. Einerseits scheute sie davor zurück, mit vielen fröhlichen Leuten zusammenzutreffen, andererseits erschien es ihr wenig verlockend, den Rückweg nach Schoeneich allein antreten zu müssen. Insofern hatte Henrik mit seiner Bemerkung gar nicht unrecht gehabt.
»Bitte, Tante Reni«, bettelte der Junge jetzt. »Es gibt bestimmt prima Kuchen. Magda ist nämlich die beste Köchin der Welt. An ihrem eigenen Geburtstag hat sie sich sicher besonders angestrengt.«
Es geschah eigentlich mehr aus Rücksicht auf Henrik, dass Reni schließlich doch ja sagte. Der Junge atmete erleichtert auf. Sie bestiegen ihre Pferde und ritten in scharfem Trab nach Sophienlust, wo zwei lange Tafeln im Freien gedeckt waren.
Die Reiter kamen gerade im rechten Augenblick. Das Ehepaar von Schoenecker war bereits eingetroffen. Auch Andrea und Dr. Hans-Joachim von Lehn fehlten nicht. Selbst die Huber-Mutter, eine uralte weise Kräuterfrau, die ihren Lebensabend in Sophienlust verbrachte, hatte zur Feier dieses Tages ihr Zimmer verlassen und saß in ihrem besten schwarzen Seidenkleid am oberen Ende der einen Tafel.
Die drei Reiter wurden herzlich begrüßt. Denise verlor kein Wort darüber, dass sie sich um Reni gesorgt hatte. Pünktchen aber lief ins Haus und holte ein weiteres Gedeck für den neuen Gast.
Reni wurde mit der größten Selbstverständlichkeit in den frohen Kreis aufgenommen. Magda ließ es sich nicht nehmen, ihre Torten selbst aufzuschneiden. Eine sah verlockender aus als die andere. Ihre berühmte Schokoladentorte war natürlich auch dabei.
Denise wurde zwar von den Kindern vollkommen mit Beschlag belegt, fand aber doch hin und wieder Gelegenheit, Reni zu beobachten. Die junge Frau saß durch Zufall genau gegenüber von Manuela. Sie schien von dem hübschen Kind mit dem dunklen Haar und den lebhaften schwarzen Augen fasziniert zu sein. Kein Wunder. Auch Gitti hatte spanisches Blut in den Adern gehabt. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihr und Manuela war nicht zu verkennen. Außerdem war Manuela ungefähr so alt wie die verstorbene Gitti.
Nick hielt eine Geburtstagsrede. Die Kinder riefen hoch, hoch, hoch und klatschten Beifall. Die gute Magda, die schon zu Lebzeiten Sophie von Wellentins in der großen Küche geherrscht hatte, konnte wieder einmal spüren, wie beliebt sie bei allen war.
Die Tafel wurde erst aufgehoben, als auch das letzte Stückchen Torte seinen Weg in einen Kindermagen gefunden hatte. Anschließend riefen Schwester Regine und Frau Rennert die Kinder zu den Gesellschaftsspielen, während Wolfgang Rennert, der Sohn der Heimleiterin und Haus- und Musiklehrer, sowie dessen junge Frau Carola eine Tombola vorbereiteten, bei der jedes Kind etwas gewinnen sollte. Die Gewinne hatte Alexander von Schoenecker gestiftet. Dabei war es ihm gelungen, manchen heimlichen Wunsch eines Kindes zu erfüllen. Die jungen Rennerts mussten nun aber auch dafür sorgen, dass die einzelnen Päckchen in die Kinderhände kamen, für die sie bestimmt waren.
Reni stand zuerst etwas abseits. In dem lustigen Trubel fühlte sie sich zwar nicht ausgeschlossen oder unglücklich, aber doch ein wenig fremd. Etwas zog sie magnetisch zu Manuela hin, die eben beim Sackhüpfen der Kleinsten eine Tafel Schokolade als Preis erhalten hatte.
»Wie heißt du?«, fragte das Kind. »Du bist noch nie hier gewesen.«
»Ich heiße Tante Reni. Und du?«
»Manuela Cortez. Wohnst du auch in Sophienlust, Tante Reni?«
»Nein, ich bin in Schoeneich zu Besuch.«
»Ach so, bei Tante Isi. Gefällt es dir in Sophienlust?«
»Ja, sehr.« Reni war wie verzaubert. Manuela sah Gitti zwar nicht allzu ähnlich, aber sie erinnerte sie sehr stark an ihr eigenes Kind.
»Du bist mit Henrik und Irmela auf den Pferden gekommen. Ich kann auch schon reiten, wenn Nick mich festhält oder Justus.«
Reni hatte den alten Justus, der früher Gutsverwalter auf Sophienlust gewesen war und jetzt seinen Lebensabend damit verbrachte, sich den Kindern als eine Art Großpapa zu widmen, beim Kuchenschmaus schon kennen gelernt.
»Magst du Pferde gern?«
»Hm, aber am liebsten mag ich die kleinen Küken. Soll ich sie dir zeigen? Wir haben viele.«
Zutraulich schob sich Manuelas Hand in die von Reni. Einträchtig gingen die beiden zum Geflügelhof, wo Manuela die Küken aufhob und zärtlich streichelte.
Das hübsche Kind zwischen den goldgelben Tierchen bot ein reizendes Bild.
Reni wusste nicht, dass sie lächelte. In der Nähe dieses Kindes fühlte sie sich wie von einem schweren Druck befreit.
»Jetzt müssen wir zurück zu den anderen, Tante Reni. Es gibt nämlich noch etwas zu gewinnen. Das darf ich nicht versäumen«, erklärte Manuela schließlich.
Die junge Frau kehrte mit Manuela wieder in den fröhlichen Kreis der spielenden Kinder zurück.
Carola Rennert, die am Glücksrad der Tombola stand und es mit viel Geschick so dirigierte, dass es für jedes Kind auf der geplanten Nummer stehen blieb, bat Reni, ihr beim Verteilen der Päckchen behilflich zu sein. Reni nickte und legte mit ernstem Gesicht bunt verpackte Überraschungen in die begehrlich ausgestreckten kleinen Hände.
Erst nach dem gemeinsamen Abendbrot ritt sie mit Henrik zurück nach Schoeneich.
»Schön war’s, nicht wahr, Tante Reni?«, seufzte Henrik müde und zufrieden.
»Sehr schön«, stimmte Reni ihm zu. »Es ist nett von dir, dass du mich mitgenommen hast.«
»Es war ja genug Torte da«, meinte Henrik großzügig, denn das war für ihn von entscheidender Wichtigkeit.
*
Asta Berner, die Jugendfreundin und ehemalige Verlobte Bodo Hellendorfs, wunderte sich, als Dr. Volkert sie am Telefon zu sprechen wünschte. Zwar wusste sie, dass er Reni behandelte, doch sie sah keinen Grund für ihn, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.
»Darf ich einmal bei Ihnen vorbeikommen, Frau Berner?«, bat Dr. Volkert höflich. »Ich glaube, dass Sie uns helfen könnten.«
»Ich helfe selbstverständlich gern, Dr. Volkert. Renis augenblicklicher Zustand macht mir Sorge. Ihr Mann leidet darunter. Gerade jetzt fehlt ihm die seelische Gemeinschaft mit seiner Frau.«
Da Asta Zeit hatte und Dr. Volkert sich für eine Stunde freimachen konnte, kam die Verabredung rasch zustande. Ulrich Volkert betrat schon kurz nach seinem Anruf das große schöne Patrizierhaus, in dem Asta mit ihrem Vater lebte. Ein Diener führte ihn in den mit kostbaren Stilmöbeln ausgestatteten Empfangsraum.
Asta ließ ihn kaum eine Minute warten, und Dr. Volkert war von ihrer Erscheinung überrascht. Hatte er schon die weiche, klangvolle Stimme am Telefon sympathisch und angenehm empfunden, so musste er sich jetzt eingestehen, dass er eine völlig falsche Vorstellung von dieser Frau gehabt hatte. Ihre Kleidung war betont schlicht, jedoch von großer Eleganz. Das aschblonde Haar rahmte ihr schönes Gesicht in natürlichen Wellen ein. Klare blaugraue Augen richteten sich freundlich und forschend auf ihn.
Diese Frau ist durch und durch vornehm und ohne Falsch, ging es ihm durch den Kopf. Meine Befürchtung, dass sie es darauf abgesehen haben könnte, ihren früheren Verlobten jetzt doch noch für sich zu gewinnen, ist unbegründet. Das steht fest.
Asta bat ihn, Platz zu nehmen und fragte, ob sie ihm eine Erfrischung anbieten dürfe. Er dankte höflich und lehnte ab. Danach brachte sie von sich aus die Sprache auf Reni von Hellendorf.
»Glauben Sie, dass Reni irgendwann einsehen wird, wie sehr sie ihrem Mann unrecht tut mit diesem furchtbaren Vorwurf?«, fragte sie leise. »Ich begreife, dass man sie mit logischen Argumenten jetzt nicht überzeugen kann. Trotzdem muss man auch an ihren Mann denken. Er trägt eine doppelte Last, denn er liebt seine Frau und sehnt sich nach ihr.«
»Sie kennen beide Partner gut. Die Ehe war glücklich?«
»Selbstverständlich. Ich bin viel in Hellendorf. Zwischen Reni und Bodo gab es niemals Spannungen oder gar Streit. Die schrecklichen Anklagen, die die arme Reni jetzt ausspricht, sind ein deutliches Anzeichen dafür, dass ihre Seele allzu tief verwundet wurde. Können Sie solche Wunden heilen, Dr. Volkert?«
»Ich hoffe es, Frau Berner. Entscheidend wird sein, ob Herr von Hellendorf genügend Kraft und Geduld aufbringt. Man kann nicht voraussagen, wie lange eine solche Störung anhalten wird. Manchmal dauert es Wochen, manchmal Monate oder gar Jahre.«
»Bodo ist unendlich tapfer. Dennoch trifft es ihn immer wieder hart, dass Reni ihn nicht einmal sehen will. Ich habe sie gestern zum ersten Mal besucht. Sie wirkt vollkommen fremd und verändert. Es ist schwer zu schildern. Früher war sie lebhaft und sprühte von Temperament. Ihre Mutter war ja Spanierin. Das spürte man sofort. Doch jetzt scheint sie nur noch eine aufgezogene Puppe ohne Seele zu sein.«
»Ja, so ist es. Sie beschreiben den Zustand der Patientin sehr treffend. Fragte sie nach ihrem Mann?«
»Nein. Sie sagte nur, dass sie sich von ihm scheiden lassen wolle. Niemand dürfe von ihr verlangen, dass sie je wieder mit ihm zusammenlebe.« Asta stockte, fuhr aber dann entschlossen fort: »Sie will, dass ich Bodos Frau werde. Ich war vor vielen Jahren mit ihm verlobt.«
Dr. Volkert sah Asta ein wenig überrascht an. Mit einem solchen Maß an Aufrichtigkeit hatte er nicht gerechnet. »Warum erzählen Sie mir das?«, fragte er leise. »Dazu sind Sie wirklich nicht verpflichtet.«
Asta hob die Schultern. »Ich weiß, dass ein Psychiater sich aus vielen kleinen Mosaiksteinchen ein Bild zusammensetzen muss. Möglicherweise ist gerade diese Äußerung wichtig.«
»Darf ich eine Frage stellen?«
»Natürlich. Ich habe versprochen, dass ich versuchen will, Ihnen zu helfen.«
»Würden Sie Herrn von Hellendorf heute noch heiraten? Bitte, entschuldigen Sie diese Indiskretion. Sie brauchen mir nicht zu antworten.«
Asta lächelte. Ihre großen Augen blickten klar. »Nein, Doktor, ich würde es unter keinen Umständen tun. Wenn eine Verlobung auseinandergeht, so muss es Gründe dafür geben. Dieses Kapitel ist abgeschlossen.«
»Ich bin ganz offen. Frau von Hellendorf hat auch mir gegenüber derartige Äußerungen getan. Sie teilte mir mit, dass Ihre Verlobung durch Ihren Vater aufgelöst worden sei.«
»Das ist richtig. Dennoch weiß ich heute, dass es meine Schuld war. Ich war einfach zu schwach. Aber was nun auch geschehen mag, die Ehe meiner besten Freunde darf nicht zerbrechen.«
»Sie sehen Herrn von Hellendorf häufig?«
»Ja, manchmal kommt er hierher. Meist aber fahre ich hinaus nach Hellendorf. Er braucht jetzt einen Menschen, der ihm zuhört, wenn er reden will. Ich selbst meine, dass das der Sinn einer echten Freundschaft ist. Halten Sie das für einen Fehler?«
»Im Gegenteil. Es ist in dieser schweren Zeit ein Segen, dass Sie da sind. Sie erweisen Herrn von Hellendorf und damit indirekt auch seiner Frau einen großen Dienst.«
»Ich kann wenig genug tun, Dr. Volkert. Übrigens war ich Reni gegenüber äußerst vorsichtig in meinen Äußerungen. Ich sagte nur, dass Bodo sicherlich keine Scheidung wolle.«
»Das war wohl gut«, meinte Ulrich Volkert nachdenklich. »Frau von Hellendorf ist augenblicklich einer meiner schwierigsten Fälle. Ich bin Ihnen für dieses Gespräch unendlich dankbar, Frau Berner.«
»Wir haben beide das Gleiche im Sinn, Doktor«, gab Asta schlicht zurück. »Wir wollen nichts unversucht lassen, um Reni von Hellendorf zu ihrem Mann zurückzuführen.«
Der Arzt erhob sich. Er beugte sich tief über Astas Hand und zog sie an seine Lippen. Die Begegnung mit Asta hatte ihn stark beeindruckt. Er ahnte, dass sie Bodo auch jetzt noch liebte. Doch es war eine Liebe, die nichts forderte. Längst hatte Asta Berner sich in die Rolle der Verzichtenden hineingelebt. Seine Vorstellung von dieser Frau war falsch gewesen.
»Darf ich einmal wiederkommen, Frau Berner?«, fragte er bittend.
»Gewiss, Doktor. Sie sind hier jederzeit gern gesehen. Ich habe ja nicht viel zu tun.«
Deutlich hörte er den Unterton von Resignation heraus, der in diesen Worten mitschwang. Asta Berner war nicht glücklich. Sie litt unter ihrer Einsamkeit. Das ehrwürdige Patrizierhaus mit seinen kostbaren Möbeln war für sie ein goldenes Gefängnis, dem sie nicht entfliehen konnte.
Unwillkürlich lächelte Dr. Volkert ihr zu, um ihr ein wenig Mut zu machen. Doch ihr schönes Gesicht blieb ernst.
Ulrich Volkert nahm dieses Bild mit sich. Eine Frau wie Asta Berner war ihm noch nie begegnet.
*
Reni saß im Park in der Sonne. Denise gesellte sich wie von ungefähr zu ihr. »Willst du heute wieder nach Sophienlust?«, fragte sie, als falle ihr das nur eben so ein. »Die Kinder veranstalten ein kleines Reitturnier. Da könntest du fachkundigen Punktrichter spielen.«
»Ja, das will ich gern übernehmen, Denise. Ich …, ich wollte dich sowieso um etwas bitten. Aber ich weiß nicht, ob es unbescheiden wäre.«
»Ich werde nein sagen, wenn’s mir nicht passt«, scherzte Denise. »Bis jetzt bist du gewiss nicht unbescheiden gewesen.«
»Ich falle euch zur Last, Denise. Glaubst du, dass ich das nicht weiß.«
»Was für ein Unsinn. Wir haben wahnsinnig gern Besuch. Henrik wäre todtraurig, wenn du plötzlich abreisen wolltest. Du hast sein Herz erobert. Sozusagen bist du seine erste Liebe.«
»Ja, Denise, Henrik und ich, wir verstehen uns prächtig. Trotzdem möchte ich weg von hier.«
Denise erschrak ein wenig, doch sie zeigte es nicht. »Kann ich dir behilflich sein, Reni?«, fragte sie nur behutsam.
»Ob es in Sophienlust einen Platz für mich gäbe?«, fuhr Reni schüchtern fort. »Dort ist die kleine Manuela. Dieses Kind erinnert mich ein klein wenig an Gitti. Das macht mich seltsamerweise nicht traurig, sondern beinahe ein bisschen glücklich. Könntest du es einrichten, dass ich immer in der Nähe von Manuela bin?«
»Nichts ist einfacher als das, Reni«, rief Denise erleichtert aus. »Das Haus drüben ist ja viel größer als dieses hier. Du kannst ein Zimmer mit eigenem Bad haben. Wenn du willst, bringen wir deine Sachen noch heute hinüber.«
»Danke, Denise. Du darfst nicht glauben, dass ich es hier nicht schön fände. Es ist nur wegen der kleinen Manuela.«
»Ob Sophienlust oder Schoeneich, das macht kaum einen Unterschied, Reni. Henrik wird allerdings ein bisschen enttäuscht sein, fürchte ich.«
»Er ist ja oft genug in Sophienlust, Denise. Ich werde mit ihm sprechen.«
Denise umarmte Reni und küsste sie auf die Wange. »Ich fürchtete schon, du wolltest uns ganz verlassen«, gestand sie lächelnd.
»Ach nein, Denise. Ich kann ja nicht zurück«, erwiderte Reni. Es klang, als existiere ihr Heim in Hellendorf gar nicht mehr.
Seltsam, dachte Denise. Wenn man mit ihr spricht, könnte man meinen, sie sei wieder ganz gesund. Sie schließt sich nicht mehr in ihrem Zimmer ein und nimmt sogar an unseren Mahlzeiten teil. Sie geht spazieren, reitet und hat wieder eine bessere Farbe bekommen. Trotzdem ist im Grunde alles beim alten geblieben. Denn sie gibt Bodo auch jetzt noch die Schuld am Tod ihres Kindes.
»Ich werde gleich meine Koffer packen, wenn es dir recht ist«, versetzte Reni nun voller Eifer. »Allerdings müssen wir Dr. Volkert verständigen, damit er nicht vergebens hierherkommt.«
»Das will ich gern übernehmen, Reni. Du hältst ihn für einen tüchtigen Arzt?«
Reni dachte ein wenig nach, ehe sie antwortete. »Man kann gut mit ihm sprechen, Denise. Aber eigentlich wäre es gar nicht nötig, dass er so oft zu mir kommt.«
»Dann geschieht es also mehr aus Höflichkeit, dass du ihn weiterhin empfängst?«
»Ich denke nicht darüber nach, Denise. Vielleicht braucht man einen Menschen wie ihn. Ich bin sicher, dass man ihm vollkommen vertrauen kann. Es gibt nichts, worüber man nicht mit ihm sprechen könnte.«
»Diesen Eindruck habe ich auch von ihm gewonnen.«
»Wunder kann er trotzdem nicht vollbringen, Denise«, seufzte Reni. »Gitti ist tot. Daran kann auch Dr. Volkert nichts mehr ändern.«
Denise führte Reni rasch ins Haus. Dort trafen sie Nick, der sich eben auf den Weg nach Sophienlust machen wollte, um die letzten Vorbereitungen für das Reitturnier zu treffen.
»Tante Reni stellt sich als Punktrichter zur Verfügung«, rief Denise ihm zu. »Im Übrigen wohnt sie ab heute in Sophienlust.« Nick blieb stehen. »Warum denn?«, fragte er verwundert.
»Ich möchte es gern, Nick. Bist du einverstanden?«, schaltete sich Reni ein. Sie wusste genau, dass Nick nach dem Testament seiner Urgroßmutter Eigentümer von Sophienlust war und schon gern ein Wort mitredete.
»Klar bin ich einverstanden, Tante Reni«, erwiderte er sofort.
»Es ist nun mal der schönste Platz der Welt.«
»Danke, Nick. Bis nachher.«
Der Junge schwang sich auf sein Rad. Denise und Reni schauten ihm nach. »Er wird immer hübscher«, meinte Reni.
»Sag’s ihm nicht«, bat Denise im Scherz. »Er wird sonst eitel.«
Zwei Stunden später übersiedelte Reni von Hellendorf in das Haus der glücklichen Kinder. Sie erhielt ein freundlich eingerichtetes Zimmer und fand kaum Zeit, ihre Koffer auszupacken, denn das Turnier sollte sofort beginnen.
Irmela führte Reni zum Reitplatz, wo zwei Hindernisse aufgebaut waren. Zuerst waren die Kleinen an der Reihe. Sie ritten auf den Ponys und führten allerlei Kunststücke vor. Henrik, Vicky und ein paar andere Kinder wagten dann sogar die vorgeschriebenen Sprünge über die Hindernisse. Es gab viel Beifall und selbstverständlich eine hohe Punktwertung bei Reni und Justus, der ebenfalls Punktrichter war.
Für die größeren Kinder wurden die Hindernisse erhöht. Justus hatte sich einen richtigen Parcours ausgedacht und erklärte die Regeln. Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgten Kinder und Erwachsene die einzelnen Reiter. Im ersten Durchgang schafften sie es allesamt fehlerfrei. Also wurden die Bedingungen weiter erschwert. Nun zeigte sich deutlich, dass Irmela und Nick mit Abstand die besten Reiter waren.
Erst im dritten Durchgang gelang Nick ein knapper Sieg. Irmela war die Erste, die ihm gratulierte. Preise wurden bei solchen Gelegenheiten nicht vergeben. Man ritt um die Ehre.
»Ich möchte auch so reiten können wie Irmela«, sagte Manuela mit einem kleinen Seufzer zu ihrer großen Freundin Reni, von deren Seite sie die ganze Zeit nicht gewichen war. »Ob sie es mir zeigt?«
»Fragen wir sie doch. Ich reite auch gern, Manuela. Wenn du willst, versuchen wir es alle gemeinsam.«
Irmela erklärte sich sofort bereit, Manuela Unterricht zu erteilen. »Ich war geradeso alt wie du, als ich mit dem Reiten anfing«, meinte sie.
»Meine Mutti und mein Papi werden sich wundern, wenn sie wiederkommen«, erklärte Manuela.
Reni legte unwillkürlich die Hand auf Manuelas dunkles Haar. Der Gedanke, dass dieses Kind jemals von ihr getrennt werden könnte, erschreckte sie.
Henrik gesellte sich zu der kleinen Gruppe. Reni wandte sich sofort ihm zu, denn sie hatte Denises Hinweis nicht vergessen.
»Hoffentlich bist du mir nicht böse, Henrik, dass ich jetzt eine Zeit lang in Sophienlust wohnen möchte. Wir werden uns trotzdem jeden Tag sehen, denke ich.«
Henrik schluckte einmal. »Schad ist es schon, Tante Reni. Aber ich hab’ ja darüber nicht zu bestimmen.«
»Können wir nicht auch hier gute Freunde sein?«
»Das schon«, meinte der blonde Bub zögernd. »Aber hier sind so viele Kinder. In Schoeneich waren wir allein.«
Reni beugte sich nieder und umarmte Henrik. Es rührte sie, dass der Junge tatsächlich eifersüchtig war. »Ich besuche dich mal in Schoeneich. Dann trinken wir zwei allein zusammen Limonade«, versprach sie.
»Okay, Tante Reni«, versetzte Henrik. Doch man konnte ihm ansehen, dass er nur halb getröstet war.
Vom Haus her ertönte der Gong. Er rief groß und klein zum Essen. Man hatte für Reni von Hellendorf neben Manuela gedeckt. Henrik, der an diesem Tag ebenso wie Nick am Abendessen in Sophienlust teilnahm, saß an der anderen Seite der jungen Frau. Ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit durchströmte Renis Brust.
Ich werde mich von Manuela nie mehr trennen, beschloss sie, während sie so tat, als höre sie Henriks aufregender Erzählung von einem Fußballspiel in der Schule mit gespannter Aufmerksamkeit zu.
Nach dem Essen bestand Reni darauf, Manuela zu Bett zu bringen.
Das kleine Mädchen ließ sich nur zu gern von ihr umsorgen und verwöhnen. »Du machst es wie meine Mutti«, sagte es und schlang die weichen Ärmchen um Renis Hals.
Reni küsste das Kind, das nicht das ihre war.
Später am Abend fragte sie Frau Rennert, ob Manuels Eltern inzwischen geschrieben hätten.
»Nein, wir haben noch nichts gehört, Frau von Hellendorf. Allmählich muss man sich wohl Sorgen machen. Der Vater war schwerkrank. Ohne zwingenden Grund ruft man eine Frau nicht aus Deutschland nach Spanien. Denn das ist eine weite Reise. Wahrscheinlich werden wir demnächst versuchen, Erkundigungen in Barcelona einzuziehen. Das arme Kind würde mir leid tun, wenn auch der Mutter etwas zugestoßen wäre.«
Reni lächelte seltsam starr. »Ich würde Manuela zu mir nehmen, Frau Rennert. Sie würde bei mir bestimmt niemals etwas entbehren. So ein kleines Mädchen vergisst noch schnell. In ein paar Jahren würde sie nicht mehr an ihre Eltern denken.«
Frau Rennert hob warnend die Hand. »Noch wissen wir nichts über die Eltern, Frau von Hellendorf. Sie müssen auch damit rechnen, dass Herr und Frau Cortez eines Tages vor der Tür stehen und Manuela abholen. Auf jeden Fall dürfen Sie Manuela nicht schon jetzt als Waise betrachten.«
»Ich habe sie lieb, Frau Rennert«, flüsterte Reni mit abwesendem Blick. »Ihre eigenen Eltern können sie nicht mehr lieben als ich. Außerdem kann ich dem Kind eine ganz andere Zukunft bieten. Ich bin reich.«
»Man kann es jetzt nicht entscheiden, liebe Frau von Hellendorf«, versetzte Frau Rennert leise und geduldig. »Für den Augenblick ist Manuela glücklich, in Ihnen eine gute Freundin gefunden zu haben. Übrigens sprechen auch die anderen Kinder ganz begeistert von Ihnen, weil Sie Pferdeverstand haben und ein gerechter Punktrichter gewesen sind.«
»Ich bin froh, dass Sie mich ein bisschen mögen, Frau Rennert. Man möchte ja nicht stören. Irmela gefällt mir besonders gut. Erstaunlich, dass dieses Mädchen schon so feste Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft hat.«
»Ihr Vater war Arzt. Sie hörten wohl schon, dass er in Indien gestorben ist. Irmela will ihm nacheifern. Sie ist sehr zielstrebig in allem, was sie unternimmt. So glaube ich schon, dass sie eine gute Ärztin werden kann. Ihre Leistungen in der Schule sind ausgezeichnet, obwohl sie früher in Heidelberg Schwierigkeiten im Gymnasium hatte. Man ist dort wohl nicht in der richtigen Weise auf sie eingegangen.«
»Wie kam sie nach Sophienlust?«
»Durch Michael Langenbach. Seine Schwestern Angelika und Vicky sind hier im Heim. Michael studiert zusammen mit Sascha von Schoenecker in Heidelberg. Irmelas Mutter suchte einen Studenten als Nachhilfelehrer für ihre Tochter. So kam die Verbindung zustande. Jetzt braucht Irmela allerdings längst keinen Nachhilfeunterricht mehr.«
»Die Arbeit hier ist schön und interessant, nicht wahr?«
Frau Rennert nickte. »Ich bin glücklich, dass Frau von Schoenecker mir das Heim anvertraut hat. Wir Rennerts verdanken Sophienlust sehr viel. Auch mein Sohn fand hier als Haus- und Musiklehrer eine neue Lebensaufgabe. Und Carola, meine Schwiegertochter, gehörte mit zu den ersten Kindern, die hier Aufnahme fanden.«
»Vielleicht bleibe ich auch hier«, versetzte Reni leise. »Ich könnte mich ein wenig nützlich machen, wenn Sie einverstanden sind.«
»Wir freuen uns über jede Hand, die mithilft, Frau von Hellendorf. Es gibt immer etwas zu tun, und wenn es die vielen zerrissenen Sachen sind, die ausgebessert werden müssen. Manchmal wird auch dringend jemand gebraucht, der einem kleinen Patienten Geschichten vorliest. Kinder sind schwierig und bleiben nicht mehr brav unter der Decke liegen, sobald es ihnen ein bisschen besser geht.«
»Sagen Sie es mir nur getrost, wenn es etwas gibt, was ich übernehmen kann, liebe Frau Rennert. Jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Ob ich schnell noch einmal zu Manuela hineinschaue? Ich möchte ganz sicher sein, dass sie gut schläft.«
»Gehen Sie ruhig zu ihr, Frau von Hellendorf. Nötig ist es allerdings nicht. Manuela schläft immer wie ein Murmeltier.«
Reni überzeugte sich trotz dieser Versicherung selbst davon, dass Manuela schlief. Behutsam öffnete sie die Zimmertür. Vom Flur her fiel nur schwaches Licht in den Raum, in dem zwei Kinderbetten standen. In dem einen lag die kleine Heidi, im anderen Manuela.
Im Halbdunkel konnte Reni die Kinder nicht genau sehen. Sie stand wie gebannt und schaute auf Manuela, deren dunkles Haar sich deutlich vom weißen Kopfkissen abhob. »Meine Gitti«, flüsterte sie mit bebenden Lippen. »Ich habe dich wiedergefunden. Wir werden für immer beisammenbleiben.«
Sie beugte sich nieder und berührte die weiche Wange des schlafenden Kindes mit ihren Lippen. Manuela spürte nichts davon und bewegte sich nicht einmal in ihrem tiefen Schlaf.
Reni verließ das Zimmer und zog die Tür vorsichtig hinter sich zu. Sie fühlte sich seltsam glücklich. Ihr war, als habe sie eine neue Heimat gefunden. Daran, dass Manuelas Eltern zurückkehren und ihr Kind wieder zu sich holen könnten, dachte sie nicht. Die Warnungen von Frau Rennert waren ungehört verhallt.
*
Dr. Ulrich Volkert war noch nie in Sophienlust gewesen. Er betrachtete das eindrucksvolle Herrenhaus mit Interesse. Während er noch neben seinem Auto stand und an dem Gebäude emporblickte, trat Reni von Hellendorf aus der Tür, um ihn zu begrüßen.
»Wie gefällt es Ihnen, Doktor?«, fragte sie.
»Gut. Man stellt sich ein Kinderheim im Allgemeinen anders vor. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass man bei Frau von Schoenecker grundsätzlich auf etwas Ungewöhnliches gefasst sein muss.«
Reni erzählte ihm mit kurzen Worten, wie es zur Umgestaltung des Gutshauses gekommen war. »Meine Freundin Denise verwaltet das Erbe ihres Sohns, bis er es selbst übernehmen kann«, schloss sie ihren Bericht. »Das, was sie geschaffen hat, grenzt ans Wunderbare. Wollen Sie sich das Bild der Sophie von Wellentin einmal ansehen, nach deren Letztem Willen diese Stätte entstand?«
»Hm, interessieren würde es mich schon.«
»Kommen Sie, Doktor. Ich habe hier Hausrecht.«
Reni führte ihn durch die große Halle, die um diese Vormittagsstunde still und verlassen war, in Denises Biedermeierzimmer. Dieser Raum war früher der Lieblingsaufenthalt von Nicks Urgroßmutter gewesen. Denise hatte ihn ganz so gelassen, wie sie ihn bei ihrem Einzug vorgefunden hatte. Hier pflegte sie Besucher zu empfangen oder an dem zierlichen Sekretär Briefe zu erledigen, bei deren Abfassung sie ungestört sein wollte. In Stunden des Zweifels oder der Sorge hielt sie auch mit dem überaus lebendigen Porträt der letzten Herrin von Sophienlust Zwiesprache.
Auf dieses Gemälde wies Reni jetzt. »Das ist sie, Doktor.«
»Eine Frau mit einer großen Seele, möchte ich sagen. Sehen Sie nur, die Augen.«
»Denise von Schoenecker ist der festen Überzeugung, dass ihr Segen auf diesem Hause ruht. Auch ich fühle mich freier, seit ich hier sein darf.«
Dr. Volkert wandte sich seiner jungen Patientin zu. »Sie kamen auf eigenen Wunsch nach Sophienlust?«
»Ja, weil zwischen den Kindern ein kleines Mädchen ist, das mich an Gitti erinnert. Ich möchte ständig in der Nähe dieses Kindes sein. Denise erfüllte meine Bitte sofort. Gestern Abend, als ich im Dunkeln neben dem Bett der kleinen Manuela stand, war mir, als sei Gitti zu mir zurückgekehrt.«
»Eine Waise?«, fragte Ulrich Volkert.
»Vielleicht. Man weiß es nicht genau.«
Dr. Volkert nahm Renis Hand. »Wie stellen Sie sich die Zukunft vor, Frau Reni?«
»Niemand weiß, was morgen geschieht, Dr. Volkert. Hier in Sophienlust darf ich bleiben.« Etwas wie Angst stand dabei in ihren dunklen Augen.
»Gewiss dürfen Sie bleiben«, beruhigte der Arzt sie mit einem freundlichen Lächeln. »Es fragt sich nur, ob Sie es auch wollen.«
»Warum nicht? Frau Rennert, die Heimleiterin, oder Schwester Regine, die sich der Kleinen annimmt, haben hier eine Lebensaufgabe gefunden.«
»Das lässt sich nicht abstreiten. Es ist sogar eine schöne und unendlich wichtige Aufgabe, die diese Frauen erfüllen. Doch Ihr eigener Platz wird eines Tages nicht mehr hier sein.«
Reni zog ihre Hand zurück, die er fest in der seinen gehalten hatte. »Warum sagen Sie das?«, fuhr sie auf. »Sie wissen, dass ich nie nach Hellendorf zurückkehre. Mein Mann sollte endlich die Konsequenzen ziehen. Ich verlange wirklich nicht viel.«
»Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht wehtun.«
Ihr Gesicht entspannte sich etwas. »Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, dass Sie mich verstehen, Doktor«, flüsterte sie mit unsicherer Stimme.
»Ja, ich verstehe Sie, Frau Reni«, gab er ruhig zurück. »Wenn Sie Hilfe brauchen sollten, können Sie zu jeder Stunde auf mich zählen.«
Reni sah ihn an. In seinen Augen las sie Güte und Aufrichtigkeit. Von sich aus streckte sie ihm die Hand wieder hin. »Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen bedanken, lieber Doktor. Es ist schlimm, wenn man alles verloren hat. Vielleicht werde ich Sie schon bald um Ihre Hilfe bitten.«
»Ich bin immer für Sie da.« Doch zugleich besann Dr. Volkert sich auf seine zahlreichen anderen Pflichten. Er schaute auf die Uhr und äußerte mit leichtem Bedauern, dass er nun aufbrechen müsse. »Nur noch die Spritze, Frau Reni. Das geht ja rasch.« Er öffnete seine Bereitschaftstasche und bereitete die Injektion vor. Wie immer, war der Einstich für Reni kaum zu spüren.
»Brauche ich das Mittel wirklich?«, fragte sie ihn.
»Ich halte es für wichtig. Selbstverständlich werde ich Sie nicht gegen Ihren Willen weiterhin damit behandeln.«
»So meine ich es nicht. Ich vertraue Ihnen.«
»Das ist gut, Frau Reni. Morgen setzen wir einmal aus. Ich bin leider verhindert.«
Ein Schatten von Enttäuschung glitt über Renis Gesicht. »Schade. Ich rede gern jeden Tag ein Weilchen mit Ihnen. Bis übermorgen also, lieber Doktor.«
Ulrich Volkert packte seine Tasche ein und warf noch einen abschiednehmenden Blick auf das Bild Sophie von Wellentins.
»Ich begleite Sie, Doktor«, erklärte Reni, »denn ich will in den Pavillon draußen im Park. Dort spielen die noch nicht schulpflichtigen Kinder. Meine Manuela ist dabei.«
Der Arzt schwieg zu ihren Worten. Reni bemerkte nicht, dass er sich von ihrer Vorliebe für die kleine Manuela wenig Gutes versprach.
*
Denise saß mit Alexander vor dem Kamin von Schoeneich. Es hatte den ganzen Tag geregnet, und der Abend war kühl. Man wärmte sich also nur zu gern am Feuer.
Sascha war wieder in Heidelberg. Nick saß oben in seinem Zimmer und schrieb einen Aufsatz, der morgen abgeliefert werden musste, und Henrik schlief bereits.
Der Hausherr hatte eine Flasche Wein entkorkt und zwei Gläser gefüllt. »Auf dich, Isi«, sagte er und trank seiner Frau zu.
»Ich bin gar nicht zufrieden mit mir«, entgegnete sie mit ernstem Gesicht.
»Wo fehlt’s denn? Willst du mal wieder ein Wunder vollbringen und ärgerst dich, dass du für andere Leute nicht die Sterne vom Himmel holen kannst?«
Denise hob die Schultern. »Es geht um Reni, Alexander. Ich fürchte, es war ein Fehler, sie nach Sophienlust übersiedeln zu lassen.«
»Es wäre das erste Mal, Isi, dass Sophienlust sich ungünstig auswirken würde. Aber wenn Reni sich dort nicht wohlfühlt, kann sie doch jederzeit zu uns zurückkehren. Der Tag muss ohnehin kommen, an dem sie wieder nach Hellendorf geht.«
»Allmählich gebe ich die Hoffnung auf, Alexander. Sie scheint die Absicht zu haben, Sohienlust nie mehr zu verlassen. Sie flieht vor der Wirklichkeit. In der heilen geborgenen Welt von Sophienlust fühlt sie sich wie auf einer Insel, die von dem Schrecklichen, das sie erlebt hat, nicht erreicht werden kann. Die Begegnung mit der kleinen Manuela hat den Anstoß dazu gegeben. Inzwischen hat sich Reni völlig in ihre Vorstellungen versponnen. Ich sehe da eine tragische Entwicklung voraus und weiß nicht, wie ich sie aufhalten soll.«
»Was meint denn der Doktor?«
»Ich habe keinen rechten Mut mehr, mit ihm darüber zu sprechen, Alexander. Er kommt fast jeden Tag und unternimmt lange Spaziergänge mit Reni, sofern es das Wetter erlaubt. Man kann sich nur wundern, wie viel Zeit er für diese eine Patientin opfert. Nick machte heute Nachmittag eine seiner vorlauten Bemerkungen über die beiden.«
»Nick hört gern das Gras wachsen, Isi.«
»Ich bin nicht sicher, ob er so unrecht hat, Alexander. Er sagte in seiner schnodderigen Art, dass die nächste Hochzeit in Sophienlust bald fällig sei. Das hat mich ziemlich erschreckt. Immerhin ist Reni noch mit Bodo verheiratet. Bodo wartet auf sie und erträgt die Trennung mit bewundernswerter Geduld.«
»Das ist richtig. Allerdings lässt er sich wohl von Frau Berner trösten.«
Denise sah ihren Mann vorwurfsvoll an. »Nun bläst du ins gleiche Horn! Nick hatte bereits eine fertige Theorie, mit der ich jedoch ganz und gar nicht einverstanden bin. Zuerst eine Scheidung von Reni und Bodo, denn zwei Hochzeiten – eine in Hellendorf, die andere in Sophienlust. Danach würden Reni und der Doktor Manuela adoptieren. Für das kleine Mädchen wäre das doch das große Glück.«
»Warum findest du diese Lösung so schrecklich, Isi? Manchmal ist eine Scheidung unvermeidlich. Dann sollte man vernünftig sein und sie akzeptieren.«
»Ich glaube nicht daran, dass es zwischen Reni und Bodo keine Gemeinsamkeit mehr gibt. Wenn Dr. Volkert mehr für sich will als Renis Vertrauen als Patientin, dann enttäuscht er mich gewaltig. Man hört leider ab und zu davon, dass solche Beziehungen entstehen. Reni ist innerlich vereinsamt. Der Arzt, dem sie jeden Tag ihr Herz ausschütten kann, hat im Grunde ein leichtes Spiel bei ihr. Wenn er sich einmal in die hübsche Reni verliebt hat, wird er die Augen davor verschließen, dass sie krank ist. Doch die Liebe zu Bodo ruht tief verschüttet in ihr. Es wäre ein großes Unrecht, wenn Dr. Volkert das außer acht ließe.«
»In solchen Dingen bist du weiser als ich, Isi. Vielleicht hilft die Zeit.«
»Die Zeit kann auch alles schlimmer machen, Alexander. Ich sehe die Gefahr, dass Reni sich immer mehr von dem entfernt, was wirklich geschehen ist. Gestern hörte ich zufällig, dass sie Manuela heimlich Gitti nennt, wenn sie sich unbeobachtet glaubt.«
»Solltest du das nicht dem Arzt andeuten, Isi?«
»Ja, das wäre wohl richtig. Wenn ich ihm noch voll vertraute, hätte ich es schon getan. Ich habe es gut gemeint, als ich Reni bei mir behalten wollte. Jetzt kommt es mir fast so vor, als wäre sie in einer Klinik besser aufgehoben gewesen.«
Alexander stand auf und umarmte seine Frau. »Du darfst nicht verzagen, Isi. Sollten Manuelas Eltern sich melden, wird Reni sich sowieso von der Kleinen trennen müssen. Vielleicht wird ihr das die Augen öffnen. Es gibt auch Schocks, die heilsam sind.«
»Wir haben schon allerlei versucht, um eine Nachricht von Manuelas Eltern zu erhalten. Bis jetzt konnten wir nichts erfahren. Frau Cortez hat nicht den Eindruck auf mich gemacht, dass sie ihr Töchterchen gewissermaßen abschieben möchte. Deshalb muss man wohl befürchten, dass etwas Unvorhergesehenes geschehen ist.«
»Wir wollen nicht gleich das Schlimmste befürchten, Isi. Manuelas Eltern sind einfache Menschen, die wahrscheinlich so gut wie nie Briefe schreiben. Ich halte es für denkbar, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, uns eine Nachricht zu schicken.«
»Ich hätte mir die Anschrift geben lassen müssen. Das war mein Fehler.«
»Du sollst dir keine Vorwürfe machen, Isi. Denke nicht mehr darüber nach. Du weißt sehr gut, dass man nicht Schicksal spielen kann. Frau Berner ist wahrscheinlich alles andere als glücklich in ihrer Einsamkeit. Für sie wäre es wohl die große Erfüllung, wenn sie Bodos Frau werden könnte. Ich bin nicht so schockiert über diese Vorstellung wie du.«
Denise schmiegte sich enger an Alexander. »Ich fühle, dass Reni und Bodo zusammengehören, Alexander. So sehr kann ich mich nicht täuschen. Glaub mir.«
Alexander nahm ihr Glas und hielt es ihr an die Lippen. »Trink, Isi. Versuche Sophienlust mal für eine Stunde zu vergessen. Du verlangst zu viel von dir.«
Denise nahm gehorsam ein paar Schlucke von dem köstlichen, alten Burgunder. »Armer Alexander«, meinte sie mit müdem Lächeln. »Du hast nicht viel von mir. Wenn wir tatsächlich einmal ungestört beisammen sind, ist die Rede doch immer nur von Sophienlust.«
»Du und Sophienlust – das ist nicht mehr zu trennen, Isi. Aber ohne Sophienlust hätte ich dich nicht kennen gelernt. Ich beklagte mich nicht. Bis jetzt bin ich trotzdem zu meinem Recht gekommen.«
»Du bist der beste Kamerad der Welt, Alexander.«
Dankbar verschloss er ihr den Mund mit seinen Lippen.
*
Asta Berner erschien ohne Anmeldung, denn sie hatte befürchtet, dass Reni ihren Besuch ablehnen würde.
Frau Rennert empfing sie freundlich und sagte ihr, dass Reni von Hellendorf im Pavillon mit den Kindern spiele. Ob sie sie rufen lassen solle?
»Nein, danke«, sagte Asta rasch. »Ich glaube, ich werde den Weg selber finden. Warum soll ich Ihnen unnötige Mühe machen?«
Der Pavillon war nicht zu verfehlen, denn seine Fenster und Türen standen offen, und der fröhliche Lärm der spielenden Kinder war weithin zu hören.
Reni kniete am Boden und war eifrig damit beschäftigt, aus Plastikbauteilen ein Schloss zu errichten. Ein schwarzhaariges kleines Mädchen half ihr dabei. Asta wusste sogleich, dass dies Manuela sein musste.
»Grüß dich, Reni.«
Reni sah auf. Sie schien nur langsam aus einer anderen Welt in die Wirklichkeit zurückzukehren.
»Asta«, sagte sie endlich. »Dich habe ich wahrhaftig nicht erwartet. Wie geht es dir?«
»Danke, gut. Hast du ein bisschen Zeit? Ich würde mich gern mit dir unterhalten.«
»Wer schickt dich?«, fragte Reni misstrauisch.
»Niemand, Reni.« Astas Worte klangen so ruhig und bestimmt, dass die junge Frau ihr glauben musste.
»Du kannst den Turm allein weiterbauen, Gitti«, flüsterte Reni Manuela zu. »Nachher komme ich zurück und helfe dir beim Dach.«
»Ja, Tante Reni.«
Asta hatte deutlich verstanden, dass Reni dem Kind den Namen ihres verstorbenen Töchterchens gegeben hatte. Ein Schauer rann durch ihren Körper.
Reni kam auf sie zu und reichte ihr die Hand.
»Wir können ins Haus gehen, wenn du willst. Ich finde es nett von dir, dass du mich einmal besuchst.«
»Wir haben uns lange nicht gesehen, Reni. Es kam mir vor, als könnte mein Besuch wichtig sein.«
Die Frau mit dem dunklen Haar antwortete nicht. Ihr Blick war starr in die Ferne gerichtet, als gebe es dort etwas, was nur sie sehen konnte.
Wieder einmal fand ein Gespräch im Biedermeierzimmer unter dem Porträt der früheren Herrin von Sophienlust statt.
»Wie geht es dir?«, fragte Asta tastend und vorsichtig. »Dr. Volkert behandelt dich noch?«
»Ja, er ist fast jeden Tag hier. Ich glaube zwar nicht, dass ich die Behandlung noch nötig habe, aber ich kann mich wunderbar mit ihm aussprechen. Nie im Leben hatte ich einen besseren Freund als ihn.«
»Ich habe ihn kennen gelernt. Er scheint ein sympathischer, gewissenhafter Arzt zu sein.«
»Vor allem quält er mich nicht damit, dass er von mir verlangt, nach Hellendorf zurückzukehren. Ich habe erreicht, dass dieses Thema völlig tabu ist. Er hat eingesehen, dass ich mich von der Vergangenheit lösen muss. Hier in Sophienlust sind die besten Voraussetzungen dafür gegeben. Hast du die kleine Manuela im Pavillon gesehen? Ist ihre Ähnlichkeit mit Gitti nicht erstaunlich?«
»Nun ja, ein wenig gleicht sie ihr«, gab Asta zögernd zu. »Ihre Eltern sind verschollen. Ich werde das Kind adoptieren. Dazu bin ich ganz fest entschlossen. Manuela wird Gittis Platz einnehmen.«
»Willst du sie nach Hellendorf bringen?«, wagte Asta zu fragen.
Reni bekam zornrote Wangen. »Hast du mich denn nicht verstanden?«, fuhr sie unfreundlich auf. »Ich gehe nicht mehr nach Hellendorf.«
»Reni – Bodo hat keine Schuld an Gittis Tod. Einmal musst du das begreifen und dir klarmachen. Gitti war krank. Ihr Herz hat versagt. Das wäre auch unter anderen Umständen geschehen.«
»Du brauchst dir keine Mühe zu geben, Asta. In deinen Augen ist Bodo natürlich ohne Fehl. Du hast ihn immer geliebt.«
Asta wurde blass. »Du kannst fragen, wen du willst. Sprich doch mit den Ärzten, die die Todesursache festgestellt haben.«
»Ist jemand von diesen Leuten dabei gewesen? Hast du selbst es etwa mitangesehen?«, stieß Reni ungeduldig hervor.
»Wenn du nur gekommen bist, um mich von Bodos Unschuld zu überzeugen, dann ist es am besten, du setzt dich gleich wieder ins Auto und fährst weg. Mag sein, dass ich sehr hart bin. Aber ich kann es ihm nicht verzeihen.«
»Glaubst du denn, er hätte es mit Absicht getan?«, flüsterte Asta bestürzt.
»Nein, aber er hat nichts unternommen, um Gitti zu retten. Das ist genauso schlimm. Ich verlange die Scheidung. Das kann dir doch nur recht sein, Asta.«
»Ich will nicht, dass ihr euch scheiden lasst. Auch Bodo ist gegen die Scheidung. Er wartet auf dich. Deshalb bin ich hier.«
»Er soll nicht mehr warten. In Hellendorf würde mich jede Kleinigkeit an die Vergangenheit erinnern. Es wäre unerträglich für mich. Soll ich etwa wieder mit Bodo am gleichen Tisch sitzen? Erwartest du das wirklich von mir?« Ihre Stimme klang nun schrill und überschlug sich zuletzt.
Asta erkannte unschwer, dass Renis Gemüt noch immer von Grund auf verstört war. Diese Gewissheit legte sich ihr schwer auf die Seele.
»Ich werde Bodo nicht heiraten, Reni«, erklärte sie so ruhig wie möglich.
»Auch Bodo denkt nicht an eine Ehe mit mir. Er ist verheiratet – und zwar mit dir.«
»Dann werden wir getrennt leben. Mir ist das gleichgültig. Ich dachte an dich bei diesem Vorschlag. Auch Bodo ist nicht der Mann, der allein bleiben sollte. Es soll keine Strafe oder Vergeltung sein. Aber ihr müsst euch damit abfinden, dass es für mich kein Zurück nach Hellendorf und zu Bodo geben kann.«
»Auf Bodo wirkt es sich dennoch wie eine furchtbare Strafe aus. Auch er trauert um Gitti, nicht weniger als du. Für ihn kommt hinzu, dass er allein ist.«
»Du bist doch bei ihm, Asta. Auch ich bin zu guten Freunden gegangen. Ich kann Bodo nicht helfen. Ich will es auch gar nicht.«
Asta blickte Reni ratlos an. Sie war mit dem festen Entschluss nach Sophienlust gekommen, Reni mitzunehmen und nach Hellendorf zurückzubringen. Nun musste sie einsehen, dass mit Reni nicht zu reden war.
»Wie stellst du dir deine eigene Zukunft vor?«, fragte sie nach einer Weile mutlos.
»Zunächst bleibe ich in Sophienlust. Später werde ich Manuela mitnehmen. Ich muss abwarten, was aus ihren Eltern geworden ist.«
»Soll ich Bodo etwas von dir ausrichten?«
»Sag ihm, dass ich ihn um die Scheidung bitte. Das ist das einzige, das er noch für mich tun kann.«
Asta kämpfte mit den Tränen. »Es tut mir leid, Reni. Ich bin vergeblich gekommen. Kann ich dir helfen?«
»Du meinst es gut, Asta. Außerdem glaubst du, dass es nicht anständig wäre, Bodos Frau zu werden. Aber du brauchst dich nicht zu schämen. Von mir wirst du nie einen Vorwurf zu hören bekommen.«
»Du irrst dich, Reni. Ich würde Bodo selbst dann nicht heiraten, wenn er tatsächlich frei wäre.«
»Liebst du ihn nicht mehr?« Reni fragte es mit großer Verwunderung. »Ich hätte geschworen, dass du nie aufgehört hast, ihn zu lieben.«
»Es ist nicht leicht, diese Frage zu beantworten, Reni. Ich fühle mich Bodo innerlich stark verbunden. Das abzustreiten, wäre eine Lüge. Trotzdem könnte ich ihn nicht heiraten.«
»Überdenke es noch einmal gründlich«, riet Reni ihr.
»Du bist die geborene Gutsherrin. Wahrscheinlich passt du besser nach Hellendorf als ich.«
»Es gibt nur eine Herrin von Hellendorf. Die bist du. Leb wohl, Reni. Dieses Gespräch hat mich sehr traurig gemacht.«
»Du hättest es dir und mir ersparen können, Asta.«
Sie reichten einander die Hände, höflich und kühl.
Reni begleitete Asta zu ihrem Wagen. Danach lief sie zum Pavillon, wo Manuela inzwischen den Schlossturm aus Plastikteilchen um ein ganzes Stück erhöht hatte.
»Fein, Gitti«, lobte sie das Kind und ließ sich wieder auf dem Fußboden nieder. »Jetzt bauen wir das Dach.«
»Was wollte die fremde Dame von dir, Tante Reni?«, fragte Manuela mit blanken neugierigen Augen.
»Nichts Besonderes, Gittilein. Es war ganz unwichtig. Jetzt ist sie längst wieder weg.«
Reni begann eine kunstvolle Dachkonstruktion zu errichten. Darüber geriet Asta Berners kurzer Besuch rasch wieder in Vergessenheit.
Am Nachmittag, als die Schulkinder wieder da waren, ritt Reni mit Irmela, Pünktchen und Manuela ein Stück durch den Wald. Manuela fühlte sich nun schon ziemlich sicher auf dem Rücken ihres flinken Ponys.
»Wenn du bei mir bleibst, bekommst du später ein richtiges großes Pferd, damit du reiten lernst wie Irmela«, versprach Reni dem kleinen Mädchen, als sie die Tiere wieder in den Stall führten.
»Warum soll ich bei dir bleiben, Tante Reni?«, fragte Manuela mit großen Augen. »Mutti und Papa holen mich nämlich wieder ab. Ich weiß bloß nicht, wie lange es dauert.«
Reni legte einen Arm um Manuela. »Hast du mich lieb, meine kleine Gitti?«, raunte sie ihr ins Ohr.
»Hm, lieb schon, Tante Reni. Ich spiele auch gern mit dir, dass ich Gitti heiße. Aber in Wirklichkeit bin ich die Manuela.«
»Natürlich, mein Kleines.«
Ich muss noch ein Weilchen Geduld haben, dachte Reni und wollte sich nicht eingestehen, dass sie vorläufig bei Manuela nichts erreicht hatte.
*
»Es tut mir leid, Bodo. Ich habe nichts erreicht bei Reni. Sie ist seelisch gestört. Ob Dr. Volkert überhaupt schon einen Fortschritt bei ihr erzielt hat, scheint mir fraglich.«
»Er soll ausgezeichnet sein, Asta. Man darf wohl keine Wunder erwarten.« Bodo von Hellendorf war in diesen kurzen Wochen abgemagert und litt unter Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Zwar versah er seine Pflichten als Gutsherr gewissenhaft, doch tat er diese Arbeiten nur aus Gewohnheit und rein automatisch. Wenn es Abend wurde, saß er in seinem Zimmer und grübelte. Oft zog das Licht des neuen Tages schon am Horizont herauf, wenn er endlich die Lampe löschte und zu Bett ging. Er war Asta dankbar, dass sie so oft wie möglich zu ihm nach Hellendorf kam. Denn er hatte sonst keinen Menschen, mit dem er über die Dinge, die ihn bedrückten, sprechen konnte.
Asta schüttelte ungeduldig den Kopf. »Aber es kann nicht so weitergehen, Bodo. Reni hat sich in die fixe Idee verrannt, das Kind der spanischen Arbeiterfamilie, das ein wenig an Gitti erinnert und auch etwa im gleichen Alter ist, zu sich zu nehmen?«
»Wäre das nicht ein Ausweg und Trost?«, fragte Bodo. »Handelt es sich um eine Waise?«
»Das steht nicht fest. Man forscht nach den Eltern. Der Vater war schwer erkrankt. Die Mutter wurde telegrafisch nach Barcelona gerufen. Seither haben die beiden nichts von sich hören lassen. Reni rechnet fest damit, dass sie das Kind für sich beanspruchen kann. Es ist möglich, dass sie Recht hat. Ich kann es nicht beurteilen.«
»Wenn es Renis Wunsch ist, so hätte ich gegen eine Adoption absolut nichts einzuwenden. Im Gegenteil, ich wäre auch dafür.« Bodos Stimme klang etwas lebhafter als gewöhnlich.
»Reni will die Kleine nicht nach Hellendorf bringen, Bodo«, erklärte Asta leise und zögernd. »Sie wurde sehr ärgerlich, als ich diese Vermutung äußerte. Nach wie vor fordert sie von dir die Scheidung. Ich soll dir ausrichten, dass sie nie wieder einen Fuß nach Hellendorf setzen wird.«
Bodos Gesicht wurde noch um einen Schein blasser. Die Linien von Sorge und Leid, die sich darin eingegraben hatten, traten deutlicher hervor.
»Was soll ich tun, Asta?«, fragte er mit einem schmerzlichen Seufzer. »Muss ich nachgeben und Renis Bitte erfüllen, oder ist es meine Pflicht, abzuwarten? Gibt sie mir auch heute noch die Schuld an Gittis Tod? Habt ihr darüber reden können?«
»Ich versuchte es. Aber Reni ist völlig unzugänglich. Man redet gegen eine Wand.«
»Ich sehe allmählich keinen Ausweg mehr aus unserer Lage, Asta. Vielleicht ist es falsch, dass ich mich gegen die Scheidung wehre. Reni will von mir los, und ich lasse es nicht zu. Es wäre sogar denkbar, dass sie erst dann gesund werden kann, wenn sie frei ist.«
Es war dunkel draußen, doch im großen Wohnzimmer des Gutshauses von Hellendorf brannte die Lampe und verbreitete helle Gemütlichkeit. Zwei Weingläser standen auf dem Tisch, dazu eine Schale mit Käsegebäck und Früchten, die Emmi zurechtgemacht hatte.
Bodo stand aus seinem tiefen Ledersessel auf und trat dicht vor Asta hin. Schwer legten sich seine Hände auf ihre Schultern. »Ich hätte diese Zeit kaum überstanden ohne dich, Asta«, kam es mühsam über seine Lippen. »Den Dank, den ich dir schulde, werde ich wohl nie abtragen können. Ich muss mich jetzt fragen, ob meine Ehe mit Reni ein Irrtum war. Sollten Mann und Frau nicht zusammenhalten, wenn etwas so Schreckliches geschieht? Ist Renis Verhalten nicht der Beweis dafür, dass sie mir kein Vertrauen schenken kann?«
Asta versuchte sich zu befreien, doch es war ihr unmöglich. Deutlich wurde ihr bewusst, dass Bodo den Zustand des Wartens und der Ungewissheit nicht mehr ertrug. Auch sagte ihr eine innere Stimme, dass er um sie werben wolle, falls er Reni verlieren sollte. Deshalb erschrak sie sehr. Was sie Reni gegenüber erklärt hatte, war die reine Wahrheit. Sie wollte Bodo nicht heiraten. Hatte sie einen Fehler begangen, indem sie allzu oft nach Hellendorf gefahren war?
»Reni ist krank, Bodo«, flüsterte sie mit versagender Stimme. »Du darfst nicht auf sie hören. Du liebst sie doch.«
»Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, Asta. Irgendwo kommt für jeden die Grenze des Erträglichen. Bei mir ist sie fast erreicht. Wenn nicht bald eine Wendung eintritt, werde ich mich mit Reni in Verbindung setzen und jede ihrer Bedingungen in Bezug auf eine Scheidung erfüllen. Allerdings würde ich dann nicht mehr allein bleiben. Ich würde dich …«
Nun gelang es Asta, sich mit einer raschen Bewegung von den auf ihren Schultern lastenden Händen zu befreien und aufzuspringen.
»Du darfst nicht weitersprechen, Bodo. Ich könnte sonst nicht wiederkommen«, rief sie aus, ehe er seinen Satz vollenden konnte.
Traurig sah er sie an. »Asta, wir waren doch einmal miteinander verlobt«, sagte er leise. »Hast du das vergessen?«
»Es ist viel zu lange her, Bodo. Verzeih mir, bitte. Ich bin bereit, über deine Sorgen mit dir zu sprechen. Aber von der Scheidung will ich kein einziges Wort mehr hören. Es ist hart für dich. Niemand weiß das besser als ich. Trotzdem glaube ich fest daran, dass es am Ende einen Weg geben wird, der Reni und dich wieder zusammenführt.«
»Warum willst du mir nicht helfen, Asta? Ich brauche dich. So, wie ich jetzt lebe, kann es nicht weitergehen.«
Asta wandte sich ab, damit er ihre Tränen nicht sehen konnte. Sie brauchte all ihre Kraft, um sich zu fassen. Endlich konnte sie den Freund wieder mit klarem Blick anschauen.
»Man muss sein Schicksal annehmen, Bodo. Du würdest es dir später nicht verzeihen, wenn du Reni heute im Stich ließest.«
»Kann ich denn noch irgendetwas für sie tun? Quälen wir uns nicht gegenseitig?«
»Geduld kommt von Dulden, Bodo. Es ist manchmal schwerer, still abzuwarten und nichts zu tun, als mit beiden Händen zuzugreifen, um Berge zu versetzen.«
Er ging mit langen unruhigen Schritten durchs Zimmer. »Ich bin nicht so weise wie du, Asta. Außerdem nehme ich dir das, was du sagst, nicht ab. Warum bist du denn immer wieder zu mir gekommen?«
»Diese Fragen kann ich beantworten, Bodo. Aus Freundschaft zu Reni und dir. Einen anderen Grund gibt es nicht.«
»Was würdest du tun, wenn wir geschieden wären?«, drängte er.
»Ich weigere mich, mir das vorzustellen, Bodo. Denn ich könnte dann nicht mehr hierherkommen.« Ihre Stimme bebte. Es fiel ihr schwer, ihre innere Erregung zu meistern. Doch sie fasste sich rasch und streckte ihm die Hand hin. »Es wird spät, Bodo. Ich möchte nach Hause.«
Er ergriff ihre Hand und legte seine Lippen darauf.
»Nicht, Bodo.«
Ein müdes Lächeln ließ seine Züge fast noch trauriger erscheinen. »Das kannst du mir nicht verbieten, Asta. Ich danke dir für alles, was du für mich tust.«
Er begleitete sie hinaus bis zu ihrem Wagen. »Telefonieren wir?«
»Ja, du kannst mich anrufen, Bodo. Leb wohl!«
»Gute Fahrt, Asta. Sei vorsichtig.«
Sie ließ den Motor an und hob ein letztes Mal abschiednehmend die Hand. Er blieb regungslos in der Dunkelheit stehen, auch dann noch, als ihr Wagen schon längst nicht mehr zu sehen war.
*
Dr. Ulrich Volkert war überrascht, als Asta Berner sein Sprechzimmer betrat. Sie hatte mit einigen Patienten im Wartezimmer gewartet.
»Ich hoffe, Sie sind nicht krank, Frau Berner«, begrüßte er sie, indem er von seinem Stuhl aufstand und ihr beide Hände herzlich entgegenstreckte. »Das täte mir aufrichtig leid.«
»Ich bin nicht als Patientin hier, lieber Doktor«, erwiderte Asta leise.
Er bot ihr den Sessel hinter dem Schreibtisch an und nahm selbst wieder Platz. »Geht es um Frau von Hellendorf?«, fragte er.
»Ja, Doktor. Ich befinde mich in einem Zwiespalt und bitte um Ihren Rat. Es ist erschreckend, wenn man sich bemüht, etwas Gutes zu tun, und wenn am Ende dabei das Gegenteil herauskommt. Ich fürchte, dass ich in bester Absicht einen argen Fehler begangen habe.«
Dr. Volkert hob ein wenig die Hand. »Nun, gar so schlimm ist es sicherlich nicht. Ein Mensch mit Ihrer Lebensauffassung ist gar nicht fähig, das Gegenteil vom Guten – also etwas Böses – zu bewirken.«
»Sie haben eine allzu hohe Meinung von mir«, widersprach Asta verwirrt. »Wie Sie wissen, besteht zwischen den Hellendorfs und mir eine Freundschaft. Als Freundin fühlte ich die Pflicht, mich um Bodo von Hellendorf zu kümmern. Schließlich befindet er sich in einer äußerst tragischen Situation.«
»Das ist richtig. Sicherlich ist ihm Ihre Freundschaft eine echte Hilfe, Frau Berner. Wir sprachen schon darüber, als ich bei Ihnen war.«
Asta spielte mit nervösen Fingern am Schloss ihrer Handtasche. »Inzwischen ist insofern eine Änderung eingetreten, als ich nochmals bei Reni von Hellendorf war. Ich wollte versuchen, sie endlich nach Hellendorf zurückzuholen, und glaubte ganz zuversichtlich, dass mir das gelingen würde.«
Ulrich Volkert machte eine rasche Bewegung, die verriet, dass er hiervon nichts gewusst hatte. »Davon hat mir Frau von Hellendorf nichts erzählt«, äußerte er verwundert. »Auch als Arzt irrt man sich. Ich glaubte bisher, dass sie mir gegenüber stets ganz offen sei.«
»Mag sein, dass sie unser Gespräch so rasch wie möglich aus ihrer Erinnerung verdrängen wollte. Mich hat die Begegnung mit meiner Freundin tief erschüttert. Wer sie nicht näher kennt, könnte glauben, sie wäre gesund. In Wirklichkeit aber besteht bei ihr eine entsetzliche Störung des Gemüts. Oder irre ich mich darin?«
»Sie haben recht, Frau Berner. Ich muss sogar hinzufügen, dass bisher keinerlei Fortschritt zu verzeichnen ist.«
»Sie klammert sich jetzt an das kleine Mädchen, dessen Eltern möglicherweise verschollen sind. Mir erscheint es erschreckend und unheimlich, dass sie das Kind mit dem Vornamen ihrer eigenen Tochter anredet. Zufällig hörte ich es, obwohl sie sehr leise sprach.«
»Ich wünschte, Frau von Hellendorf hätte die kleine Manuela nie kennen gelernt. Jetzt darf man sie natürlich nicht gewaltsam von dem Kind trennen. Das könnte zu einer Katastrophe führen. Reni von Hellendorf ist sehr krank. Leider muss ich das sagen. Ein unerwartetes Ereignis könnte ganz plötzlich eine Krise bei ihr auslösen und sie zu Kurzschlusshandlungen verleiten. Man kann so etwas weder voraussehen noch verhindern. An und für sich ist die Atmosphäre von Sophienlust der einer Nervenklinik in jedem Fall vorzuziehen. Es ist außerordentlich großzügig von Frau von Schoenecker, dass sie diese Last und Verantwortung auf sich nimmt. Aber wir können nur hoffen und wünschen, dass sich so viel Hilfsbereitschaft und guter Wille am Ende zum Segen für unsere Patientin auswirkt.«
Astas Gesicht verschattete sich kummervoll. »Bis jetzt sieht es nicht so aus, Doktor. Mein Besuch war ein völliger Misserfolg. Reni verlangte von mir, dass ich ihren Mann veranlassen solle, die Scheidung zu erwirken.«
»Das war zu befürchten. Ich schneide dieses Thema absichtlich nicht an zurzeit. Man macht damit nichts besser. Hat es sie sehr erregt?«
»Ja, sie wurde richtig zornig. Sie wiederholte auch, dass ich ihren Mann heiraten solle.« Asta verfärbte sich bei diesen Worten. Auf ihren Wangen zeichneten sich tiefrote Flecken ab.
»Sie will auf diese Weise das Tor zur Vergangenheit endgültig zuschlagen. Was haben Sie geantwortet?«
»Nichts anderes als bei unserem ersten Gespräch über diese absurde Idee von ihr. Es hat sich auch nichts an meiner Einstellung geändert.«
»Sie sind zu bewundern, Frau Berner. Nicht jede Frau würde sich in dieser Lage so verhalten.«
Asta hob die Schultern. »Das weiß ich nicht, Doktor. Für mich bedeutet es nur eine Selbstverständlichkeit. Grund zur Bewunderung ist durchaus nicht vorhanden. Ich halte eine Ehe nicht für den einzigen Weg ins Glück. Freundschaft und Liebe sind zweierlei. Aber ich glaube nach wie vor an die Liebe zwischen Bodo und Reni von Hellendorf.«
»Denken Sie niemals an sich selbst, Frau Berner?«, warf der Arzt leise ein.
»Vielleicht doch«, entgegnete sie bedächtig. »Ich habe den Wunsch, die Achtung vor mir selbst nicht zu verlieren. Gar so selbstlos, wie Sie meinen, bin ich nicht.«
»Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie mir dies alles erzählt haben, Frau Berner. Es bestätigt meine eigenen Beobachtungen und meine Diagnose.«
»Trotzdem ist es nicht der eigentliche Grund meines Besuches, lieber Doktor. Ich kam wegen Bodo von Hellendorf.«
»Sie machen sich Sorge um ihn? Halten seine Nerven der Belastung nicht mehr stand? Denkbar wäre das durchaus.«
»Er ist sehr herunter, kann nachts nicht schlafen und glaubt, dass er den augenblicklichen Zustand nicht mehr ertragen könne. Gestern Abend erschreckte er mich mit dem Plan, dem Drängen seiner Frau nachzugeben und die Scheidung zu verwirklichen. Außerdem deutete er unmissverständlich an, dass er dann nicht allein bleiben, sondern mich heiraten möchte. Ich schwöre Ihnen, dass das nicht meine Absicht war. Trotzdem ist das ständige Zusammensein mit mir für meinen Freund zur Gefahr geworden. Was soll ich jetzt tun? Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, weiterhin zu ihm zu fahren? Wie aber würde es ausgehen, wenn ich ihn gerade jetzt plötzlich im Stich ließe? Wo ist die Grenze? Was soll werden, wenn er gänzlich verzweifelt?«
Ulrich Volkert atmete rascher. Das, was Asta Berner ihm mitteilte, bewegte ihn. Er kannte Bodo von Hellendorf und wusste um die doppelte Belastung, die er zu ertragen hatte. Als Arzt war ihm klar, dass eine plötzliche Abwendung Asta Berners für den hart geprüften Mann eine Gefahr werden konnte. Bodo von Hellendorf befand sich nach Dr. Volkerts Beobachtungen ohnehin in einem depressiven Zustand, was eine Folge der tragischen Ereignisse, die ihn getroffen hatten, war.
»Ihr Freund braucht Sie, Frau Berner«, erklärte Dr. Volkert schließlich. »Trotz Ihrer Bedenken dürfen Sie ihn zum jetzigen Zeitpunkt nicht allein lassen.«
»Bedeutet es nicht, dass ich zwischen ihm und Reni stehe? Genau das möchte ich um jeden Preis vermeiden.«
»Solange Sie nichts für sich selbst wollen, können Sie das Paar nicht trennen, Frau Berner. Ich halte Sie für eine Frau mit einer starken Seele und einem großen Herzen. Es wird Ihnen möglich sein, Herrn von Hellendorf auch weiterhin zur Seite zu stehen. Einen guten Freund, der in Not ist, darf man nicht ohne Zuspruch lassen.«
»Sie haben viel Vertrauen zu mir, Doktor. Haben Sie denn Hoffnung, dass meine Freundin eines Tages nach Hellendorf zurückkehrt?«
»Wir Ärzte hoffen immer, Frau Berner. Nur verlangen Sie bitte nicht von mir, dass ich genaue Prognosen stelle. Ich kann es nicht. So bitter es sein mag – wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass sehr, sehr viel Zeit verstreichen kann, bis die Patientin so weit ist, dass sie den Verlust ihres Kindes akzeptiert und ihr Schicksal annimmt.«
»Gibt es Fälle, in denen eine Heilung unmöglich ist, Doktor«, wagte Asta zu fragen.
Ulrich Volkert neigte den Kopf.
»Ja, es gibt solche Fälle. Es wäre leichtfertig, wenn ich Ihnen das verheimlichte. Trotzdem haben wir nicht das Recht, die Hoffnung aufzugeben. Der Fall von Frau von Hellendorf beschäftigt mich ganz besonders. Gerade deshalb möchte ich Sie bitten, ihrem Mann jetzt nicht aus dem Weg zu gehen. Man kann das Thema vermeiden, wie ich es auch bei Frau von Hellendorf tue. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und seine Freundschaft zu beweisen. Richten Sie sein Interesse auf den Gutsbetrieb, auf das Tagesgeschehen. Versuchen Sie ihn auch davon abzubringen, dass er sich ständig nur mit seinem schweren Problem beschäftigt, das im Augenblick doch nicht zu lösen ist.«
»Ist Ablenkung denn eine Hilfe?«, zweifelte die gewissenhafte Asta. »Muss man sich nicht letzten Endes mit dem Schicksal auseinandersetzen?«
»Letzten Endes, Frau Berner. Aber wir sind noch nicht am Ende. Möglicherweise stehen wir in diesem Fall sogar erst am Anfang.«
»Dann will ich es also versuchen«, erklärte Asta mit einem tiefen Aufatmen.
»Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung, wenn Sie sich aussprechen möchten. Dass es eine schwere Aufgabe ist, die Sie übernehmen, weiß niemand besser als ich.«
Asta erhob sich. Dr. Volkert beugte sich über ihre Hand. »Gibt es so etwas wie eine Freundschaft zwischen uns?«, fragte er mit unerwarteter Herzlichkeit. »Ich wäre darüber sehr glücklich.«
»Sonst wäre ich wohl nicht zu Ihnen gekommen, Doktor.«
Er begleitete sie persönlich bis zur Tür. Dann kehrte er in sein Ordinationszimmer zurück und saß ein paar Minuten regungslos hinter seinem Schreibtisch, die Augen geschlossen, die Hände zusammengelegt wie zum Gebet. Niemand sollte wissen, dass er diese Frau tief verehrte. Nein, mehr als das.
Endlich drückte er auf den Knopf, der seiner Helferin signalisierte, dass er bereit sei, den nächsten Patienten zu empfangen.
*
Der Zug war voll besetzt, die Reise lang. Unter den vielen Fahrgästen aus Spanien, die nach Deutschland wollten, weil es dort Arbeit und besseren Verdienst für sie gab, waren zwei Menschen, denen die Strapazen dieser unbequemen Fahrt rein gar nichts auszumachen schienen. Maria und Fernando Cortez saßen so eng aneinandergeschmiegt wie ein Paar auf der Hochzeitsreise. Sie hielten sich bei den Händen und sprachen meist so leise miteinander, dass die anderen sie nicht verstehen konnten.
»Ein Segen, dass du die Miete im Voraus bezahlt hast, Maria«, sagte Fernando. »Du bist eine kluge Frau.«
»Sie haben mir auch versprochen, dass ich die Arbeit am Gymnasium wiederbekomme.«
»Wie es bei mir wird, weiß ich nicht genau«, entgegnete der Mann, dem man die eben überstandene schwere Krankheit noch ansah, ein wenig besorgt. »Aber ich habe die Papiere mit. Darin steht, dass ich krank geworden bin. Ich glaube, dass die deutschen Firmen ihre Leute nicht entlassen, wenn sie krank werden.«
»Warten wir es ab, Fernando. Als wir das erste Mal nach Deutschland fuhren, war alles viel unsicherer. Jetzt hast du eine Arbeitserlaubnis. Es wird sich bestimmt etwas für dich finden. Ich muss immerzu an Manuela denken. Die Dame war so lieb.«
»Ein Schloss ist es, nicht wahr? Unsere Manuela in einem Schloss. Hoffentlich will sie jetzt noch zu uns in das kleine Zimmer zurück.«
Maria Cortez lächelte. »Sie ist doch unser Kind, Fernando. Sicher hat sie es sehr gut in dem Heim. Aber die Liebe von Mutter und Vater ist das Kostbarste auf der Welt. Sie ist mehr wert als alles Geld.«
Fernando nickte bedächtig und schaute aus dem Fenster. Draußen flog die frühsommerliche Landschaft vorbei. Sie hatten die deutsche Grenze nun schon hinter sich und damit den größten Teil ihrer weiten Reise. »Du hast recht, Maria«, sagte er. »Aber Kinder verstehen so etwas manchmal nicht. Sie urteilen nach dem äußeren Glanz. Vielleicht ist es Manuela doch nicht mehr gut genug bei uns.«
»Warte es ab, Fernando. Manuela wird sicher vor Freude tanzen und sofort mit uns kommen. Da möchte ich sogar mit dir wetten. Ich bin so dankbar, dass du gesund geworden bist. Es war eine schreckliche Zeit.«
Fernando legte den Arm um die Schultern seiner hübschen jungen Frau. »Arme Maria. Ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, wie es anfing. Als ich das erste Mal ein wenig zur Besinnung kam, hast du neben meinem Bett gesessen und meine Hand gehalten.«
»Du warst eine volle Woche ohne Bewusstsein. Das Fieber wollte nicht weichen. Der Arzt hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Deshalb erlaubte er mir, Tag und Nacht bei dir zu bleiben.«
»Ohne dich wäre ich wohl nicht mehr aufgewacht, Maria. Deine Liebe hat mich festgehalten und gerettet.«
»Nicht meine Liebe, Fernando – Gottes Hilfe. Ich habe bei dir gesessen, den Schwestern ein wenig geholfen und gebetet. Was hätte ich denn tun sollen, wenn du gestorben wärest?« Ihr rannen ein paar Tränen über die Wangen.
Fernando lächelte. »Du brauchst jetzt nicht mehr zu weinen, Maria. Ich bin gesund, und wir fahren wieder nach Deutschland. Wir werden da weitermachen, wo wir aufgehört haben. In ein paar Jahren sind wir dann so weit, dass wir uns in Spanien ein kleines Haus bauen können. Dann bekommt Manuela ein Schloss, das ihr wirklich gehört.«
Maria lachte ein wenig. »Ach, Fernando, ein Schloss wird es sicherlich nicht. Nur ein einfaches Haus. Aber das ist schon viel.«
Der Zug lief in den Bahnhof ein. Maria und Fernando stiegen aus. Man reichte ihnen die Reisetaschen durchs Fenster hinaus.
»Hasta la vista – auf Wiedersehen – viel Glück«, erklang es von überall her.
Das junge Ehepaar blieb am Bahnsteig stehen, bis der lange Zug wieder abfuhr. Maria und Fernando winkten. Es war, als entgleite ihnen mit diesem Zug voller Landsleute das letzte Stückchen Heimat. Doch sie waren nicht traurig. Der Herrgott hatte es gut mit ihnen gemeint. Er hatte Fernando wie durch ein Wunder gesund werden lassen. Sie hatten eine Bleibe, und sie wussten, dass sie endlich wieder mit ihrem Töchterchen vereint sein würden.
Fernando ergriff die Taschen. Der Anschlusszug nach Maibach ging in zwanzig Minuten.
Die Fahrt nach Maibach dauerte nur eine gute Stunde, doch sie erschien den ungeduldigen Reisenden länger als der weite Weg von Spanien nach Deutschland. Da jedoch alles einmal ein Ende hat, erreichten sie das ersehnte Ziel schließlich doch. Suchend sahen sie sich um.
Natürlich war niemand von ihren Freunden am Bahnhof, denn sie hatten ihre Ankunft ja nicht mitgeteilt.
»Es weiß ja keiner, dass wir kommen«, besann sich Maria. »Wer sollte uns auch abholen?«
Wieder ergriff Fernando das Gepäck. Auf dem Weg zur Wohnung kaufte Maria, die stets an alles dachte, etwas Milch, ein paar Eier, Gemüse und andere Kleinigkeiten.
»Es wird genug zu tun geben, bis ich das Zimmer in Ordnung habe. Wahrscheinlich ist alles verstaubt. Da kann ich nicht noch einmal ausgehen.«
»Willst du dich nicht erst ausruhen, Maria? Die Fahrt war anstrengend. Im Zug schläft man nicht richtig.«
»Ich bin nicht müde, Fernando. Du etwa?«
»Überhaupt nicht. Ich habe mich im Krankenhaus lange genug ausruhen können. Ich denke, ich gehe dann gleich mit meinen Papieren in die Fabrik, um mich anzumelden. Wir haben Freitag heute. Nach Möglichkeit möchte ich am Montag wieder an der Maschine stehen. Aber vielleicht ist das zu viel verlangt.«
»Mach dir keine Sorgen, Fernando. Gott hat uns bisher geholfen. Ich vertraue darauf, dass er es auch weiterhin tun wird.«
Sie erreichten das alte Haus, dessen Eigentümer jeden Raum an eine andere ausländische Familie vermietet hatte. Maria zog den Schlüssel aus ihrer Tasche. Es war still um diese Zeit im Treppenhaus, denn die Leute, die hier wohnten, arbeiteten alle. Und die Kinder waren noch in der Schule.
»Sie werden sich wundern, dass wir wieder da sind«, sagte Maria. »Komm, Fernando.«
Sie fanden das kleine Zimmer genauso vor, wie Maria es verlassen hatte.
»Es ist wirklich noch da, Fernando«, flüsterte die junge Frau. »Manchmal habe ich doch ein bisschen Angst gehabt, dass der Hauswirt es uns wegnehmen könnte, weil wir fort waren.«
»Aber du hattest doch bezahlt, Maria.«
»Na ja, man kann nie wissen. Er ist sehr aufs Geld aus.«
Sie betraten ihr bescheidenes Heim. Maria öffnete das Fenster. »Staubig ist es freilich«, stellte sie mit einem kleinen Seufzer fest. »Aber das bringe ich schon in Ordnung.« Sie band sich eine Schürze um und machte sich sofort an die Arbeit.
Fernando wusch sich und sagte, dass er zur Fabrik gehen wolle. Es lasse ihm keine Ruhe.
»Geh auch beim Gymnasium vorbei, Fernando«, bat Maria. »Wenn gerade Pause ist, kannst du versuchen, eins der Sophienluster Kinder zu fragen, wie es Manuela geht. Und beim Hausmeister richte bitte aus, dass ich gern wieder anfangen möchte.«
Fernando küsste seine Frau und ging davon.
Maria spürte keinerlei Ermüdung. Sie sang leise vor sich hin, während sie das Zimmer bis in den letzten Winkel säuberte und die Betten frisch bezog. Manuelas Bett richtete sie mit besonderer Liebe her. Als alles fertig war, wusch sie sich und zog ein hübsches buntes Sommerkleid an. Dann bürstete sie ihr schönes Haar.
Von der Kirche schlug es zwei Uhr nachmittags.
Schade, dachte sie. Jetzt ist die Schule schon aus. Ob Fernando Pünktchen, Nick oder Irmela noch getroffen hat?
Sie legte ein Tuch auf den Tisch und bereitete eine einfache Mahlzeit zu. Im Hause war es inzwischen laut geworden, denn einige Kinder waren heimgekehrt. Ein paarmal steckte ein Kind neugierig den Kopf durch die Tür und wünschte temperamentvoll guten Tag.
Erst nach drei Uhr kam Fernando zurück. Er sah nun doch müde aus, aber seine dunklen Augen leuchteten. Maria brauchte gar nicht erst zu fragen.
»Ich kann Montag anfangen, sogar an meiner alten Maschine, Maria«, rief der junge Spanier und wirbelte seine Frau durch die Luft. »Sie suchten gerade jemanden. Zuerst waren sie ein bisschen böse, weil ich so lange weggeblieben bin. Aber dann haben sie gelesen, dass ich krank war. Jetzt ist alles in Ordnung.«
»Bist du im Gymnasium gewesen?«, fragte Maria, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
»Es war zu spät dazu, Maria. Ich habe lange warten müssen im Personalbüro.«
»Schade«, seufzte Maria. »Ich hätte selbst hingehen sollen. Aber ich wollte es hier erst schön haben. Komm, wir essen, Fernando.«
*
Es war Nick, der die Sache in die Hand nahm. Zufällig sah er Maria über den Hof gehen, als sie den Hausmeister aufsuchen wollte, um sich nach ihrer Arbeitsstelle zu erkundigen. Sofort lief er auf sie zu. »Da sind Sie ja, Frau Cortez! Wir haben uns schon Sorgen um Sie gemacht. Ist bei Ihnen alles in Ordnung?«
»Ja, danke, Dominik. Wie geht es meiner kleinen süßen Manuela? Ist sie gesund? War sie brav?«
»Sie ist putzmunter, Frau Cortez. Wollen Sie sie nun wieder abholen?«
Maria nickte eifrig. »Noch heute, Dominik. Wir haben sie lange genug entbehrt. Hat sie nicht manchmal geweint und sich nach uns gesehnt?«
Nick lachte. »In Sophienlust ist es so schön, dass man nicht weinen kann. Manuela hat sogar reiten gelernt. Auf einem Pony. Sie spielt auch gern mit Tieren. Unsere Küken sind ihre besonderen Lieblinge.«
»Und sie war nie krank?«
»Keinen Tag, Frau Cortez. Ist Ihr Mann denn gesund geworden?«
Maria berichtete ein wenig atemlos von Fernandos schwerer Krankheit.
»Bloß gut, dass er gesund geworden ist«, meinte Nick erleichtert. »Das wäre sonst schlimm für Sie und Manuela gewesen. Wollen Sie nachher in unserem Bus mitfahren? Heute ist die Schule ja schon früher aus.«
»Aber der Bus ist doch nicht für uns da. Mein Mann möchte auch gern mit.«
»Na, Ihr Mann kann genauso gut mitkommen wie Sie, Frau Cortez. Wir rücken ein bisschen zusammen. Dann ist genug Platz für alle.«
»Wenn du meinst, Dominik? Ich denke, dass sich das nicht gehört.«
»Manuela ist ein Sophienluster Kind, und Sie sind ihre Eltern. Das hat schon seine Ordnung, Señora Cortez. Abgemacht?«
»Danke, Dominik. Dann nehmen wir’s also an.«
Nick seufzte erleichtert auf. »Endlich. Mit Ihnen hat man es gar nicht so leicht.«
Während Maria mit dem Hausmeister verhandelte, teilte Nick die aufregende Nachricht Pünktchen, Irmela und ein paar anderen Kindern aus Sophienlust mit.
Irmela setzte ein etwas nachdenkliches Gesicht auf, als sie von der Rückkehr der beiden Spanier erfuhr. »Tante Isi und Frau Rennert hatten befürchtet, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sie werden sich freuen, dass alles in Ordnung ist. Tante Reni wird dagegen wahrscheinlich sogar ein bisschen traurig sein, wenn Manuela fortgeholt wird. Sie hat manchmal zu mir gesagt, sie wolle Manuela später zu sich nehmen.«
Nick hob die Schultern. »Vielleicht erlauben ihre Eltern, dass Manuela in Sophienlust bleibt. Ich weiß von Mutti, dass sie hier nur in einem ganz kleinen Zimmer wohnen. Bei uns hat es Manuela sicher besser.«
»Aber es sind ihre Eltern«, gab Irmela zu bedenken. »Bestimmt hat Manuela ihre Mutti und ihren Vater lieb und möchte wieder zu ihnen zurück. Für Tante Reni wird das schlimm.«
»Daran können wir nichts ändern, Irmela«, äußerte Nick. »Mutti wird schon wissen, wie es richtig ist. Ich würde ja am liebsten alle Kinder in Sophienlust behalten. Aber inzwischen habe ich schon einsehen gelernt, dass das nicht möglich ist.«
Die nächste Schulstunde begann. Irmela und Nick mussten sich trennen. Sie besuchten verschiedene Klassen, denn Irmela war ein Jahr jünger als Nick.
Am Schluss der letzten Stunde fanden sich Maria und Fernando Cortez ein bisschen verlegen bei dem roten Bus ein. Die Begrüßung durch die Kinder war herzlich. Maria konnte berichten, dass sie ihre Tätigkeit schon am kommenden Montag in der Schule wieder aufnehmen würde. Ihre Vertreterin komme im Krankenhaus als Küchenhelferin unter. Es sei alles zur Zufriedenheit geregelt.
Die Fahrt nach Sophienlust verlief, wie immer am Samstag, besonders fröhlich. Maria und Fernando, die sich auf das Wiedersehen mit Manuela freuten, stimmten immer wieder in das allgemeine Lachen ein.
Der Schulbus fuhr vor der Freitreppe des Herrenhauses vor.
»Wir haben Manuelas Eltern mitgebracht«, rief Nick, der als Erster aus dem Bus sprang.
Frau Rennert und Schwester Regine kamen gleichzeitig aus dem Haus. Ehe sie fragen konnten, ob Nick sich nur einen Scherz erlaube, stand das junge spanische Paar bereits vor ihnen. Nick übernahm es, die Namen zu nennen.
»Herr und Frau Cortez – Frau Rennert und unsere Kinderschwester Regine.«
»Was für eine Freude, dass Sie wieder gesund sind«, sagte Frau Rennert herzlich. »Manuela wird sicher überrascht sein. Frau von Schoenecker und auch wir haben uns etwas um Sie gesorgt. Leider hatte niemand Ihre Adresse in Barcelona.«
Maria Cortez senkte beschämt die Lider mit den schön gebogenen langen Wimpern.
»Ich glaube, ich hätte schreiben müssen, Frau Rennert. Frau von Schoenecker hat mir die Adresse von Sophienlust gegeben. Aber ich habe nicht mehr daran gedacht. Der Zettel blieb sogar hier zurück in meinem Schrank. Das habe ich gestern beim Aufräumen gemerkt.«
»Es macht nichts, Frau Cortez. Wollen Sie jetzt mit uns allen zu Mittag essen?«
»Das können wir doch nicht annehmen. Sie haben schon so viel für uns getan.«
»Ist man in Spanien nicht gastfreundlich?«, meinte die gütige Heimleiterin lächelnd. »Sollen wir Sie draußen warten lassen, während wir essen? Bei uns wird jeden Tag genug gekocht. Da können leicht noch zwei Personen mitessen.«
»Wir müssen Mutti anrufen«, mischte sich Nick ein.
»Ja, Nick. Ich denke, sie wird dann gleich herkommen. Du und Henrik, ihr sollt heute hier essen.«
»Okay«, sagte Nick. »Was gibt’s denn?«
»Geh in die Küche und frage Magda selbst«, erwiderte Frau Rennert lachend. »Ich meine, wir sollten jetzt mal feststellen, wo unsere Manuela steckt.«
Maria und Fernando atmeten dankbar auf. Sie hatten beide nicht den Mut gefunden, diese Bitte zu äußern. Und doch war ihnen das Wiedersehen mit ihrem Kind wichtiger als das Essen.
Schwester Regine konnte Abhilfe schaffen. »Wir haben neue Küken drüben im Stall. An und für sich ist es im Juni dafür schon zu spät. Aber es kommt immer mal vor, dass eine Henne in einer versteckten Ecke noch einmal brütet. Manuela hat eine besondere Vorliebe für die Küken. Ich möchte wetten, dass sie dort steckt. Kommen Sie.«
Zu dritt gingen sie zum Geflügelhof.
»Wie groß und schön hier alles ist«, staunte Fernando. »Es ist wunderbar für die Kinder.«
Regine neigte den Kopf. »Ja, unsere Kinder sind glücklich, Herr Cortez. Auch Manuela hat sich hier wohl gefühlt. Sie wird uns ganz gewiss fehlen.«
»Uns hat sie auch gefehlt«, entgegnete Fernando leise.
Sie entdeckten Manuela im Stall in einer Ecke im Stroh. Auf ihrem bunten Röckchen hielt sie die zu spät ausgeschlüpften Küken und lächelte selig. Eines der kleinen gelben Tierchen war sogar so vorwitzig gewesen, ihr auf die Schulter zu klettern.
Manuelas Eltern standen wie gebannt vor diesem bezaubernden Bild. Schwester Regine entfernte sich leise. Doch die beiden merkten das gar nicht. Sie hatten nur noch Augen für ihr Kind.
»Manuela!«
Die Kleine hob den Blick. Die schönen dunklen Augen füllten sich zunächst mit ungläubigem Staunen und dann mit strahlender Freude.
»Mutti, Papa!«
Behutsam und doch so schnell wie möglich setzte Manuela die Küken ins Stroh. Dann ließ sie sich von Vater und Mutter umarmen, herzen und küssen.
»Freust du dich, dass wir wieder da sind, mein Liebling? Vater ist wieder gesund. Arbeit haben wir auch. Jetzt wird alles wieder wie früher.« Maria strich mit zärtlicher Hand über das Haar ihres Töchterchens, das liebevoll gekämmt war und zwei Schleifen trug.
»Ja, ich freue mich, Mutti. Es ist beinahe so schön wie letztes Jahr zu Weihnachten. Schau, magst du die Küken? Justus sagt, sie sind zu spät aus dem Ei gekommen. Aber wenn der Sommer schön warm ist, werden sie trotzdem groß werden.«
»Was du alles weißt«, staunte Fernando.
»Sophienlust ist doch ein Landgut. Justus weiß über alles Bescheid, auch über die Pferde. Nachher zeige ich euch, wie ich reiten kann. Und Tante Reni müsst ihr natürlich auch kennen lernen. Sie hat heute früh Kopfweh gehabt und ist in ihrem Zimmer geblieben. Sonst spielt sie nämlich immer mit mir.«
»Tante Reni? Wer ist das?«
»Nun, eben Tante Reni. Sie hat mich sehr lieb, und ich sie auch. Wenn wir allein sind, nennt sie mich heimlich Gitti. Das ist unser Spiel.«
»Gitti? Was ist das für ein Name?«
»Weiß ich doch nicht. Sie sagt es gern zu mir. Man kann doch mal etwas spielen.«
»Ja, sicher, Manuela. Du bist also gern hier gewesen. Darüber freue ich mich.«
»In Sophienlust sind alle gern, Mutti. Ich habe auch ein Namensbäumchen im Wald bekommen, wie jedes Kind.«
»Was für ein Namensbäumchen?«
»Ein kleiner Baum mit einem Schild. Darauf steht Manuela. Der Baum gehört mir. Jedes Kind hat einen Baum. Es ist schon ein Wald geworden. Er heißt Märchenwald. Nick sagt, dass es immer so bleiben soll, damit keiner vergessen wird, der einmal in Sophienlust war. Man darf auch einmal wiederkommen.«
»Willst du denn jetzt mit uns zurück?«, fragte Fernando Cortez ein wenig zweifelnd.
Manuela schmiegte sich eng an ihn. »Ja, Papa. Ich habe doch die ganze lange Zeit auf euch gewartet. Die anderen Kinder, die hier sind, haben meistens keine Eltern mehr. Aber ich bin doch nur nach Sophienlust gekommen, weil ich auf euch warten sollte.«
Man hörte in der Ferne einen Gong.
»Ich muss zum Essen. Kommt ihr mit?«
»Ja, wir sind eingeladen worden.«
»Hier wird jeder eingeladen, der gerade da ist. Ihr werdet staunen, wie gut unsere Magda kochen kann. Hoffentlich gibt es heute Pudding.«
Manuela schnatterte wie ein kleines Entchen, aufgeregt und glücklich. Trotzdem überzeugte sie sich gewissenhaft, ob ihre kleinen Küken auch gut versorgt waren. Sie hatten sich unter den Flügeln der Henne verkrochen.
Selig hüpfte das Kind dann zwischen seinen Eltern zum Herrenhaus hinüber. Maria und Fernando, die sich vor der Begegnung mit den Bewohnern von Sophienlust ein wenig gefürchtet hatten, fühlten sich mit der größten Selbstverständlichkeit in den Kreis dieser harmonischen Gemeinschaft aufgenommen.
Flinke Hände hatten an der langen Tafel im Speisezimmer für zwei weitere Gedecke gesorgt.
»Kommt Tante Reni nicht?«, fragte Manuela ein bisschen enttäuscht.
»Es geht ihr nicht gut, Herzchen«, sagte Frau Rennert. »Der Doktor war vorhin bei ihr. Sie soll heute liegen bleiben.«
»Schade«, seufzte Manuela. »Mutti und Papa wollen sie doch kennen lernen.«
»Das wird sich schon noch einrichten lassen«, entgegnete Frau Rennert. Sie hatte soeben ein ausführliches Telefongespräch mit Denise von Schoenecker geführt. Beide sorgten sich, wie Reni von Hellendorf die unerwartete Wendung aufnehmen werde. Deshalb erschien es ihnen als günstige Fügung, dass die junge Frau vorerst nichts erfahren konnte. Denise wollte versuchen, Dr. Volkert zu erreichen, um notfalls seinen ärztlichen Rat einzuholen.
Die Mahlzeit verlief ungezwungen und heiter. Magdas Küche fand ungeteilten Beifall bei groß und klein.
»So gut kann ich nicht kochen«, gab Maria Cortez zu. »Hoffentlich schmeckt es dir noch bei mir, Manuela.«
»Klar, Mutti. Bei dir schmeckt es sowieso am besten«, antwortete das kleine Mädchen. »Aber wenn ich mal Heimweh habe, dann besuchen wir Tante Reni, Nick, Henrik und die anderen Kinder in Sophienlust. Bestimmt macht Magda dann eine große Torte, und wir feiern ein Fest.«
Maria bekam einen roten Kopf. »So viele Umstände wird man sich deinetwegen nicht machen, kleiner Frechdachs.«
»Natürlich soll Manuela uns besuchen, Frau Cortez«, warf Nick ein. »Sie müssen dann mitkommen und werden sehen, dass Magda wirklich Torten bäckt. Wenn sie gewusst hätte, dass Sie und Ihr Mann heute kommen würden, hätte sie bestimmt auch etwas Besonderes vorbereitet.«
Nun, Manuelas Eltern fanden das Essen ohnehin schon festlich. Als Nachspeise gab es die ersten Gartenhimbeeren mit frischer Sahne, von den Kindern mit lautem Jubel begrüßt.
In dem Augenblick, als Frau Rennert die Tafel aufhob, erschien Denise von Schoenecker. Mit ausgebreiteten Armen ging sie auf Maria Cortez zu und zog sie an sich. »Welche große Freude, liebe Frau Cortez. Und das ist Ihr Mann? Ich hörte schon, dass Sie wieder ganz wohlauf sind, Herr Cortez.«
Die Spanier wollten sich bedanken, doch Denise ließ sie nicht zu Worte kommen »Ich denke, wir trinken zusammen ein Tässchen Kaffee. Sie müssen mir erzählen, wie es Ihnen ergangen ist.«
»Wir machen Ihnen viele Mühe«, stammelte Maria verlegen. »Dominik hat uns aufgefordert, im Schulbus mitzukommen. Jetzt sind wir schon zum Essen eingeladen worden. Wir wollten ja nur Manuela abholen.«
»Haben Sie denn solche Eile? Es ist doch Samstag«, entgegnete Denise lächelnd. »Ich meine, Sie sollten sich Sophienlust gründlich ansehen, damit Sie nachher genau wissen, wovon Manuela spricht, wenn sie Ihnen dies und jenes erzählt. Es ging damals, als Sie abreisen mussten, alles viel zu schnell. Nun sollten wir nichts übereilen.«
Diese aus dem Herzen kommenden Worte nahmen Maria und Fernando die Schüchternheit. Sie folgten Denise durch die Halle ins Biedermeierzimmer und ließen sich ehrfürchtig auf den seidenbezogenen Biedermeiersesseln nieder. Manuela hatte sich mit vielen Küssen für das vorgeschriebene Mittagsschläfchen verabschiedet.
Pünktchen erschien mit einem großen Tablett und bot Kaffee an. Sie betrachtete Maria Cortez noch immer in gewisser Weise als ihren besonderen Schützling.
»Hab’ ich nicht recht gehabt, Frau Cortez?«, fragte das Mädchen mit den lustigen Sommersprossen. »Es war die einzig richtige Lösung, dass Manuela zu uns gekommen ist.«
»Ja, Angelina, das stimmt. Ich war so schrecklich unglücklich, dass ich eure Geschichte nicht glauben konnte.«
Pünktchen strahlte sie an. Sie war so stolz, als habe sie Sophienlust persönlich erbaut und gegründet.
Denise wartete, bis Pünktchen wieder gegangen war. Dann erkundigte sie sich fürsorglich, ob es mit den Arbeitsplätzen keine Schwierigkeiten gebe, und erfuhr, dass sie diesen fleißigen, tapferen Menschen nicht zu helfen brauchte.
»Wir haben Manuela liebgewonnen. Sie wird hier eine Lücke hinterlassen. Vergessen Sie bitte nicht, dass sie hier jederzeit willkommen ist, falls sich einmal die Notwendigkeit ergeben sollte.«
»Danke, Frau von Schoenecker. So viel Freundlichkeit darf man nicht ausnutzen. Sie haben uns sehr geholfen. Nun wollen wir das Kind mitnehmen. Hoffentlich ist es Manuela jetzt bei uns nicht zu eng. Hier ist alles so großzügig und weit. Wir haben ja nur das eine kleine Zimmer.« Fernando machte ein besorgtes Gesicht.
Denise hob die Hand. »Ein Kind braucht Liebe, Herr Cortez. Nicht überall kann es so sein wie hier in Sophienlust. Trotzdem wird Manuela sich bei Ihnen wieder wohlfühlen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber sie kann uns immer besuchen.«
»Warum sind Sie so gut zu uns, Frau von Schoenecker? Sie haben uns nicht einmal gekannt und waren doch gleich bereit, Manuela hier aufzunehmen.« Fernando Cortez trank von seinem Kaffee und sah Denise dabei bewundernd an.
»Keines unserer Kinder kannten wir vorher. Schauen Sie das Bild der alten Dame da an der Wand an! Sie hat meinem Sohn Nick Sophienlust hinterlassen und bestimmt, dass daraus eine Zuflucht für in Not geratene Kinder oder auch Erwachsene werden soll. Nick war erst fünf Jahre alt, als ihm dieses Erbe zufiel. So übernahm ich es, das Vermächtnis seiner Urgroßmutter nach besten Kräften zu erfüllen. Wenn Sie also durchaus einen Dank abstatten wollen, dann wenden Sie sich an das Gemälde.«
»Es gibt sehr gütige Menschen«, flüsterte Maria Cortez andächtig. »Was hätte ich ohne Ihre Hilfe tun sollen?«
»Ich wäre nicht wieder gesund geworden ohne meine Maria«, fügte Fernando hinzu.
Denise lenkte behutsam von den traurigen Erinnerungen ab. Sie stellte ein paar Fragen nach den Lebensverhältnissen und Zukunftsplänen des jungen Paares.
»Leicht ist es nicht für Sie«, stellte sie fest. »Aber ich sehe schon, dass Sie Ihr Ziel eines Tages erreichen werden. Manuela kann stolz auf ihre Eltern sein. Wenn Sie wollen, behalten wir sie noch eine Weile hier«, versetzte Denise tastend. »Mit dem Schulbus besteht ja täglich eine Verbindung nach Maibach. Sie wären also nicht vollkommen voneinander getrennt.«
Maria schüttelte mit unerwarteter Heftigkeit den Kopf. »Danke, Frau von Schoenecker. Manuela gehört jetzt wieder zu uns. Sie würde es nicht verstehen, wenn wir sie länger hierlassen wollten. Es wäre auch nicht richtig. Sie sagten, dass dieses Haus für Kinder bestimmt ist, die in Not sind. Manuela ist nicht mehr in Not. Wir sind hier und können wieder für sie sorgen.«
Denise sah sie an. Die Haltung der jungen Frau gefiel ihr. »So meine ich es nicht, Frau Cortez«, äußerte sie begütigend. »Ich denke eigentlich mehr an eine junge Freundin von mir, für die der Abschied von Manuela schmerzlich sein wird.«
»Ist es die Dame, die nicht zum Essen kam? Manuela nennt sie Tante Reni.«
»Ja. Sie hat einen sehr tragischen Verlust erlitten. Ihr einziges Kind ist gestorben. Mit diesem schrecklichen Ereignis kann sie sich noch immer nicht abfinden. Manuela hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem verstorbenen kleinen Mädchen. So ist diese Zuneigung leicht zu erklären.«
Maria standen Tränen in den dunklen Augen. »Sie tut mir leid, Frau von Schoenecker«, flüsterte sie. »Jetzt verstehe ich das, was Manuela mir erzählt hat. Die Dame nennt sie mit dem Namen des anderen Kindes. Gitti, glaube ich.«
»Ja, das tut sie wohl manchmal heimlich. Es ist wie ein Spiel, doch für meine arme Freundin bedeutet es wohl viel mehr als das. Ich dachte an sie, als ich die Frage aussprach, ob Sie Manuela noch für einige Zeit bei uns lassen würden.«
Maria zog ihr Taschentuch hervor und trocknete sich die Augen. »Ich kann nicht, Frau von Schoenecker. Ich war zu lange getrennt von meinem Kind. Jetzt will ich Manuela wieder jeden Abend zu Bett bringen und am Morgen in ihre blanken Augen schauen.«
Denise senkte die Lider. »Ich kann Sie verstehen«, gab sie zu. »Es hat eine Zeit gegeben, da war ich von Nick getrennt und musste das Geld für unseren Lebensunterhalt selbst verdienen. Die Arbeit habe ich gern getan. Aber die Trennung von dem Kind hat uns beiden fast das Herz gebrochen. Es war unbedacht, diesen Wunsch auch nur auszusprechen. Meiner Freundin wäre ja auch mit einem Aufschub kaum geholfen.«
»Ich fürchte mich ein bisschen vor ihr, Frau von Schoenecker«, fuhr Maria Cortez fort. »Es erscheint mir ein wenig unheimlich, dass die Dame Manuela einen anderen Namen gegeben hat. Das möchte ich nicht.«
»Maria hat recht«, fügte Fernando hinzu. »Wir sind gekommen, um unser Kind zu holen. Daran soll sich nichts ändern. Bitte, halten Sie uns deswegen nicht für undankbar.«
»Nein, nein, gewiss nicht«, versicherte Denise rasch. »Würden Sie mir dennoch eine kleine Bitte erfüllen?«
»Wenn es möglich ist, gern.«
»Ich habe versucht, den Arzt meiner Freundin zu erreichen. Leider ist er nicht zu Hause. Ich konnte nicht erfahren, wann er zurückkommt. Würden Sie bis morgen bleiben, damit Manuela und meine Freundin richtig Abschied voneinander nehmen können? Es wäre vielleicht ein Schock für sie, wenn das Kind plötzlich nicht mehr da wäre.«
»Wir wollten eigentlich so schnell wie möglich zurück. Wir haben auch kein Gepäck mitgebracht.«
»Es macht nicht viele Umstände. Wir haben ein Gästezimmer und können Ihnen auch mit Nachtzeug aushelfen. Gewiss werden Sie Ihren Entschluss nicht bereuen. Sophienlust hat allerlei zu bieten. Manuela wäre sicherlich enttäuscht, wenn sie Ihnen nicht ihre Reitkünste auf dem Pony vorführen dürfte.«
»Wenn wir Ihnen damit einen Gefallen tun, bleiben wir«, entschied Fernando. »Ich meine, das sind wir Ihnen schuldig. Aber dass wir Manuela für längere Zeit dalassen – nein, das halte ich für falsch. Es würde keinen Segen bringen, auch nicht für die arme Dame, die ihr Kind verloren hat.«
Denise seufzte verstohlen. Sie sah ein, dass Fernando Cortez recht hatte. Aber sie fragte sich, wie Reni die Nachricht aufnehmen würde.
»Ich danke Ihnen«, sagte sie leise. »Es ist schön, dass wir uns so gut verstehen.«
Sie stand auf und führte Maria und Fernando durch das weitläufige Haus. In der Küche fanden sie Magda dabei, Biskuitrollen zu backen.
»Für nachher«, sagte die Köchin mit hochroten Wangen. »Weil wir doch Gäste haben.«
»Für uns?«, fragten Manuela und Fernando wie aus einem Munde.
»Aber ja«, versicherte Magda lachend. »Sie hätten sich natürlich besser anmelden sollen. Glücklicherweise geht es mit Biskuitteig schnell. Das ist immer meine Rettung bei überraschendem Besuch.«
Manuelas Eltern brachten vor lauter Verlegenheit kein Wort hervor. Soviel Umstände machte man ihretwegen! Doch als sie in Magdas gutes, freundliches Gesicht blickten, wurde ihnen klar, dass sie annehmen durften, was ihnen so gern gegeben wurde. Als sie das Zimmer betraten, in dem Heidi und Manuela schliefen, wachten die Kinder eben auf. Maria nahm ihr Töchterchen fest in ihre Arme und zog es danach an. Es machte sie glücklich, die kleinen Sachen endlich wieder in die Hände nehmen und die warme weiche Haut ihres Lieblings berühren zu können.
Die Mitteilung, dass die Eltern bis zum nächsten Tag bleiben würden, nahm Manuela mit Begeisterung auf.
»Ich zeige euch alles. Wenn Irmela oder Nick Zeit haben, reiten wir später. Zuerst habe ich ein bisschen Angst gehabt. Aber inzwischen macht es mir großen Spaß.«
Denise war plötzlich überflüssig geworden. Sie zog sich zurück. Niemand bemerkte es.
Nach kurzem Zögern klopfte Denise an Renis Tür. Sie fand die junge Frau nicht im Bett, wie sie angenommen hatte, sondern im Sessel am Fenster.
»Geht es dir besser, Reni?«, fragte Denise. »Fehlt dir etwas? Möchtest du Tee oder Kaffee haben?«
»Ich brauche nichts, Denise. Vielen Dank. Meine Kopfschmerzen sind etwas besser geworden. Dr. Volkert hat mir Tabletten gegeben. Zuerst dachte ich, dass sie nicht helfen würden. Aber jetzt fühle ich mich viel freier. Deshalb bin ich auch aufgestanden. Man kommt nur ins Grübeln, wenn man im Bett liegt.«
»Wollen wir ein Stück zusammen spazieren gehen, Reni?«, schlug Denise vor. »Oder ist dir das zu anstrengend?«
»Nein, ein bisschen frische Luft tut mir sicherlich gut.«
Denise war sich durchaus bewusst, welches Risiko sie nun einging. Es bestand die Möglichkeit einer Begegnung mit Manuelas Eltern. Aber verheimlichen ließ sich die Anwesenheit der jungen Spanier vor Reni höchstens noch für ein paar Stunden.
Reni stand mit einer müden Bewegung auf. Ihr Gesicht war an diesem Tag wieder einmal von maskenhafter Starre.
Denise schob ihren Arm unter den der Freundin und ging mit ihr hinaus.
»Herrliches Wetter, nicht wahr?«
»Ja, Denise. Da wird ja ein großer Tisch im Freien gedeckt. Hat eines der Kinder Geburtstag? Habe ich das etwa vergessen?«
»Nein, es gibt eine unvorhergesehene Freude. Magda macht in Windeseile Biskuitrollen zur Feier des Tages.«
»Was wird denn gefeiert?« Renis Frage war ohne sonderliches Interesse.
»Manuelas Eltern sind zurückgekommen, Reni. Das wollte ich dir lieber selbst sagen.«
Reni sah sie an, als verstehe sie nicht, was sie gehört habe. »Manuelas Eltern? Die sind doch verschollen und kommen nicht mehr.«
»Das wusste man nicht genau, Reni. Manuelas Vater war sehr krank, ist aber glücklicherweise wieder gesund geworden. Heute Mittag kamen beide Eltern mit dem Schulbus aus Maibach.«
»Bleiben sie eine Weile? Fahren sie bald wieder weg? Es ist weit bis Spanien, nicht wahr?«
»Aber, Reni, sie arbeiten doch in Maibach. Sie wollen Manuela abholen. Der Aufenthalt der Kleinen war von Anfang an nur für vorübergehend geplant.«
»Sie können Manuela nicht wegholen. Ich will sie doch behalten. Das war längst ausgemacht.«
Denise beobachtete Reni voller Unruhe. Die junge Frau sah starr geradeaus und redete wie im Traum. Ihr war keine Spur von Erregung anzumerken. Das wirkte fast unheimlich.
»Es war nichts ausgemacht, Reni«, wagte Denise einzuwenden. »Wir wussten nur nicht, was aus Manuelas Eltern geworden war.«
»Ich werde das Kind mitnehmen. Nirgends auf der Welt kann Manuela es so gut haben wie bei mir. Vielleicht kaufe ich ein Haus. Das ist ein großes Glück für das Kind. Du musst es den Eltern erklären. Sie werden es einsehen.«
»Ich fürchte, du irrst dich, Reni. Herr und Frau Cortez sind fest entschlossen, ihre Tochter morgen mit nach Maibach zu nehmen. Und Manuela ist glücklich über das Wiedersehen mit ihren Eltern. Wir haben kein Recht, sie zu entwurzeln.«
Reni von Hellendorf zeigte auch jetzt keinerlei Anzeichen von Erregung.
»Ich rede mit ihnen, Denise. Sie werden mir das Kind überlassen. Es sind arme Leute. Ich kann ihnen viel Geld bieten. Sie brauchen sich nicht mehr jahrelang abzuplagen. Sie werden von einem Tag zum andern reich sein. Dann reisen sie natürlich sofort nach Spanien zurück und vergessen das Kind. Gitti gehört mir.«
»Sie heißt Manuela, nicht Gitti«, erinnerte Denise voller Angst. »Das weißt du doch, Reni.«
»Sie wird Gitti heißen. Warte es ab. Sie hört schon lange auf diesen Namen.«
Denise blieb stehen und legte die Hände auf Renis Arme. »Reni, besinne dich auf die Wirklichkeit«, drängte sie. »Du darfst die Augen nicht gewaltsam davor verschließen, dass Manuela Eltern hat und von diesen zurückgeholt wird.«
»Lass mich nur mit ihnen reden, Denise. Es ist gut, dass sie gekommen sind. Ich glaube, sie werden etwas unterschreiben müssen, wenn sie auf ihr Kind verzichten. Das muss mit ihnen besprochen werden.«
»Reni …«
In diesem Augenblick tauchte Manuela mit ihren Eltern auf. Das Kind lachte fröhlich und kam wie ein Pfeil auf Reni zugeschossen.
»Tante Reni, meine Mutti und mein Papa sind gekommen. Morgen fahren wir nach Maibach zurück.«
Reni beugte sich nieder und küsste Manuela. Doch die Starre wich auch jetzt nicht aus ihrem Gesicht.
Nun kamen Maria und Fernando herbei. Denise übernahm die Vorstellung. Man reichte sich die Hände.
»Sie haben sich viel um Manuela gekümmert, Frau von Hellendorf«, sagte Fernando mit der ihm eigenen Würde. »Wir möchten Ihnen dafür danken. Sie spricht ständig von Ihnen.«
Reni nickte mit ernstem Gesicht. »Wir haben uns liebgewonnen, Herr Cortez. Nachher, wenn die Kuchentafel vorüber ist, möchte ich gern etwas mit Ihnen besprechen.«
»Natürlich. Gern, Frau von Hellendorf.«
Denise konnte dem Spanier ansehen, dass er diese Zusage nicht ohne Bedenken gab. Wahrscheinlich ahnte er, dass ihm möglicherweise eine schwierige Auseinandersetzung bevorstand.
Vom Haus her erklangen nun laute Rufe. Der Kakao war fertig, und die frischen Biskuitrollen standen schon auf den Tischen.
Manuelas unbefangene Fröhlichkeit täuschte kaum über die Spannung hinweg, die plötzlich entstanden war. Es gab eine kleine Unstimmigkeit wegen der Tischordnung. Henrik wollte unbedingt neben Reni sitzen, für die er nach wie vor auf seine Weise schwärmte. Reni ihrerseits mochte sich nicht von Manuela trennen, deren Eltern das Kind jedoch gern in ihre Mitte nehmen wollten. Nach einigen Hin und Her bekam Reni den Platz zwischen den beiden Kindern. Maria setzte sich an die andere Seite ihres Töchterchens, und Fernando begnügte sich mit dem Stuhl gegenüber. Er war ein ritterlicher Mann und gab nach, um Streit zu vermeiden.
Es war eine etwas seltsame Nachmittagstafel, denn trotz des Blumenschmucks, trotz des frischen Kuchens und aller Mühe, die die gute Magda sich gegeben hatte, wollte keine unbeschwerte Fröhlichkeit aufkommen. Sogar die Kinder, die gar nicht unmittelbar betroffen waren, schienen das zu spüren. Sie schauten immer wieder zu Reni von Hellendorf hinüber, deren unbewegtes Gesicht ihnen seltsam und fremd erschien.
Zu der Unterredung, die Reni anstrebte, kam es nach dem Kaffee nicht. Manuela wollte unbedingt reiten. Es war unmöglich, ihrem Drängen Widerstand entgegenzusetzen.
Irmela erbot sich, die Aufsicht zu übernehmen, denn Reni mochte nicht reiten. Sie fühlte sich dazu noch zu angegriffen.
Manuela führte mit großem Eifer vor, was sie gelernt hatte. Ihre Eltern kamen aus dem Staunen nicht heraus. »Sie ist ein kluges Kind«, flüsterte Fernando andächtig und stolz.
Maria nahm seine Hand. »Unsere kleine Manuela«, flüsterte sie ihm zu.
Reni stand schweigend daneben. Es war ihr nicht anzumerken, ob sie überhaupt hörte, was gesprochen wurde.
Später ging sie in ihr Zimmer und legte sich nieder. Sie habe wieder Kopfschmerzen, sagte sie, als Denise sich besorgt nach ihrem Befinden erkundigte.
Noch einmal versuchte Denise, Dr. Volkert zu erreichen. Sie hatte jedoch wieder keinen Erfolg.
Reni erschien nicht zum Abendessen. Auch fragte sie nicht mehr nach Manuela. Allmählich gewann Denise den Eindruck, dass die Freundin sich bereits an den Gedanken gewöhnt habe, von dem kleinen Mädchen Abschied nehmen zu müssen.
»Ich hoffe, Reni wird morgen die Abfahrt der spanischen Familie ruhig hinnehmen«, sagte sie zu Frau Rennert, bevor sie spät abends endlich nach Schoeneich zurückfuhr.
*
Denise sollte Recht behalten. Reni schien Manuela vergessen zu haben. Sie blieb am Sonntag in ihrem Zimmer und ließ nur Henrik einmal kurz in ihr Zimmer. Mit ihm sprach sie so freundlich wie gewohnt.
»Sie ist wie immer«, berichtete Henrik. »Morgen ist ihr Kopf bestimmt wieder gut. Morgen kommt ja auch der Doktor wieder.«
Allmählich wagten Denise, Frau Rennert, Schwester Regine und alle anderen aufzuatmen. Gleich nach dem Mittagessen, an dem Maria und Fernando noch teilnahmen, sollte die Abfahrt stattfinden. Da das Ehepaar von Schoenecker ohnehin nach Maibach wollte, um einen erkrankten Freund von Alexander zu besuchen, boten sie den Spaniern an, sie im Wagen mitzunehmen.
Manuela freute sich. Sie machte sich keine Gedanken über Reni. Aber Fernando fragte Denise, ob sich das Kind nicht lieber von Frau von Hellendorf verabschieden sollte. »Man weiß nicht, was richtig ist, gnädige Frau«, fügte er hinzu.
»Ich werde zu ihr gehen, Herr Cortez.«
Reni blickte Denise mit großen Augen entgegen. »Manuela fährt nun mit uns weg, Reni. Doch sie wird uns bald einmal besuchen. Möchtest du ihr Lebewohl sagen?«
»Nein, Denise. Jetzt nicht.« Renis Stimme klang fremd und abwesend.
»Dann ist es also in Ordnung?«
»Ich spreche morgen mit Dr. Volkert darüber.«
Denise war beruhigt. Vielleicht ist dieser Abschied heilsam, dachte sie erleichtert und verließ das halbdunkle Zimmer. »Tante Reni lässt dich grüßen, Manuela. Du sollst bald einmal zu Besuch kommen.«
»Fahren wir jetzt, Tante Isi?«, fragte das Kind voller Ungeduld.
Sie stiegen ins Auto. Auch Henrik und Nick fuhren mit. Die Kinderschar von Sophienlust winkte dem vollbeladenen Wagen nach. Gleich darauf schlug Schwester Regine vor, einen Spaziergang zu machen.
Eine Viertelstunde später brach die Kinderschwester mit einer Schar auf. Nur Pünktchen und Irmela blieben im Haus zurück, denn Frau Rennert wollte mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter und deren Zwillingen ebenfalls wegfahren.
»Gib ein bisschen auf Tante Reni acht«, sagte Frau Rennert leise zu Irmela. »Vielleicht wird ihr doch plötzlich bewusst, dass Manuela nicht mehr hier ist. Man sollte sie ein bisschen ablenken.«
»Ja, Tante Ma. Ich will’s versuchen.«
Pünktchen setzte sich mit einem spannenden Buch in die Sonne. Die alte Schäferhündin Bella gesellte sich zu ihr. Zwischen ihr und der Hündin bestand eine besondere Freundschaft.
»Ich schau mal, was Tante Reni macht«, sagte Irmela zu Pünktchen. »Sie war so seltsam gestern und heute. Findest du nicht auch?«
»Hm, ich glaube, sie hat zu viel Zeit zum Grübeln. Ist Magda eigentlich da?«
»Nein, sie wollte nach Schoeneich, um ihre Schwester zu besuchen.«
»Richtig komisch, wenn das Haus so leer ist. Sonst ist hier immer etwas los.«
Irmela ging zu Renis Zimmer und klopfte an die Tür. Reni hatte sich ein helles Kleid angezogen. Sie nickte Irmela ruhig zu. »Nett, dass du kommst. Ich möchte gern ein Stück spazieren gehen. Willst du mich begleiten?«
»Natürlich, Tante Reni. Gern. Pünktchen gibt aufs Haus acht. Sonst ist jetzt niemand da.«
»Wir könnten auch reiten. Es geht mir wieder gut.«
»Wenn du willst? Aber dazu müssten wir uns umziehen.«
»Macht das etwas aus? Es geht doch schnell.«
»Also gut, Tante Reni. Ich warte unten auf dich.«
Irmela zog sich blitzschnell um und nahm ihre kleine Reitgerte. Reni erschien ein paar Minuten später.
»Viel Spaß«, rief Pünktchen hinter den beiden her.
Im Stall war es sonntäglich still. Mit vereinten Kräften sattelten sie zwei Pferde.
»Nicht einmal Justus lässt sich heute blicken«, sagte Irmela verwundert.
»Wir brauchen ihn ja nicht«, antwortete Reni.
Die beiden führten die Pferde ins Freie und stiegen auf. Als sie über den Hof ritten, kam eben die Henne vorüber, die im Juni noch einmal gebrütet hatte. Ihr gelbes Kükenvolk folgte ihr mit kleinen trippelnden Schrittchen.
»Manuelas Küken«, schrie Reni auf. »Wo ist Manuela?«
Irmela erschrak. »Du weißt doch, dass sie von ihren Eltern abgeholt wurde, Tante Reni«, antwortete sie, sich zur Ruhe zwingend.
Die junge Frau wurde bleich. In ihren schönen dunklen Augen glomm ein Licht auf, vor dem Irmela sich fürchtete. Nun presste Reni die Lippen fest aufeinander und versetzte ihrem Pferd einen harten Schlag mit der Gerte. Das Tier, an solche Behandlung nicht gewöhnt, bäumte sich auf und schoss dann in ungezügeltem Galopp davon.
»Tante Reni, was tust du?« Irmelas Ruf verhallte ungehört. Ein paar Herzschläge lang zögerte sie. Dann setzte sie Reni nach. Angst schnürte ihr dabei die Brust ein.
Reni war eine ausgezeichnete Reiterin. Dennoch war jetzt nicht genau zu erkennen, ob sie ihr Pferd noch in der Gewalt hatte. Deutlich sah Irmela, dass sie nicht fest genug im Sattel saß.
Irmela versuchte, ihr eigenes Pferd in eine noch schnellere Gangart zu bringen. Dennoch verringerte sich der Abstand zwischen ihr und Reni nicht um einen Zentimeter.
Reni hielt auf den Wald zu. Irmela dachte mit Schrecken an die Gefahr, die bei solchem Tempo durch herabhängende Zweige drohte. Doch glücklicherweise wählte Reni, die bis dahin querfeldein galoppiert war, nun einen schmalen Weg. Ihr Pferd schien sich zu beruhigen oder zu ermüden. Es fiel vom Galopp in einen schnellen Trab. An einer Kreuzung entschied sich Reni ohne jedes Zögern für den Pfad, der zum großen See führte.
Was hat sie vor, dachte Irmela. Obwohl sie erst vierzehn Jahre zählte, begriff sie durchaus, wie bedenklich Renis Verhalten war und wie schlimm dieser Ritt enden konnte.
Am Ufer des Sees gelang es Irmela, Reni den Weg abzuschneiden. Ihre Stirn glühte, ihr Herz schlug wie ein Hammerwerk, die Stimme wollte ihr kaum gehorchen, weil sie völlig außer Atem war.
»Du legst wirklich ein tolles Tempo vor, Tante Reni«, äußerte sie, ihre Erregung so gut wie möglich bezwingend. »Wollen wir uns jetzt nicht ein bisschen ausruhen?«
Reni von Hellendorf sah Irmela an wie eine Fremde. »Ausruhen? Das nützt nichts, ich muss Gitti finden. Bodo hat sie entführt. Wenn wir nicht achtgeben, wird er sie in den See werfen und ertrinken lassen.«
Der bildhübschen Arzttochter wurde die Kehle seltsam trocken. Sie hat den Verstand verloren, dachte Irmela. Was soll ich jetzt tun? Ich brauche einen Arzt, schoss es ihr durch den Kopf.
»Willst du nicht mit mir nach Sophienlust zurückkommen, Tante Reni?«, fragte sie unsicher. »Du siehst doch, dass das Kind nicht hier ist.«
»Vielleicht hat sich Bodo versteckt.«
»Wir können nachsehen, Tante Reni. Aber ich glaube nicht, dass hier jemand ist.«
Reni verlor plötzlich das Interesse an der Suche. »Wir müssen Dr. Volkert fragen. Er ist sehr klug«, flüsterte sie. »Komm, reiten wir zurück!«
Schon wieder schlug sie das Pferd und schoss mit Pfeilgeschwindigkeit davon. Irmela blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Immerhin ging es jetzt auf Sophienlust zu. Das war besser als der erste Ritt mit einem völlig unbekannten Ziel.
Pünktchen saß nicht mehr vor dem Haus, als die beiden Reiterinnen in scharfem Trab vorbeikamen.
»Stellen wir die Pferde ein?«, fragte Irmela unruhig.
»Ja, aber schnell. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Man muss die Polizei einschalten, ehe es zu spät ist.«
Wo steckt Pünktchen nur, dachte Irmela verzweifelt. Wie soll ich das allein schaffen?
Erst nachdem Reni abgesessen war und sogar geholfen hatte, den beiden Pferden Sattel und Zaumzeug abzunehmen, fühlte sich das junge Mädchen etwas beruhigt. Nun konnte die Kranke wenigstens nicht mehr wie der Teufel davonreiten.
In raschem Schritt strebten die beiden auf das Haus zu. In einiger Entfernung scharrte das Hühnervolk. Die kleinen gelben Küken liefen fröhlich im Sonnenschein umher. Zu Irmelas grenzenloser Erleichterung achtete Reni nicht darauf.
»Kannst du Dr. Volkert anrufen, Irmela?«, fragte Reni atemlos.
»Ja, natürlich. Ich muss nur die Nummer heraussuchen.«
»Ich habe sie. Sage Dr. Volkert, dass er gleich kommen muss. Oder nein, zuerst soll er sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Man kann ihm das überlassen. Die Leute hören auf ihn.« Renis Stimme überschlug sich.
»Ja, Tante Reni.«
Irmela hatte sich nun etwas gefasst. Sie ist krank, und ich habe die Verantwortung, sagte sie sich und kämpfte ihre Furcht nieder.
Gemeinsam mit Reni ging sie in deren Zimmer und ließ sich die Telefonnummer von Dr. Volkert geben.
»Wilst du hier warten, Tante Reni?«, fragte sie. »Ich bin gleich wieder bei dir.«
»Ja, Irmela. Ich lege mich ein bisschen hin. Der Kopf tut mir wieder weh. Das Reiten war doch zu anstrengend. Aber was sollte ich tun? Ich muss Gitti suchen. Sage Dr. Volkert, dass sie bei Bodo ist.«
Irmela wusste, dass dies der Vorname von Renis Mann war. Sie eilte ins Büro, das sie glücklicherweise unverschlossen fand, und wählte die Nummer aus Renis Notizbüchlein. Diesmal war Ulrich Volkert sofort am Apparat.
Irmela bemühte sich, das Geschehene so klar wie möglich zu schildern. Der Arzt stellte ein paar knappe Fragen. »Ich setze mich sofort ins Auto, Irmela. Geh inzwischen zu Frau von Hellendorf und unterhalte dich mit ihr. Du brauchst keine Angst zu haben. Sie wird dir nichts tun. Aber man muss achtgeben, dass sie nicht fortläuft.«
»Ich fürchte mich nicht, Herr Doktor«, antwortete Irmela tapfer. »Mein Vater war Arzt, und ich selbst will ebenfalls Medizin studieren. Deshalb bin ich ja in Sophienlust und nicht bei meinen Eltern in Bombay.«
»Da bist du also schon fast eine Kollegin. Du hast deine Sache bisher sehr gut gemacht, Irmela. Nun musst du nur noch aushalten, bis ich da bin.«
»Sie können sich auf mich verlassen, Herr Doktor.«
Irmela legte den Hörer auf und nahm zwei Treppenstufen auf einmal, als sie zu Reni zurückkehrte. Sie fand die junge Frau in einer Art Dämmerschlummer. Nicht einmal die Reitstiefel hatte sie ausgezogen, ehe sie sich aufs Bett gelegt hatte.
»Kommt er?«, fragte Reni mit matter Stimme. »Er ist der einzige Mensch, der mir jetzt helfen kann.«
»Er ist schon unterwegs.«
Irmela blieb am Fenster stehen und hielt Ausschau, obwohl sie wusste, dass der Arzt unmöglich so schnell kommen könnte. Das liebe alte Haus war vollkommen still. Irmela konnte sich nicht erinnern, dass sie sich jemals hier so allein gefühlt hatte. Sie schluchzte einmal und warf einen scheuen Blick zum Bett. Reni von Hellendorf lag mit geöffneten Augen und starrte zur Decke.
Vielleicht muss er sie wegbringen, überlegte Irmela. Ohne Manuela wird Tante Reni hier verzweifeln. Aber man kann den netten Leuten aus Spanien doch nicht ihr Kind wegnehmen. Wie soll der Doktor da einen Ausweg finden?
Die Minuten verstrichen unendlich langsam. Irmela wagte es nicht, sich zu rühren oder zu sprechen. Nach einer halben Stunde sah sie Pünktchen unter dem Fenster vorübergehen und ihr fröhlich zuwinken. Irmela legte den Finger auf die Lippen.
Pünktchen verstand und unterdrückte den Ausruf, den sie schon auf den Lippen gehabt hatte. Wie gern hätte Irmela jetzt ein paar Worte mit Pünktchen gesprochen. Doch sie musste auf ihrem Posten bleiben, bis der Arzt kam.
Endlich fuhr das Auto vor. Reni hob sofort den Kopf. »Ist er das? Hat er Gitti gleich mitgebracht?«
»Ich weiß es nicht, Tante Reni.« Irmela war am Ende ihrer Selbstbeherrschung. Die Tränen liefen ihr über die Wangen. Doch Reni bemerkte das glücklicherweise nicht.
Der Arzt kam und beugte sich besorgt über seine Patientin, die ihm beide Hände entgegenstreckte.
Irmela verließ das Zimmer. Völlig erschöpft setzte sie sich auf die Treppe und ließ ihren Tränen freien Lauf.
Nach etwa zehn Minuten trat Ulrich Volkert wieder aus Renis Zimmer. »Sie schläft jetzt, Irmela. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel injiziert.«
»Und wenn sie wieder aufwacht?«, rief Irmela ratlos aus. »Sollten wir nicht am besten Manuela zurückholen? Man muss Tante Reni doch helfen?«
Ulrich Volkert setzte sich neben Irmela auf die Treppe und nahm deren Hand. »Nein, liebe Kollegin, das wäre jetzt ein grundlegender Fehler«, sagte er, als spreche er tatsächlich zu einer erwachsenen Ärztin. »Frau von Hellendorf hat einen schweren Verlust erlitten und wehrt sich dagegen, diesen hinzunehmen. Sie hat sich eine Scheinwelt errichtet. Aber damit ist nichts besser geworden. Die Begegnung mit dem kleinen Mädchen aus Spanien, das ihrer eigenen Tochter ein bisschen ähnlich sieht, war nicht gut für sie. Wir dürfen das nicht noch einmal versuchen.«
»Muss sie ins Krankenhaus?«
»Ich glaube nicht. Wir werden ihren Mann rufen.«
»Sie sagt, dass sie ihn nicht sehen will.«
»Aber sie muss ihn sehen, Kollegin. Es ist unsere einzige Chance. Sie behauptet, das Kind sei bei ihm. In Wirklichkeit möchte sie selbst endlich wieder dorthin zurückkehren, wo ihre Heimat ist.«
Draußen hörte man fröhliche Kinderstimmen. Schwester Regine kam mit den kleinen Bewohnern von Sophienlust ahnungslos vom Spaziergang zurück.
Irmela ging der Kinderschwester entgegen. Der Arzt folgte ihr. Plötzlich war das Haus wieder von Leben erfüllt.
Ulrich Volkert rief in Hellendorf an. Bodo kam selbst an den Apparat. Der Arzt erzählte ihm, was sich in Sophienlust ereignet hatte, und fuhr fort: »Zwar ist das alles erschreckend, Herr von Hellendorf, doch erblicke ich darin eine gewisse Chance. Es wäre wichtig, dass Sie herkämen, damit Sie bei Ihrer Frau sind, sobald sie aufwacht. Mit Ihrer Hilfe könnte es gelingen, Ihre Frau dazu zu bringen, dass sie sich nicht länger vor der Wirklichkeit versteckt.«
»Was könnte ich denn tun, Herr Doktor?«, fragte Bodo zurückhaltend. »Sie wird mir wieder ins Gesicht schreien, dass ich am Tod unseres Kindes Schuld sei. Das ertrage ich nicht mehr. Ich habe wahrhaftig lange genug Geduld gehabt und gewartet. Sicherlich ist meiner Frau am besten geholfen, wenn ich ihrem Wunsch entspreche und mich scheiden lasse. Ich bin jetzt dazu entschlossen, denn ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich werde nun genau das tun, was Reni ständig von mir fordert. Zuerst die Scheidung, dann ein neuer Anfang mit Asta Berner. Diese Frau hat in meinen bittersten Stunden zu mir gehalten. Mit ihr konnte ich sprechen, sie war immer für mich da. Ich kann nicht ein Leben lang warten und allein bleiben. In einer Ehe mit Asta Berner werde ich das, was hinter mir liegt, vielleicht nach und nach überwinden.«
Ulrich Volkert ließ Bodo reden. Er war Arzt und hatte gelernt, dass Zuhören oft wichtiger war als Sprechen. Doch sein kluges Gesicht war bleich geworden.
»Ist Ihr Entschluss endgültig, Herr von Hellendorf?«, fragte er leise.
»Ja.«
»Dann – ja, dann muss ich überlegen, ob ich Ihre Frau nicht doch in eine Klinik einweisen soll. Der Schock der Trennung von der kleinen Spanierin war zu schwer. Heilsam könnte jetzt nur die Heimkehr sein.«
»Sie würde nicht zurückkommen, Doktor. Selbst Asta Berner hat vergeblich versucht, sie dazu zu bewegen.«
»Ich kann Sie nicht zwingen, das zu tun, was ich für richtig halte. Es war eine Bitte. Garantieren könnte ich Ihnen ohnehin nicht, dass eine Begegnung zwischen Ihnen und Ihrer Frau ihren Gemütszustand ändert. Doch die Hoffnung besteht.«
»Auf unbestimmte Hoffnungen gebe ich nichts. Sie meinen es sicher gut. Nur übersehen Sie, dass Sie zu viel von mir verlangen. Leben Sie wohl, Doktor.«
Ulrich Volkert legte auf. Sein Abschiedsgruß klang höflich, aber traurig und enttäuscht.
»Asta Berner«, flüsterte er. »Ich habe so fest darauf vertraut, dass sie zu ihrem Wort stehen würde. Will sie nun seine Frau werden?«
Dr. Volkert strich sich mit der Hand das Haar zurück. Die Bewegung wirkte müde. Aber er durfte jetzt nicht grübeln. Was er selbst wünschte, war nicht wichtig.
Ulrich Volkert kehrte zu Reni von Hellendorf zurück, die in tiefem Schlaf lag. Lange saß er neben ihrem Bett und blickte sorgenvoll auf die schlanke Gestalt herab. Endlich kam er zu einem Entschluss. Er wollte noch nicht aufgeben – noch nicht.
Nachdem er sich überzeugt hatte, dass der Puls der Patientin ruhig und gleichmäßig war, verließ er das Zimmer, hielt nach Schwester Regine Ausschau und übergab ihr ein Päckchen, das eine Fertiginjektion enthielt.
»Können Sie Frau von Hellendorf das Medikament spritzen, Schwester Regine?«, erkundigte er sich.
»Selbstverständlich. Es ist ja nicht intravenös.«
»Dann bitte ich Sie, es morgen früh gegen sechs Uhr zu tun. So lange wird die Patientin schlafen. Dieses Mittel wird dafür sorgen, dass sie danach noch ein paar Stunden schläft.«
»Eine Schlafkur?«, fragte Schwester Regine interessiert.
»Nein, ich will Zeit gewinnen. Schauen Sie mal nach ihr?«
»Natürlich, Herr Doktor.«
Er nickte ihr zu. »Ich komme morgen Vormittag wieder, Schwester Regine. Empfehlen Sie mich bitte Frau von Schoenecker.«
Einige Minuten später fuhr sein Wagen ab. Schwester Regine kümmerte sich zunächst um die Kinder, wobei ihr Irmela und Pünktchen halfen. Dann betreute sie Reni, zog ihr die Stiefel und das Reitzeug aus und deckte sie zu.
Reni spürte nicht, was mit ihr geschah. Das Medikament tat seine Wirkung.
Abends kam die Familie von Schoenecker zurück. Irmela berichtete von den Geschehnissen des Nachmittags, und Denise machte sich nachträglich Vorwürfe, dass sie weggefahren war. Von Schoeneich aus telefonierte sie mit Bodo von Hellendorf und erhielt von ihm den gleichen Bescheid, den schon Ulrich Volkert erhalten hatte.
»Ich glaube, dass Reni die Freiheit braucht, um gesund zu werden, Denise«, bekräftigte er seinen Entschluss. »So wie jetzt kann und darf es nicht weitergehen.«
»Willst du wirklich dabei bleiben, Bodo?«, fragte Denise bestürzt.
»Ich muss, wenn ich nicht auch noch den Verstand verlieren soll, Denise. Vielleicht verstehst du mich nicht. Ich habe keine Kraft und keine Geduld mehr.«
Denise sagte einen kurzen Abschiedsgruß und legte auf. »Es kommt, wie ich gefürchtet habe, Alexander«, seufzte sie. »Bodo will Asta Berner heiraten. Er ist fest entschlossen, sich scheiden zu lassen.«
»Dann kann man Reni nur wünschen, dass aus ihr und dem Doktor ein Paar wird, wie Nick neuerlich vermutete. Wir können das Schicksal nicht aufhalten, Isi. Reni ist möglicherweise bei einem Nervenarzt am besten aufgehoben. Er versteht es, auf sie einzugehen.«
Denise schüttelte ärgerlich den Kopf. »Ich glaube nicht daran, dass diese Ehe auseinandergehen muss. Es gibt doch gar keinen Grund dafür.«
Alexander nahm sie in die Arme und küsste sie. »So gut wie unsere Ehe ist nun mal nicht jede, Isi. Man soll nie von sich auf andere schließen. Reni ist noch sehr jung. Sie wird bestimmt in einiger Zeit wieder gesund und fröhlich sein. Der Tod der kleinen Gitti ist sicherlich unendlich traurig, aber man muss doch bedenken, dass das Kind schwerkrank war. Der Tag wird kommen, an dem Reni das einsehen wird.«
»Hoffen wir, dass du recht hast. Wenn Dr. Volkert Reni helfen kann, sollte man sich nicht dagegen sträuben. Ich bin doch ein wenig altmodisch in meinen Ansichten.«
»Bleib’ nur, wie du bist, Isi.«
*
Es war nach elf Uhr abends, als Ulrich Volkert zum dritten Mal den Versuch unternahm, Asta Berner zu erreichen. Trotz der ungewöhnlichen Stunde wurde er diesmal sofort empfangen.
Asta sah wunderschön aus. »Ich war mit meinem Vater eingeladen, Dr. Volkert«, begrüßte sie ihn. »Es tut mir leid, dass Sie schon vergeblich hier waren.«
Er konnte die Blicke nicht von ihr wenden.
»Wollen wir uns nicht setzen, Doktor? Mein Vater war müde. Er ist gleich in sein Schlafzimmer gegangen. Aber ich bin ganz frisch. Sie haben gewiss einen besonderen Grund für Ihren Besuch?«
Ulrich Volkert blieb stehen. »Ich dachte, dass Sie bei Herrn von Hellendorf wären«, brachte er endlich stockend hervor.
Asta schüttelte den Kopf. »Nein. Ich kann nicht mehr zu ihm fahren, Doktor. Es war ein Fehler, dass ich es immer wieder getan habe. Sie haben mir keinen guten Rat erteilt.«
»Ich verstehe Sie nicht …«
Astas Wangen röteten sich »Bodo von Hellendorf hat sich plötzlich zur Scheidung von seiner Frau entschlossen und will mich heiraten.«
»Ja, das hat er mir heute Nachmittag am Telefon auch mitgeteilt.«
»Ich habe alles versucht, um ihm klarzumachen, dass er sich nicht von Reni trennen darf. Außerdem habe ich …« Asta stockte.
Ulrich Volkert trat auf sie zu. In seinem Gesicht leuchtete jähe Freude auf. »Was haben Sie, Asta?«
»Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn niemals heiraten könnte, weil ich ihn nicht liebe«, flüsterte sie. »Diese Liebe war damals nur eine Träumerei. Sie hat nicht standgehalten. Zunächst glaubte ich, dass ich diesen Schlag nie verwinden würde. Jetzt weiß ich, dass es so hat kommen müssen.« In ihren Augen erwachte ein wundervolles Leuchten. Es gab mit einem Schlage nichts mehr, was sie von Ulrich Volkert trennte.
»Ja, Asta – so und nicht anders. Es ist mir bitter schwer geworden, dich immer wieder zu ihm gehen zu lassen. Ich wollte aber nicht egoistisch sein.«
»Es war ein Fehler.«
Ulrich Volkert nahm Asta in die Arme. »Ja, Asta, es war ein Fehler. So ein Doktor ist eben auch nur ein Mensch.«
Sie lachte und weinte in einem Atemzug. »Ich glaube, ich bin nur dir zuliebe weiter zu ihm gegangen. Ich wollte das tun, was du für richtig hieltest, Ulrich. Aber es ist nichts Gutes daraus geworden.«
Sein Mund legte sich auf den ihren. »Doch, Asta. Wir beide haben einander gefunden. Ich liebe dich seit unserer ersten Begegnung. Aber ich fürchtete, dass du deine enttäuschte Liebe nicht vergessen könntest. Trotzdem war ich sicher, dass du niemals in die Ehe der Hellendorfs einbrechen würdest. So etwas bringst du nicht fertig. Deshalb konnte ich auch das, was Bodo von Hellendorf mir heute mitteilte, nicht glauben.«
»Ich habe ihm heute einen langen Brief geschrieben. Morgen wird er ihn bekommen. Wenn ich ihm gegenübersitze, ist es schwer, ihm zu erklären, warum ich niemals seine Frau werden kann. Das lässt sich besser schriftlich mitteilen. Ich denke, er wird mich verstehen.«
»Asta, jetzt hast du schon mehrmals gesagt, dass du Bodo von Hellendorf nicht heiraten willst. Aber wie du zu mir stehst, weiß ich immer noch nicht.«
Sie schlug die klaren graublauen Augen zu ihm auf. »Weißt du das wirklich nicht, Ulrich?«, entgegnete sie lächelnd.
»Sag’ mir, dass du mich liebst, Asta. Ich will es hören.«
»Ich liebe dich, Dr. Ulrich Volkert. Ich liebe dich viel zu sehr. Aber ich hätte nie zu hoffen gewagt, dass auch du mich liebhast.« Ihre Stimme klang wie eine Glocke.
»Dein Vater wird wieder nicht einverstanden sein, fürchte ich. Ich bin Arzt, nicht Ingenieur.«
»Ich bin siebenundzwanzig Jahre alt, Ulrich, und glaube, dass ich selbst über meine Zukunft zu entscheiden habe. Für die Fabrik lässt sich gewiss ein guter Ingenieur als leitender Direktor finden.«
»Bedeutet das, dass du mir keinen Korb gibst?«
»Bestimmt nicht, Ulrich. Glück und Liebe sind etwas Kostbares, das man mit beiden Händen festhalten soll, damit es keine Scherben gibt. Eine Fabrik ist nicht so empfindlich. Das wird auch mein Vater einsehen.«
»Dann frage ich dich hiermit in aller Form, ob du meine Frau werden willst, Asta.«
»Und ich antworte dir in aller Form, dass ich mir nichts Schöneres auf der Welt denken kann.«
Astas teures Kleid wurde zerdrückt. Sogar ein paar Tränen fielen auf die glänzende Seide. Doch es waren Freudentränen.
»Was machen wir aber nun mit Reni und Bodo?«, fragte Asta nach einer Weile. »Wir dürfen diese Scheidung nicht zulassen. Es wird schwer werden, denn die beiden sind dazu entschlossen. Trotzdem gehören sie zusammen.«
»Ihr Mann muss zu ihr. Ich habe zu einem etwas hinterlistigen Mittel gegriffen und sie mit einem Medikament eingeschläfert. Schwester Regine wird die Injektion gegen Morgen wiederholen. Bis elf oder zwölf Uhr müssen wir ihren Mann zu ihr bringen.«
»Vielleicht versetzt du ihn ebenfalls in Narkose«, scherzte Asta. »Du scheinst mir ein gefährlicher Mensch zu sein.«
Ulrich Volkert erklärte ihr, warum er einen Tiefschlaf im Augenblick für das Beste gehalten habe.
Asta neigte den Kopf. »Schon gut, Ulrich. Ich bin sicher, dass du niemals leichtfertig handeln würdest. Was hältst du davon, Bodo unsere Verlobung mitzuteilen? Muss ihn das nicht gewaltsam auf den Boden der Tatsachen zurückführen? Zumindest kann er sich dann keine Hoffnung mehr auf mich machen.«
»Dein Vorschlag ist klug. Du hättest Medizin studieren sollen.«
»Warten wir erst ab, wie es ausgeht, Ulrich. Er soll zu Reni. Einmal muss dieser schreckliche Zustand doch ein Ende finden. Dann wären Begegnung und Abschied von der kleinen Manuela schließlich doch heilsam für Reni gewesen.«
»Wir müssen es abwarten, Asta. Nach allem, was Bodo von Hellendorf gestern am Telefon äußerte, wird es nicht leicht sein, ihn umzustimmen. Er ist an einem Punkt angekommen, an dem er um jeden Preis Schluss machen will.«
»Ich werde mit ihm reden, Ulrich. Mein Brief muss schon morgens dort sein. Die Post kommt früh an in Hellendorf. Wenn ich ihn gegen neun Uhr anrufe, sollte er den Brief bereits gelesen haben.«
»Wenn du das versuchen willst, Asta?«
»Wer so glücklich ist wie ich, hat nur den einen Wunsch, auch andere glücklich zu sehen, Ulrich. Man kann Renis Töchterchen nicht wieder lebendig machen. Aber ich hoffe, dass wir Reni und Bodo helfen können.«
Ulrich Volkert nahm das schöne Mädchen noch einmal fest in die Arme. »Ohne dich wäre es vielleicht nicht möglich, Asta«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich selbst habe einen Fehler nach dem anderen gemacht. Wissenschaft und guter Wille genügen nicht, um einen Beruf erfolgreich auszuüben. Man muss gelegentlich den Rat der Frau einholen können, von der man geliebt wird und die man liebt.«
»Du machst mich stolz und glücklich, Ulrich.«
Er sah auf die Uhr. »Ich darf jetzt nicht länger bleiben. Wir brauchen beide wenigstens ein paar Stunden Schlaf. Wirst du in Hellendorf anrufen und mir danach mitteilen, was du erreicht hast?«
»Mein Wort darauf, Ulrich.«
Arm in Arm gingen die beiden durch die Halle. Dann winkte Asta dem Mann ihres Herzens nach, als er langsam davonfuhr. Ihr Gesicht war wie von innen erhellt. In ihren Augen leuchtete das Glück.
*
Bodo von Hellendorf legte den Hörer auf. Seine Hand zitterte. Das Gespräch mit Asta hatte ihn tief erschüttert. Er griff in die Schublade seines Schreibtisches und zog den Brief hervor, den er am frühen Morgen erhalten hatte. Es war Astas endgültiges Nein. Und nun hatte sie ihm auch noch mitgeteilt, dass sie Ulrich Volkerts Frau werden wolle, und ihn beschworen, Reni nicht im Stich zu lassen, sondern ihr beizustehen. Anfangs hatte er sich gewehrt. Zuletzt aber war er nicht mehr imstande gewesen, sich Astas Drängen zu widersetzen. Er hatte das feste Versprechen gegeben, innerhalb der nächsten Stunde nach Sophienlust zu fahren.
Kann ich das überhaupt, fragte er sich nun. Habe ich Reni nicht schon viel zu lange warten lassen?
Bodo stand auf, stieg die Treppe hinauf und betrat das Zimmer, in dem Gitti geschlafen hatte. Das weiße Bettchen stand noch so da wie früher. Das Spielzeug lag im Regal.
Bodo von Hellendorf stand lange neben dem kleinen Bett. Dann schöpfte er tief Atem und verließ das Zimmer wieder. Er suchte die getreue Emmi auf und sagte ihr, dass er nach Sophienlust fahren wolle.
Emmi stellte keine Fragen. Sie nickte nur. »Das ist gut.«
»Ich weiß nicht, ob es gut ist, Emmi«, zweifelte Bodo.
»Aber ich weiß es.« Emmis Stimme klang wie die einer Mutter. Es ging Trost und Zuversicht von ihr aus.
Bodo holte seinen Wagen aus der Garage und fuhr in raschem Tempo davon. Emmi, die sonst immer tätig war, ließ die Hände sinken und faltete sie zu einem stillen Gebet.
*
Reni konnte sich zunächst nicht erinnern, wo sie war. Sie fühlte sich matt, aber auf eine seltsame Weise erfrischt. Nur zögernd schlug sie die Augen auf. Es war heller Mittag.
Jemand hielt ihre Hand. Reni wandte den Kopf und erkannte, der Mann auf dem Sessel neben dem Bett war Bodo.
»Ich habe lange geschlafen«, sagte sie unsicher.
»Ja, ich bin schon eine ganze Weile bei dir.« Seine Finger umschlossen ihre Hand fester. »Möchtest du etwas zu trinken haben? Ich soll dich fragen.«
»Ein bisschen Tee, bitte. Ich bin durstig.«
Bodo stand auf und läutete. Irmela erschien an der Tür. Wenig später brachte sie ein Tablett mit einer Kanne und zwei Tassen. Auch der Zucker war nicht vergessen.
Reni trank und seufzte dankbar auf. »Das tut gut, Bodo.«
»Fühlst du dich besser?«, fragte er behutsam.
»Bin ich krank?«
»Nein, Reni. Aber du hast mich bisher nicht sehen und nicht sprechen wollen.«
»Ich weiß, Bodo. Ich habe nichts vergessen.«
»Reni, du musst mir verzeihen«, stieß er hervor und beugte sich über sie. »Ich könnte nicht ertragen, dass du glaubtest, ich sei schuld an Gittis Tod. Statt dir zu helfen habe ich nur immer versucht, dich durch andere Leute davon zu überzeugen, dass mich keine Schuld trifft. Du bist ganz allein gewesen mit diesem furchtbaren Leid. Wollen wir versuchen, gemeinsam damit fertig zu werden?«
Der tiefe Schlaf hatte Reni über die kritische Schwelle schreiten lassen. Das aufrichtige Bemühen ihres Mannes, ihr zu helfen, brach nun den letzten Bann. Sie lächelte unter Tränen, als sie sagte: »Arme kleine Gitti. Niemand hat gewusst, dass sie so krank war. Jetzt ist sie ein Englein im Himmel.«
Bodo legte seine Lippen auf ihren blassen Mund.
»Ja, Reni. Sie ist bestimmt ein Engel. Wir müssen es hinnehmen und ertragen, dass sie nicht bei uns bleiben durfte. Aber unsere Liebe darf daran nicht scheitern.«
Reni schmiegte die feuchte Wange in seine Hand. »Es ist, als wäre ich von einer langen Reise zurückgekommen, Bodo. Es war eine Irrfahrt. Das sehe ich jetzt ein. Aber ich konnte nicht anders. Es trieb mich mit böser Macht fort. Darf ich jetzt zurück zu dir nach Hellendorf? Ich habe Heimweh.«
»Wir fahren gleich ab, Reni.«
Seine starken Arme umschlossen sie. Sie fühlte seine Kraft und seine Liebe.
»Ich möchte zu Gittis Grab, Bodo. Erst wenn ich an ihrem Grab war, schließt sich der Kreis.«
Reni stand auf. Sie war blass und schwankte ein wenig. Aber ihre dunklen Augen blickten klar, und ihr Gesicht wirkte nicht mehr wie eine Maske, sondern war tief von innen her belebt.
Während Reni sich wusch und ankleidete, nutzte Bodo die Zeit, um dem wartenden Dr. Volkert und Denise von Schoenecker Bescheid zu geben.
»Ich bin nun nicht mehr vonnöten«, sagte der Arzt. »Ihre Frau ist gesund. Ihr Wunsch, endlich die letzte Ruhestätte ihres Kindes zu besuchen, ist ein klarer Beweis dafür.«
Bodo streckte ihm die Hand hin. »Sie und Asta haben mich in letzter Minute vor einem Schritt zurückgehalten, der uns nur Unglück gebracht hätte. Ich danke Ihnen, Doktor.«
»Bedanken Sie sich bei Asta. Ich habe nämlich in dieser Sache ein paar Fehler gemacht. Aber das ist jetzt glücklicherweise nicht mehr wichtig.«
Nachdem Bodo von Hellendorf das Biedermeierzimmer verlassen hatte, küsste Ulrich Volkert Denise die Hand und erklärte: »Nicht nur von Asta habe ich allerlei zu lernen, sondern auch von Ihnen. Darf ich einmal wiederkommen, auch wenn ich hier keine Patientin mehr habe?«
»Sie sollen uns immer willkommen sein, Doktor. Ein wenig gehören Sie nun schon zu unserer Gemeinschaft.«
Dr. Volkert verabschiedete sich. Er meinte, es sei besser, wenn er Reni von Hellendorf jetzt nicht begegne. Das unmittelbare Gespräch mit ihrem Mann sei wichtiger.
»Und Sie wollen zu Asta Berner, nicht wahr?«, fügte Denise mit warmem Verständnis hinzu.
»Auch das, gnädige Frau. Es wäre eine Lüge, das abzustreiten.«
Kurz nachdem Ulrich Volkert Sophienlust verlassen hatte, erschienen Bodo und Reni im Biedermeierzimmer.
»Bist du böse, wenn wir noch heute nach Hellendorf zurückfahren, Denise?«, fragte Reni. »Sicher hältst du mich für undankbar. Aber ich muss endlich nach Hause.«
»Gewiss sollst du nach Hause, Reni.«
»Ich habe meine Koffer schon gepackt«, gestand Reni. »Wir könnten gleich fahren.«
»Wollt ihr noch eine Kleinigkeit essen?«, bot Denise an.
»Unsere Emmi macht uns gern etwas«, versicherte Bodo. »Verzeih, wenn wir es plötzlich so eilig haben. Wir kommen in ein paar Tagen wieder und machen dann einen Dankbesuch.«
»Nicht nötig, Bodo. Wir freuen uns mit euch. Zu gegebener Zeit werden wir uns schon wiedersehen.«
Die Koffer wurden zum Auto getragen.
Reni lächelte wehmütig, als sie die stolze Henne mit ihren Juniküken jenseits der Hecke vorbeiziehen sah. »Manuela«, sagte sie leise. »Wir müssen etwas für das Kind tun, Bodo. Ihre Eltern sind sehr arm, aber Manuela soll in eine gute Zukunft hineinwachsen. Ist es dir recht?«
»Natürlich, Reni.«
»Wir werden die Familie aufsuchen und ein Sparkonto für das Kind anlegen. Wenn Manuela größer ist, können wir dafür sorgen, dass sie den Beruf erlernt, den sie sich wünscht. Dieses Kind hat mir sehr geholfen. Meinst du nicht?«
Bodo streifte ihre Wange mit den Lippen. »Ja, Reni. Du hast die Begegnung mit Manuela Cortez wohl gebraucht.«
»Aber auch den Abschied von ihr, Bodo«, fügte Reni hinzu. »Ich weiß nun, dass ich kein Recht habe, den Eltern das Kind abzuverlangen, wie ich mir einbildete. Manuela soll in der Familie aufwachsen, zu der sie gehört. Ich bin sicher, dass man mit ihrer Mutter und ihrem Vater Freundschaft schließen kann. So werden wir Manuela nie ganz aus den Augen verlieren, hoffe ich.«
Schwester Regine und Irmela hatten unauffällig dafür gesorgt, dass es ausnahmsweise einmal keinen großen Bahnhof beim Abschied von Sophienlust gab. Sie beschäftigten die Kinderschar so geschickt, dass die Abfahrt des Hellendorfer Wagens kaum bemerkt wurde.
*
Die Sommerferien hatten angefangen. Reni war schon mehrmals zu Besuch in Sophienlust gewesen und hatte mit allen Kindern gespielt. Sie hatte auch erzählt, dass Maria und Fernando Cortez jetzt eine hübsche Wohnung in Maibach bekommen hätten, und sie brachte Grüße von Manuela mit.
An einem besonders heißen Nachmittag erschien Reni unangemeldet in Schoeneich und fuhr nach Sophienlust weiter, weil man ihr sagte, dass Denise dort zu finden sei. Sie wollte die Freundin allein sprechen, doch das erwies sich als recht schwierig, denn die Bewohner des Hauses der glücklichen Kinder befanden sich in großer Aufregung. Denise bemühte sich, die Wogen ein wenig zu glätten. Sie stand mitten in der Kinderschar und hielt einen Brief in der Hand, den sie nur stückweise vorlesen konnte, weil sie immer wieder von den Ausrufen und Fragen unterbrochen wurde.
»Verzeih, Reni. Du musst dich gedulden«, rief Denise der Freundin zu.
»Es gibt wieder eine Hochzeit«, mischte sich Henrik ein, der seiner großen Freundin sofort entgegenlief. »Dein Doktor heiratet. Weißt du das schon?«
»Aber ja, Henrik. Das war doch kein Geheimnis.«
»Wir dachten, die beiden heiraten in Sophienlust«, äußerte Pünktchen mit deutlicher Enttäuschung. »Hochzeiten sind doch das Schönste auf der Welt.«
»Wenn ihr mich endlich weiterlesen lassen würdet, wäre das sehr nett«, bat Denise.
»Psst – psst, Tante Isi liest weiter!«
Allmählich kehrte Ruhe ein, und Denise las: »Am liebsten würde Ulrich die Kinder von Sophienlust vollzählig zu unserer Hochzeit einladen, liebe Frau von Schoenecker …«
»Warum tut er’s dann nicht?«, unterbrach Nick seine Mutter.
»Kann ich denn nicht einen einzigen Satz zu Ende lesen? Ihr seid wirklich sehr ungeduldig. Die Überraschung kommt ja noch.«
Wieder beschwichtigten sich die Kinder gegenseitig.
»… leider würde das für meinen alten Vater ein bisschen zu aufregend und anstrengend werden.«
»Wir sind doch nicht anstrengend«, empörte sich Vicky.
»Rrrruhe!«, kommandierte Nick, der seine Mutter eben erst selbst unterbrochen hatte.
»Deshalb haben wir gedacht, dass wir einen Polternachmittag am Tag zuvor veranstalten. Wir erwarten dazu alle Kinder und alle erwachsenen Bewohner des Hauses, Magda nicht zu vergessen. Mit den Bussen müsste sich der Transport wohl durchführen lassen. Wenn nicht, schicke ich einen großen Omnibus aus unserer Fabrik. Wir freuen uns sehr auf dieses Fest.«
»Also doch ein Fest«, strahlte Pünktchen. »Wir müssen uns etwas ausdenken. Eine Aufführung vielleicht.«
»Wir können auch etwas singen«, überlegte Angelika laut.
Denise kam nicht dazu, den Schluss des Briefes von Asta Berner vorzulesen. Die Kinder begannen augenblicklich, Pläne für ihre Darbietungen zu entwerfen. Pünktchen fiel dann noch ein, dass Manuela auch eingeladen werden müsste. »Findest du nicht, Tante Isi? Sie gehört wirklich dazu.«
Reni von Hellendorf hob die Hand. »Manuela wird Blumen streuen«, rief sie. »Asta Berner hat es mir heute früh am Telefon gesagt.«
»Die Glückliche«, seufzte Irmela. »So eine Hochzeit ist nämlich wunderbar. Als meine Mutti zum zweitenmal heiratete, war es wie ein Märchen.«
»Erzähle uns ein bisschen, Irmela«, baten die kleinen Mädchen mit blanken Augen.
Denise ergriff Renis Hand. »Jetzt sind wir sie endlich los. Sie sind mit vergangenen und zukünftigen Hochzeiten ausreichend beschäftigt.«
Im Biedermeierzimmer war es angenehm kühl. Denise bestellte eine Limonade für Reni.
»Ihr geht auch zur Hochzeit?«, fragte Denise.
»Natürlich, Denise. Ihr doch ebenso.«
»Ja, wir wurden auch eingeladen. Ich bin unendlich glücklich über diese Verbindung.«
»Ich freue mich sehr für Asta. Sie verdient einen Mann wie den Doktor. Meinst du nicht, dass die beiden großartig zueinanderpassen?«
»Ganz gewiss, Reni. Ich finde es besonders nett, dass sie Manuela zum Blumenstreuen eingeladen haben.«
»Sie bekommt von mir ein neues Kleid dafür. Ich glaube, rosa Stickereistoff müsste ihr gut stehen.«
»Du bist oft mit Manuela und ihren Eltern beisammen?«
»Ja, wir verstehen uns sehr gut. Manuelas Eltern sparen jeden Cent, um sich bald in Spanien ein Haus bauen zu können.«
»Wahrscheinlich bleiben sie nicht bis in alle Ewigkeit hier. Manuela wird dir dann wohl doch fehlen, Reni.«
Die junge Frau lächelte. »Erstens dauert es mit dem Flugzeug nicht allzu lange bis nach Spanien, und zweitens werden wir im nächsten Jahr wieder ein Kind haben. Dann bleibt mir sowieso nicht mehr so viel Zeit, ständig nach Maibach zu fahren.«
Denise küsste Reni auf beide Wangen. »Ich wünsche dir alles, alles Gute, Reni. Bist du gekommen, um mir diese gute Nachricht zu überbringen?«
»Ja, Denise. Bodo und ich meinten, dass du die Erste sein sollst, die es erfährt. Wir möchten dich bitten, die Patenschaft zu übernehmen.«
»Von Herzen gern, Reni. Ich freue mich sehr für euch.«
»Wir sind uns sogar schon wegen des Namens einig«, gestand Reni ein bisschen verlegen. »Wenn es ein Junge wird, muss er Henrik heißen, ein Mädchen Manuela.«
»Zwei arg verschiedene Namen. Findest du nicht auch?«
»Die beiden Kinder waren meine besten Freunde in Sophienlust, Denise. Ich will an diese Zeit erinnert werden. Man soll das Leid nicht vergessen, sondern dankbar sein, wenn man Hilfe in der Not gefunden hat.«
»Hilfe in der Not«, wiederholte Denise von Schoenecker sinnend und blickte zu dem Gemälde der Sophie von Wellentin auf. »Immer wieder erfüllt sich, was Nicks Urgroßmutter wollte. Möge es so bleiben.«
Von draußen hörte man die Kinder, die laut und voller Eifer durcheinanderredeten. Die beiden Frauen lauschten den hellen Stimmen.
»Ich habe hier mein Glück wiedergefunden, Denise«, sagte Reni von Hellendorf versonnen.