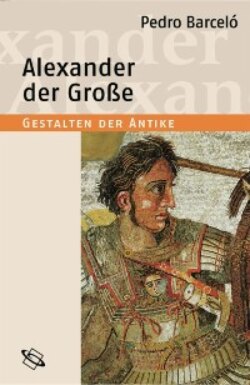Читать книгу Alexander der Große - Pedro Barceló - Страница 12
Kindheit und Jugend Umgeben von Olympias, Philipp II. und Aristoteles
ОглавлениеAlexander III., der später den Beinamen der Große erhalten wird1, kam im Juli des Jahres 356 in Pella zur Welt, als zweitältester Sohn Philipps II.2, der damals erfolgreich in Poteideia auf der Chalkidike Krieg führte und darüber hinaus einen Sieg bei den Olympischen Spielen verbuchen konnte. Ob Alexanders Geburtsdatum mit dem Brand des Artemistempels von Ephesos zeitlich zusammenfiel, was aus rückschauender Perspektive Anlass für alle möglichen Spekulationen und Weissagungen gab, sei dahingestellt.3
Seine Mutter Olympias war die Tochter des epeirotischen Königs Neoptolemos aus dem Stamme der Molosser, die zu den Griechen gezählt wurden.4 Vermutlich hatten sich die Eltern in Samothrake anlässlich des Mysterienkultes der Kabiren kennen gelernt und etwa ein Jahr vor Olympias’ Niederkunft geheiratet. Da beide aus Königshäusern stammten und die Stiftung einer Ehe stets der Familienpolitik untergeordnet blieb, ist die berichtete wechselseitige Zuneigung wohl eine Erfindung späterer Autoren.5 Denn diese Hochzeit entsprach den standesgemäßen Erwartungen, die an ein Mitglied des Argeadenhauses gestellt wurden. Philipp II., der damals ganz mit der Konsolidierung seines Throns beschäftigt war, konnte sich damit Hoffnungen auf ein engeres Zusammenrücken zwischen beiden Ländern machen. Für das epeirotische Königshaus dürften ähnliche Gedanken eine Rolle gespielt haben. Die dort regierenden Aiakiden erhofften sich von diesem Bündnis eine Ausweitung ihres Einflusses nach Osten.6
Die willensstarke, adelsstolze Olympias zeichnete sich durch ausgeprägtes Selbstbewusstsein, Leidenschaft und Extravaganz aus. Sie war politisch gebildet und vielseitig interessiert. Ihr Ehrgeiz wog nicht weniger als ihre Begabung.7 Sie schenkte Philipp II. um 355 noch eine Tochter, Kleopatra. Doch es gab noch weitere Nachkommenschaft Philipps II. Gemäß den Gepflogenheiten des Argeadenhauses, wo Polygamie nicht unüblich war, ging Philipp II. vor der Ehe mit Olympias und auch danach verschiedene Bindungen ein, aus denen Nachkommen hervorgingen. Mit der Thessalierin Philina8 zeugte er Philipp Arrhidaios, seinen ältesten Sohn, der allerdings aufgrund einer Behinderung nur bedingt als herrschaftstauglich galt. Philipps II. letzte und jüngste Frau, Eurydike Kleopatra9, gebar Karanos, einen weiteren Stiefbruder Alexanders, und Europe. Darüber hinaus sind Phila, Audata, Meda und Nikesopolis als weitere Frauen Philipps II. bekannt.10 Sie gebaren ihm mehrere Töchter – Kyna und Thessalonike –, die Philipp II. als potenzielle Ehepartnerinnen für seine ambitionierte Machtpolitik sicher gelegen kamen. Denn durch Ehebündnisse wurden damals Allianzen mit den Nachbarn geschlossen und befestigt. Eine Rangordnung zwischen den Frauen Philipps II. scheint nicht bestanden zu haben.11 Wenn Olympias als rechtmäßige Gattin apostrophiert wird, dann deswegen, weil die epeirotische Königstochter als Mutter des präsumtiven Thronerben hervorstach. Doch ist keineswegs sicher, ob sie eine Sonderstellung gegenüber den anderen Frauen beanspruchen konnte. Wahrscheinlich entstand diese Einschätzung erst nachträglich wegen der alles überragenden Bedeutung ihres Sohnes Alexander.
Abb. 8: Olympias.
Abb. 9: Königliche Löwenjagd in Makedonien. Fries aus dem sogenannten Philippsgrab in Vergina.
Dieser wuchs in der Königsresidenz Pella auf. Die aufstrebende, moderne Stadt bildete das Schaufenster Makedoniens zur Außenwelt.12 Sie lag am Fluss Lydias und hatte Zugang zum Meer, da die antike Küstenlinie weiter im Norden verlief als die heutige. Der Ort war mit prächtigen Tempelbauten, großen Stadthäusern und prachtvollen Palästen geschmückt. In einem davon, in dem vor zwei Generationen errichteten Prunkbau des kunstsinnigen Königs Archelaos, verbrachte Alexander seine ersten Jahre. Da die Kindheit des Prinzen mit dem eruptiven Aufstieg Makedoniens zur führenden Macht in der Ägäis zusammenfiel und sein Vater die treibende Kraft dieses Prozesses war, dürfte er wenig Zeit für die Erziehung seines Sohnes erübrigt haben, und so war es vor allem Olympias, die sich dieser Aufgabe mit Hingabe widmete.13 Sie sorgte zunächst dafür, dass die aus dem makedonischen Adel stammende Lanike, die Schwester von Alexanders späterem Kampfgefährten Kleitos, als Amme zur Verfügung stand. Ferner achtete sie darauf, dass ihr Sohn eine gründliche religiöse Erziehung erhielt.14
Sein erster Lehrer war Leonidas, ein Verwandter seiner Mutter, der als fähiger, aber auch strenger, teils kleinlicher Pädagoge geschildert wird. Er soll seinen Schüler zu Maßhalten und Abhärtung angehalten und ihm die Vorzüge einer einfachen Lebensweise vermittelt haben. Für Alexanders literarische Ausbildung wurde Lysimachos aus Akarnanien verpflichtet, der dem wissbegierigen und aufnahmefähigen Jungen die wichtigsten Werke der griechischen Dichtkunst näherbrachte. Er nannte ihn den „kleinen Achilleus“ und weckte durch die Lektüre von Ilias und Odyssee die Faszination seines Schülers für die Welt Homers.15 Weitere, uns namentlich nicht bekannte Lehrer unterrichteten ihn in Mathematik, Musik und Geometrie. Alexander blieb auch später mit ihnen in Verbindung. Lysimachos wird er später sogar auf seinen Persienzug mitnehmen. Es gibt eine Reihe von Anekdoten über Alexanders Verhältnis zu seinen Lehrern, was zeigt, wie bedeutend sie für seine Entwicklung waren.16
Auch die körperliche Ertüchtigung hatte neben dem Schulbetrieb einen hohen Stellenwert für den künftigen Herrscher. Vor allem die Jagd hatte es dem königlichen Prinzen angetan. Schon früh übte er sich in dieser für die makedonische Adelswelt so charakteristischen Betätigung, der er sein Leben lang leidenschaftlich nachgehen sollte. Wie beliebt das Jagen war und wie sehr es den Repräsentationsbedürfnissen der Führungseliten entsprach, unterstreicht ein prächtiges Gemälde aus der Grabanlage von Aigai (Vergina). Es zeigt, wie eine adlige Gesellschaft eindrucksvoll mit Jagen beschäftigt ist; ob Philipp II., Alexander und ihre Gefährten hier dargestellt worden sind, bleibt ungewiss.17
Die erste zeitgenössische Erwähnung Alexanders wird auf das Jahr 346 datiert, als sich eine athenische Gesandtschaft am Königshof in Pella zu Friedensverhandlungen aufhielt. Nach dem Nachtmahl soll der etwa zehnjährige Alexander auf der Lyra Gedichte vorgetragen und danach ein Streitgespräch mit anderen Epheben geführt haben.18 Die Überlieferung dieser Begebenheit ist symptomatisch: Wir erfahren nur etwas darüber, weil der Auftritt des angeblich feminin wirkenden Knaben in Athen Anlass für Gerede gegeben haben soll. Homosexualität war in der hellenischmakedonischen Welt nicht ungewöhnlich, und homoerotische Beziehungen genossen eine weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz. Zahlreichen Mitgliedern der Führungsschicht wurden Männerliebschaften nachgesagt, so auch Philipp II. und später Alexander.19
Die nächste bekannte Episode aus seinen Jugendtagen hat mit seinem Lieblingspferd Bukephalos zu tun. Durch Geschick und Unerschrockenheit gelang es ihm offenbar, das wilde Tier zu zähmen, das von nun an sein zuverlässiger und treuer Begleiter werden sollte.20 Beide Szenen, der behütete Jüngling und der furchtlose Draufgänger, scheinen sich zu widersprechen. Doch letztlich verdeutlichen sie nur diverse Facetten eines komplexen Charakters, der von widersprüchlichen Neigungen und Affekten bestimmt wurde. Der Königssohn konnte ebenso gut rezitieren wie reiten, er war ein Mensch des Geistes und der Tat. Dabei scheinen sich seine überdurchschnittlichen Begabungen bereits im Knabenalter abgezeichnet zu haben.21 Alexander lebte einerseits in der höfischen Atmosphäre des Palastes, umgeben von Lehrern und Erziehern. Andererseits wuchs er inmitten einer grobschlächtigen, von Wettbewerb und Ruhmsucht geprägten Umgebung auf, in der ästhetische und sinnliche Genüsse, worunter auch die gleichgeschlechtliche Liebe fiel, sich mit Bluttaten abwechselten.22 Einen Eber oder einen Feind eigenhändig zu erlegen, vermehrte das Prestige des Siegers. Kämpfen und Töten waren in der makedonischen Adelswelt wenig anstößig. Hauptsache war, dass man dabei erfolgreich blieb.
In dieser für die Psyche eines jeden heranwachsenden Menschen wichtigen Zeit der geistigen Charakterbildung und körperlichen Ertüchtigung verstärkte sich die Bindung zwischen Olympias und ihrem im Geist der homerischen Adelsethik aufwachsenden Sohn. Sie gab dem aufgeweckten Prinzen den nötigen Halt, um sich in der komplizierten familiären Atmosphäre des Königshofes zurechtzufinden. Beide verfolgten das gleiche Ziel: Alexander sollte eines Tages als Erbe Philipps II. den Thron besteigen. Da aber keine festen Regeln für die Thronfolge existierten, war diese noch lange nicht entschieden. Voraussetzung für eine Proklamation war die Zugehörigkeit zum Argeadenhaus, aber diese Bedingung erfüllte stets eine Reihe von Kandidaten.23 Philipp II. war selbst erst an die Macht gekommen, nachdem bereits zwei Brüder vor ihm regiert hatten. Diese besaßen wiederum Nachkommen, die ihrerseits für eine Thronbesteigung jederzeit in Frage kamen. Der von Philipp II. verdrängte Amyntas IV. war ein potenzieller Anwärter ebenso wie Alexanders Stiefbruder Philipp Arrhidaios. Am Ende der Regierungszeit Philipps II. sollte noch Karanos hinzukommen. Dennoch galt Alexander als der ernsthafteste Aspirant auf die Nachfolge seines Vaters. Seine hohe Geburt und seine ausgezeichneten Anlagen prädestinierten ihn für die anspruchsvolle Aufgabe.
Andererseits bestand für Nachfolgediskussionen wenig Bedarf, denn Philipp II. befand sich auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Er bestimmte die Richtung der auf Expansionskurs angelegten makedonischen Politik. Die erzielten Erfolge gaben ihm Recht, und so konnte er sich der uneingeschränkten Anerkennung seiner Landsleute sicher sein. Dabei stach besonders die Radikalität seiner Kriegführung hervor. War es bisher üblich, den Besiegten nach dem Gefecht abziehen zu lassen und sich auf die Behauptung des Schlachtfeldes sowie auf die Errichtung von Siegestrophäen zu beschränken, so gingen seine Soldaten dazu über, jeden feindlichen Widerstand niederzuschlagen. Nach dem Sieg auf dem Kampfplatz wurde der Feind mit Hilfe der Reiterei verfolgt und dezimiert.24 Den Gegnern keinerlei Schonung zu gewähren, wurde ein Markenzeichen seiner Militäraktionen.
Parallel dazu zeigte sich Philipp II. auf dem diplomatischen Parkett nicht minder entschlossen. So etwa in Thessalien, wo es ihm aufgrund seines Ansehens und Geschicks gelang, zum höchsten Amtsträger des Thessalischen Bundes gewählt zu werden.25 Damit geriet Nordgriechenland 352 unter seinen unmittelbaren Einfluss. Wenig später folgte eine Intervention in Mittelgriechenland, dem Tor nach Böotien,Attika und zur Peloponnes. Er zog gegen die Phoker, die den Tempelschatz von Delphi geraubt hatten, und schlug sie auf dem Krokusfeld bei Pagasai, wo er im Anschluss an den Feldzug eine Flottenstation errichten ließ. An den Besiegten, ihre Zahl ging in die Tausende, statuierte er ein grausiges Exempel, indem er sie im Meer ertränken ließ.26 Sein weiterer Vormarsch nach Süden wurde jedoch von spartanischen, athenischen und achaiischen Truppen an den Thermopylen vereitelt. Daraufhin wandte er sich nach Thrakien. Geschickt nutzte er die dort ausgebrochenen Stammesstreitigkeiten, um seinen Einflussbereich bereits 351 bis zum Hellespont auszudehnen.27
Von größter Tragweite für die territoriale Konsolidierung der Argeadenherrschaft war allerdings die Eroberung Olynths, welche den Anschluss der griechisch besiedelten Halbinsel Chalkidike an Makedonien 348 nach sich zog.28 Philipp II. erwarb damit ein ökonomisch und handelspolitisch wertvolles Gebiet, das die Hellenisierung Makedoniens beschleunigte und darüber hinaus ermöglichte, dass seine Krieger mit ausgedehntem Landbesitz versorgt wurden. Auch gewann er strategisch wichtige Flottenstützpunkte, die der maritimen Dominanz Athens entgegenwirkten. Die seit Jahren andauernde Konkurrenz mit Athen fand einen Ausgleich im Frieden des Philokrates von 346, der Philipp II. die Anerkennung seines vergrößerten Besitzstandes durch Athen einbrachte.29 In dieser Zeit änderte sich das Gesicht des Landes: Bevölkerungsteile wurden in die eroberten Territorien umgesiedelt und die Grenzen in Illyrien und Thrakien durch die Anlage befestigter Orte gesichert.
Unter Philipps II. Ägide erreichte der Ausbau der Königsmacht einen nie da gewesenen Höhepunkt. Aufgrund seiner dynamischen Expansionspolitik kumulierte er vielfache Hoheitsrechte als König der Makedonen, Archon der Thessaler sowie als Herr über zahlreiche Landschaften auf dem Balkan, wofür die Herrschaftspraxis des Achaimenidenreiches als Vorbild gedient haben mag. Auf seinen zahlreichen Feldzügen wurde er von einer mobilen Kanzlei begleitet, die alle Dokumente doppelt ausfertigte und sorgsam archivierte. Derartige Verwaltungsvorschriften waren in keiner griechischen Polis üblich; nachweisbar sind sie dagegen beim persischen König und seinen Satrapen. Ebenfalls nach orientalischem Muster wurden die Kampfverbände der Gefährten des Königs und die Grade der Leibwächter organisiert.30 Die Anführer der Truppen wurden vom König zunehmend an den Hof gebunden. Die von ihnen zu verrichtenden Dienste für den Herrscher waren zugleich Teil der Standesehre wie Pflicht und fanden ihren Ausdruck in der Übersiedlung zahlreicher Adliger in die Residenz Pella. Durch das hierdurch intensivierte Gefolgschaftsprinzip wurde der Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Regionen und Stämmen verbessert, was gleichzeitig die Einigung des Landes förderte.
Eine besondere Stellung kam dabei dem Pagenkorps zu, in das junge Adlige ab dem vierzehnten Lebensjahr aufgenommen wurden, um von nun an im persönlichen Umfeld des Königs zu leben.31 Dabei wurde die künftige Führungselite nicht nur militärisch ausgebildet, sondern ihr wurde auch eine sorgfältige Erziehung zuteil, die in Einklang mit den am Hof von Pella herrschenden griechischen Wertvorstellungen stand. Die Pagen wuchsen in einem anderen Umfeld und mit anderen Anschauungen als ihre Väter auf, was zur dauerhaften Bindung an die Argeadendynastie beitrug. Die Zugehörigkeit zu den Königspagen galt als eine besondere Auszeichnung. Sie konnte daher von den ehrgeizigsten Adligen kaum umgangen werden. Andererseits erhielt der König damit eine Möglichkeit zur Disziplinierung ihrer Familien, denn die am Hof weilenden Pagen dienten als Pfand für deren Wohlverhalten.32
Den entscheidenden Durchbruch in Südgriechenland erzielte Philipp II. 346, als er die Phoker schlug und an ihre Stelle trat, womit er sich Zugang zum erlauchten Kreis der Delphischen Amphiktyonie, der Schutzmächte des Delphischen Orakels, verschaffte.33 Dies brachte neben politischen Vorteilen – bald geriet Euböa in seinen Bann – vor allem eine beträchtliche ideologische Aufwertung. Damit war Makedonien endgültig in Griechenland angekommen. Der Athener Isokrates erblickte im makedonischen König den künftigen Einiger Griechenlands und den Anführer einer Expedition gegen das Perserreich.34
In den nächsten Jahren konnte Philipp II. seinen Einfluss auf Euböa, Elis und Megara ausweiten. Ferner gelang es ihm, König Arrybbas aus Epeiros zu vertreiben und seinen Schwager Alexander an dessen Stelle zu setzen, womit sich Makedoniens Wirkungskreis bis zur Adria ausdehnte. Nach einem Bündnis mit Hermeias, dem Stadtherrn des kleinasiatischen Assos, wandte er sich 342 erneut Thrakien zu. Hier gelang es, den thrakischen Stammesfürsten Kersebleptes definitiv zu besiegen und das eroberte Territorium als makedonisches Herrschaftsgebiet, Strategie, zu annektieren.35 Thrakien musste den Zehnten entrichten und Hilfstruppen stellen. Nur noch Byzanz, Perinth und die athenische Flotte vermochten 341 Philipp II. die Kontrolle über den nordägäischen Raum streitig zu machen. Dieser Machtzuwachs, der Makedoniens Position festigte, fiel mit Alexanders Prinzenzeit zusammen, die wiederum mit dem Namen Aristoteles’ eng verbunden ist.
Kaum eine Facette seines Lebens ist so von Spekulationen bestimmt wie die Beziehung zwischen dem Welteroberer und dem Universalgelehrten. Als entscheidend für seine spätere Biographie, als paradigmatische Zusammenkunft von Macht und Geist wurde diese Begegnung immer wieder ausgemalt und gedeutet. In der Tat verführt das langjährige Schüler-Lehrer-Verhältnis zwischen zwei so herausragenden Persönlichkeiten sehr dazu, darin mehr als ein zufällig arrangiertes Zusammentreffen zu sehen. Doch die zugrunde liegenden Fakten mahnen eher zur Behutsamkeit. Aristoteles stammte aus Stageira, das mittlerweile zum makedonischen Staatsverband gehörte. Bereits sein Vater Nikomachos war als Arzt am Königshof zu Pella tätig gewesen und vielleicht gab dies den Ausschlag für die Wahl seines Sohnes als Prinzenerzieher. Jedenfalls gab es an Bewerbern keinen Mangel. Zum Zeitpunkt seiner Berufung befand sich Aristoteles auf Lesbos. Er war zuvor lange in Athen gewesen, das er erst nach dem Tod seines Lehrers Platon im Jahre 347 verlassen hatte. Danach nahm er im kleinasiatischen Assos am Hofe des Stadtherrschers Hermeias Aufenthalt, wo er als hoch angesehener Lehrer und Berater wirkte. Er wurde schon damals zu den herausragenden Geistern der Epoche gezählt, wenn auch sein Ruhm noch nicht die ihm später zuteil gewordene universale Geltung erreicht hatte.36
Im Jahre 342 begann in Mieza der Unterricht, an dem neben Alexander noch andere gleichaltrige Angehörige der makedonischen Oberschicht teilnehmen durften.37 Die Wahl des Ortes erfolgte mit Bedacht, denn man wollte abseits der Residenzstadt Pella eine optimale ruhige Ausbildungsstätte schaffen. Im Mittelpunkt von Alexanders Erziehung stand die Förderung seiner historischen, literarischen und naturwissenschaftlichen Neigungen. Aristoteles redigierte Homers Ilias neu. Das Werk wurde Alexanders Lieblingsbuch, das ihn überallhin begleitete. Schon in der Kindheit hatte die Lektüre Homers ihn stark beeindruckt und angesprochen, speziell die Gestalt des Achilleus; nun, unter Anleitung des Aristoteles, wurde das Heldenepos vollends sein Lebenselixier. Alexander hatte stets ein besonderes Gespür für die Aktualität des Mythos. Er blieb sein ganzes Leben davon berührt und in ihm gefangen. Der Anspruch der homerischen Helden, „alle zu überragen und stets der Beste zu sein“, wurde seine wichtigste Handlungsmaxime.38 Sie lässt sich geradezu als Motto seiner Biographie begreifen.39
Auch die Werke der Geschichtsschreiber wie Herodot, Thukydides und Xenophon dürften seine Aufmerksamkeit gefunden haben; sie dienten dazu, ihm, dem Makedonen, die griechische Perspektive historischer Weltdeutung näherzubringen. Ihre Zweckmäßigkeit stand für ihn außer Frage. Kallisthenes, ein Neffe des Aristoteles, sollte ihn als Chronist seines Feldzuges nach Persien begleiten, bei dem auch Xenophons Anabasis als Wegweiser Verwendung finden wird. Besondere Bewunderung zollte der junge Alexander den Gedichten Pindars40, in denen adlige Lebensweisen überschwänglich gefeiert und herausragende Taten hymnisch gepriesen wurden, womit sie zur Unsterblichkeit der Protagonisten beitrugen. Auch den Bühnenwerken der Tragiker galt sein Interesse. Er schätzte die dramatische Inszenierung mythologischer Stoffe und deren Ausdeutung für ethische Erkenntnisse. Euripides las er mit Begeisterung.41
Abb. 10: Aristoteles.
Beträchtliche Lehrerfolge erzielte Aristoteles im Bereich der naturwissenschaftlichen Unterweisung. Er sensibilisierte Alexander für die Komplexität der Tier- und Pflanzenwelt, für die Beobachtung von Naturerscheinungen und für die Gesetzmäßigkeit mathematisch-physikalischer Phänomene. Vor allem geographische Problemfelder, die Kenntnis ferner Länder sowie topographische und geologische Themen erregten schon jetzt die Phantasie des wissbegierigen Schülers. Auch die Medizin gehörte zum Unterrichtsstoff. Die dabei erworbenen Kenntnisse kamen Alexander in Asien zugute, als er seinen Gefährten Rezepte und Therapien verordnen konnte. Schließlich dürften Ethik, Politik und Philosophie nicht zu kurz gekommen sein, ohne dass sich freilich die Inhalte und Lernziele dieser Unterweisungen genauer bestimmen lassen.42
Die oft debattierte Frage, inwiefern die Lehren des Aristoteles unmittelbare Auswirkungen auf das Wirken Alexanders hatten, ist kaum zu beantworten, nicht nur aus Mangel an direkten Zeugnissen, sondern auch, weil diese Vorstellung einer nachträglichen Projektion entspringt.43 Ihr zugrunde liegt der Gedanke einer planmäßigen Vorbereitung der späteren Aktionen des wagemutigen Tatmenschen durch einen genialen Denker, was aber unzutreffend ist.44 Alexander und Aristoteles hatten bei aller Hochachtung, die sie füreinander empfunden haben mögen, ein ausgeprägtes Gefühl für ihre Verschiedenheit, Autonomie und Geltung. Jedenfalls wurde Alexander durch die Aneignung der maßgeblichen Bildungsgüter der griechischen Kultur zu einem Hellenen. Dies fiel ihm umso leichter, als er mütterlicherseits Grieche war und sich stets zu seiner Herkunft bekannt hatte.
Nach einem fast dreijährigen Studium endete der Aufenthalt in Mieza. Während dieser Zeit hatte Alexander nicht nur seinen Geist, sondern auch seinen Körper kontinuierlich trainiert. Reiten, gymnastische und athletische Wettbewerbe sowie Lauf- und Ausdauerübungen gehörten zum Begleitprogramm jeder vornehmen Erziehung.45 Auch in diesem Bereich ragte der junge Thronanwärter heraus, wie die später im Verlauf seiner asiatischen Expedition von ihm ertragenen Strapazen unter Beweis gestellt haben.
Voller Tatendrang und bestens gewappnet für seine künftigen Aufgaben kehrte der sechzehnjährige Prinz nach Pella zurück, wo er sich unvermittelt in die hektische Atmosphäre der Regierungszentrale eines expandierenden Gemeinwesens versetzt fand. Nun galt es, sich als Thronprätendent zu behaupten. Denn Alexander wurde in Vertretung seines Vaters mit der Wahrnehmung der Regierungsgeschäfte beauftragt46, da dieser damals einen Feldzug an der Meerenge zwischen Europa und Asien führte und sich dabei vergeblich bemühte, die Städte Perinth und Byzanz einzunehmen.47 Eine erste diplomatische Bewährungsprobe bestand der königliche Prinz, als er in Pella mit einer persischen Gesandtschaft geschickt verhandelte. Kurz darauf zog er an der Spitze eines Truppenkontingents gegen den thrakischen Stamm der Maider, den er mühelos niederwerfen konnte.48 Diesen ersten militärischen Erfolg feierte er 340 durch die Errichtung der Stadt Alexandropolis, übrigens zum gleichen Zeitpunkt, als sein Vater auf thrakischem Boden den Stützpunkt Philippopolis (Plovdiv) anlegte.49 Beiden Unternehmungen wohnte eine tiefe symbolische Bedeutung inne. Als Stadtgründern stand Philipp II. und Alexander ein Heroenkult durch die dankbare Bevölkerung zu, womit Vater und Sohn gottähnliche Ehren erhielten.
Welche Aufgaben würde die Zukunft diesen ehrgeizigen, energischen und hochbegabten Tatmenschen stellen, und wie würden sie ihre Zusammenarbeit in einer politisch komplexer werdenden Welt gestalten? Diese Fragen ergeben sich schon deswegen, weil die Beziehung zwischen Vater und Sohn bald starken Belastungsproben ausgesetzt sein und zu einem zentralen Thema der makedonischen Politik werden sollte. Die latente Konkurrenzsituation hat Plutarch mittels einer legendär gewordenen Äußerung des jugendlichen Alexanders eingefangen, in der sich Bewunderung und Ironie zu einer einprägsamen Sentenz vermengen: Sooft die Nachricht einlief, dass Philipp eine berühmte Stadt erobert oder einen glorreichen Sieg davongetragen habe, hörte er (Alexander) sie immer mit finsterer Miene an und sagte zu seinen Gefährten: „Mein Vater wird noch alles vorwegnehmen und mir keine Gelegenheit übrig lassen, mit euch eine große und glänzende Tat zu verrichten.“50