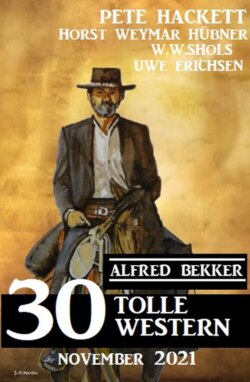Читать книгу 30 tolle Western November 2021 - Pete Hackett - Страница 56
Band 107 Schatzsucher des Todes
ОглавлениеDas leichte Fuhrwerk rumpelte und holperte, die Achsen quietschten. Auf dem Wagenbock saßen zwei Männer. Einer lenkte das Gespann, der andere hielt eine Henry Rifle in den Händen und sicherte ununterbrochen in die Runde. Sechs Reiter folgten dem Fuhrwerk. Ein Mann ritt voraus. Auf der Ladefläche des Wagens stand eine eisenbeschlagene Kiste. Sie enthielt Gold für die Münzprägeanstalt in Denver im Wert von 250.000 Dollar.
Wildnis umgab den Zug. Er bewegte sich zwischen den Hügeln. Es war ein regnerischer Tag, am Himmel zogen dunkle Wolken. Der Boden war aufgeweicht, Wagenräder und Pferdehufe hinterließen tiefe Spuren, die sich sofort mit Wasser füllten.
Der Tod lauerte zu beiden Seiten des Weges auf den Kämmen der Hügel. Es waren sechs Banditen. Kalte Augen ruhten über die Zieleinrichtungen der Gewehre auf den Männern, die den Goldtransport begleiteten ...
Ein Schuss peitschte. Der Kutscher sackte auf dem Wagenbock zusammen. Und dann donnerte eine Salve aus den Gewehren der Banditen in die Senke. Sättel wurden leergefegt. Pferde preschten von Panik erfüllt davon. Es gab keine Gnade und kein Erbarmen. Die Banditen wurden von der Habgier und der Mordlust geleitet. Der Tod griff mit knöcherner Klaue um sich.
Die Detonationen verhallten mit geisterhaftem Geraune. Stille trat ein. Pulverdampf zerflatterte im Wind. Das Blut der getöteten Männer versickerte im aufgeweichten Boden.
Die Banditen holten ihre Pferde und ritten in die Senke zwischen den Hügeln. Die Tiere schnaubten nervös, als ihnen der Blutgeruch in die Nüstern stieg. Drei reiterlose Pferde standen herum und peitschten nervös mit den Schweifen.
Zwei der Reiter saßen ab. Die beiden Gespannpferde stampften auf der Stelle. Der tote Kutscher und sein ebenso toter Begleitmann wurden vom Wagenbock gezerrt. Shorty Kellock, der Anführer der Mörderbande, sagte: »Phil und Cash, ihr übernehmt das Gespann. Wir ziehen nach Süden, überqueren den Canadian und wenden uns dann nach Westen, in Richtung New Mexico.«
Die beiden Genannten banden ihre Pferde an das Fuhrwerk und kletterten auf den Bock. Einer angelte sich die langen Zügel und ließ sie auf die Rücken der Gespannpferde klatschen. Die Bande verließ den Schauplatz des blutigen Überfalls. Es waren skrupellose Kerle, denen Niedertracht und Verworfenheit in die Gesichter geschrieben stand und denen ein Menschenleben gerade mal den Preis für eine Kugel wert war.
Sie schonten die Pferde nicht. Tag um Tag zogen sie, und nach einer Woche erreichten sie den Canadian. Der Fluss wälzte seine schmutzigen Fluten nach Osten. An seinen Ufern wuchsen Büsche, die von uralten Pappeln überragt wurden. Einer der Reiter sagte: »Es sieht nicht so aus, als wenn wir verfolgt werden würden. Südlich des Flusses treiben die Comanchen ihr Unwesen. Warum ziehen wir nicht von hier aus nach Westen?«
»Weil ich nicht ausschließen kann, dass wir dennoch verfolgt werden«, versetzte Shorty Kellock. »Warum denkst du, sind wir hundertfünfzig Meilen durch die Wildnis gezogen, Jack? Wir hätten von La Junta aus südwärts ziehen können und wären auf direktem Weg nach New Mex gelangt. Du kannst aber davon ausgehen, dass man uns auf dieser Route gejagt hätte wie räudige Hunde. Durchs Indianerland aber ...«
»Shorty hat recht«, mischte sich ein bärtiger Bursche ein. »Lieber ein kleines Risiko auf sich nehmen als in Colorado aufgehängt zu werden.«
»Überqueren wir den Fluss!«, stieß Kellock hervor und trieb sein Pferd in das seichte Uferwasser. Das Tier scheute und zeigte sich störrisch, aber Shorty Kellock zwang es weiterzugehen. Das Fuhrwerk rollte über den schmalen Uferstreifen. Schon bald mussten die Pferde schwimmen. Zur Flussmitte hin war die Strömung ziemlich stark und sie wurden ein wenig abgetrieben. Das Fuhrwerk schwamm wie ein Floß. Wasser spülte über die Ladefläche hinweg. Die Reiter hielten ihre Gewehre und Revolver hoch, damit die Munition nicht nass wurde.
Plötzlich erschienen auf dem Höhenkamm südlich des Canadian Reiter. Comanchen! Das Licht der Sonne glitzerte frostig auf den Läufen ihrer Karabiner, den Schneiden ihrer Tomahawks und den Spitzen ihrer Kriegslanzen.
Einer der Reiter im Fluss fluchte.
Jetzt trieben die Comanchen ihre Mustangs an. Spitzes, abgehacktes Geschrei voll heidnischer Grausamkeit ertönte. Was da auf unbeschlagenen Hufen herandonnerte, war der Tod in Gestalt einiger Dutzend Krieger. Die Banditen schossen. Die Comanchen kamen dennoch näher. Vier, fünf von ihnen fielen, die anderen jagten schreiend, mit schwingenden Lanzen heran. Pfeile zogen ihre lautlose, flirrende Bahn. Die Banditen wurden getroffen und kippten von den Pferden. Die Strömung erfasste sie und riss sie fort.
Jack Delaney, ein zwanzigjähriger Bandit aus dem Arizona-Territorium, stürzte vom Pferd und ging unter. Das Wasser schlug über ihm zusammen. Er ließ sich in der Strömung treiben. Bald wurde seine Luft knapp. Seine Lungen begannen zu stechen. Er tauchte auf. Der Wagen mit der Goldkiste trieb flussabwärts. Die beiden Gespannpferde waren tot. Am Flussufer verhielten in einer Linie die Indianer. Jetzt entdeckte ihn einer, streckte den Arm in seine Richtung aus und schrie etwas.
Delaney schnappte nach Luft und tauchte weg. Dort, wo er sich eben gezeigt hatte, schlugen Kugeln und Pfeile ins Wasser. Sie wurden ihm nicht gefährlich. Dann musste er auftauchen, um erneut Luft zu schnappen. Sein Kopf durchstieß die Wasseroberfläche. Einige Comanchen stoben auf ihren Pferden am Flussufer entlang. Delaneys Lungen füllten sich mit einer Vehemenz, die ihn schwindlig werden ließ. Sofort tauchte er wieder. Von seinen Kumpanen war kein einziger mehr zu sehen gewesen. Ein Strudel erfasste ihn und wirbelte ihn herum. Er hatte Mühe, sich zu befreien, tauchte wieder auf, um Luft zu schnappen, und sah, dass sich ein Stück entfernt einige Felsen aus dem Wasser erhoben.
Zwischen den Felsen gab es Stromschnellen und gefährliche Wirbel. Der junge Bandit wurde von der Kraft des Wassers zwischen die Felsen gerissen. Schmerzhaft stieß er sich die Hüfte. Sein linkes Bein wurde taub. Dann klammerte er sich an einen der Felsen und verschnaufte. Berstender Krach ertönte, als das Fuhrwerk zerschellte. Die Trümmer des Wagens und die toten Pferde wurden an dem jungen Banditen vorbeigetrieben und versanken in den gischtenden Strudeln. Am Ufer trieben die Indianer ihre Pferde hin und her. Delaneys Herz raste. Er war voll Panik. Was war aus seinen Kumpanen geworden? Hatten die Indianer sie alle getötet? Waren sie ertrunken?
Das Grauen kam kalt und stürmisch wie ein Blizzard, als er sich ausmalte, dass er ihnen in die Hände fiel. Delaney wusste, was sie mit gefangenen Weißen anstellten. Sie quälten sie furchtbar zu Tode. Die Angst jagte wie lähmendes Gift durch seine Blutbahnen und stieg wie ein Schrei in ihm auf. Er konnte die dunklen Gesichter sehen. In den Haarknoten steckten Federn. Delaneys Zähne schlugen aufeinander wie im Schüttelfrost. Weg! Nur weg hier!, brüllte alles in ihm.
Er ließ sich wieder in das Wasser gleiten. Fast eine Meile ließ er sich treiben. Dann schwamm er ans Ufer. Einsamkeit umfing ihn. Ein intensives Gefühl der Verlorenheit nistete sich in ihm ein und legte sich wie eine tonnenschwere Last auf ihn. Er kroch auf den sandigen Ufersaum und versteckte sich wie ein waidwundes Tier im Ufergebüsch. Ein trockenes Schluchzen entrang sich ihm ...
*
Fünfzehn Jahre waren ins Land gezogen. Im Panhandle gab es keine Comanchen mehr. Sie waren im Indianer-Territorium Oklahoma angesiedelt worden. In der nördlichsten Ecke von Texas waren Städte entstanden. Die riesigen Ranches der Panhandle Cattle Company beherrschten nahezu das gesamte Weidegebiet zwischen Llano Estacado und der Grenze zum Niemandsland, diesem schmalen Streifen zwischen Kansas und Texas, den die Indianer für sich beanspruchten. An den Flüssen hatten sich Siedler niedergelassen, die Union Pacific baute eine Bahnlinie, die in der Zwischenzeit fast Tascosa erreicht hatte und die zunächst in Amarillo enden sollte.
Auch das Gesetz hatte im Panhandle Fuß gefasst. Im Jahre 1879 war das District Court for the Northern District of Texas in Amarillo etabliert worden. Als oberster Gerichtsherr im Panhandle sorgte Richter Jerome Frederick Humphrey für Recht und Ordnung. Und wir, die U.S. Marshals fungierten als seine Erfüllungsgehilfen.
Mein Name ist Bill Logan. Nun, Freunde, ich brauche mich euch sicher nicht mehr vorzustellen. Ihr kennt meine Geschichte. Der Wind des Schicksals hatte mich vor einigen Jahren in den Panhandle verschlagen. Ich hatte den Stern genommen. Einen großen Teil unseres Lebens verbrachten wir Marshals auf dem Pferderücken auf der Jagd nach irgendwelchen Verbrechern.
Auch an diesem Tag ritten mein Partner Joe Hawk und ich auf der Spur von Gesetzlosen. Es war ein sonniger Tag im Juni. Der Bandit Amos Sheppard war mit seiner Bande in Tascosa aufgetaucht. Die Outlaws waren drauf und dran, der Stadt ihren Stempel aufzudrücken. Der Town Mayor hatte einen Boten nach Amarillo geschickt, und der Richter beauftragte Joe und mich, in der Stadt am Canadian nach dem Rechten zu sehen. Vierzig Meilen lagen vor uns. Wir benutzten die von Wagenrädern zerfurchte und von Pferdehufen aufgewühlte Poststraße, ahnungslos, dass uns dort oben am Canadian die Hölle erwartete ...
*
Jack Delaney, der bei dem Überfall auf den Goldtransport vor fünfzehn Jahren dabei gewesen war, zügelte sein Pferd. Seine Brüder Lance und Earl verhielten neben ihm. Auch die beiden anderen Reiter, die die Brüder begleiteten, parierten die Tiere. Eines der Pferde stieß ein Wiehern aus. Die Gebissketten klirrten, Sattelleder knarrte, Hufe stampften. Jack Delaney hatte die Augen ein wenig zusammengekniffen und starrte hinunter in die Senke, durch die der Canadian sein Bett gegraben hatte. Reißend schoss das Wasser zwischen die Felsen, schäumend brach es sich an den wie von Riesenhand hingestellten Hindernissen, es gischtete und spritzte.
»Wir sind da«, erklärte Jack Delaney. Er hob die linke Hand und deutete hangabwärts. »An diesen Felsen zerschellte das Fuhrwerk. Dort unten auf dem Flussgrund liegt das Gold. Wenn es uns gelingt, es zu heben, sind wir gemachte Leute.«
»Gold für 250.000 Dollar«, flüsterte Lance Delaney fast ergriffen. Er war wie seine Brüder blond, in seinem Gesicht wuchsen helle Bartstoppeln. Seine Augen waren blau. Lance Delaney war zweiunddreißig.
»Reiten wir hinunter«, murmelte Jack Delaney und ruckte im Sattel. Sein Pferd setzte sich in Bewegung.
Die Tiere stampften den Abhang hinunter. In den Büschen zwitscherten die Vögel. Bienen und Hummeln summten. Hier wuchs kniehohes Gras. Der süßliche Geruch von blühendem Salbei lag in der Luft. Der Fluss rauschte monoton. Am Ufer saßen sie ab. Es war um die Mittagszeit. Die Sonne stand hoch im Zenit. Weiße Wolken ballten sich am Himmel.
»Wir schlagen hier unser Lager auf«, gab Jack Delaney zu verstehen. »Und dann fangen wir gleich an, nach dem Gold zu tauchen.«
»Die Kiste wird verrottet sein«, murmelte Earl Delaney.
»Das glaube ich nicht«, versetzte Jack Delaney. »Sie war aus massivem Eichenholz und mit Eisenbändern verstärkt. Im Wasser hält sich Holz unter Umständen hunderte von Jahren. Man hat gut erhaltene Schiffe der Wikinger geborgen, die fast tausend Jahre alt waren.«
»Wir werden es sehen«, knurrte Gordon Carter, ein dunkler Typ mit tiefliegenden Augen.
»Wie wollen wir das Gold transportieren, wenn es uns gelingt, es zu heben?«, fragte Herb Holbrook.
»Darüber denken wir nach, wenn wir es haben«, antwortete Jack Delaney.
Sie nahmen den Pferden die Sättel ab. Zelte wurden aufgeschlagen. Ein Seilcorral wurde errichtet, in den sie die Pferde trieben.
»Dann fangt mal an, Gordon und Herb«, sagte Jack Delaney. »Ihr habt euch doch gebrüstet, so gute Taucher und Schwimmer zu sein. Ich bin gespannt, ob ihr halten könnt, was ihr versprochen habt.«
»Du wirst es sehen«, blaffte Gordon Carter genervt und begann, sich zu entkleiden. Auch Herb Holbrook zog sich aus. Lassos wurden unter ihren Armen durchgezogen, dann gingen sie ins Wasser. Die Lassos strafften sich. Dort, wo das Wasser zwischen die Felsen schoss, tauchten Carter und Holbrook. Sie hielten es lange aus unter Wasser, dann kam Carter an die Oberfläche zurück. »Man kann kaum etwas sehen dort unten«, schrie er. »Aber das Wasser ist allenfalls zwei Yards tief. Wir müssen den Boden Stück für Stück absuchen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Kiste ein Stück abgetrieben wurde.«
Auch Holbrook tauchte auf. Die Haare klebten ihm in der Stirn. Er wischte sich das Wasser aus den Augenhöhlen. »Ich hab ein Rad des Wagens gefunden!«, rief er. »Es hat sich zwischen den Felsen verkeilt. Wenn der Schatz dort unten liegt, finden wir ihn.
*
Es war Abend. Aus den Häusern in Tascosa fiel Licht. Mond- und Sternenlicht versilberte die Dächer. Viele Männer hatten sich im Saloon eingefunden. Stimmengemurmel hing in der Luft, die von Tabakqualm geschwängert war. Das Licht der Laternen, die über den Tischen von der Decke hingen, warf dunkle Schatten in die Gesichter. Die Stimmung war gedrückt. Seit Amos Sheppard und seine Banditen in Tascosa weilten, hatte auch die Angst Einzug in die Stadt gehalten.
Die Banditen hatten am Nachmittag die Stadt verlassen. Aber Sheppard hatte versprochen, zurückzukehren. Tascosa duckte sich. Der Town Mayor hatte Glenn Stirling von der Hackknife Ranch um Hilfe gebeten. Glenn Stirling hatte geantwortet, dass er keinen Grund habe, gegen die Bande vorzugehen, solange sie sich ruhig verhielt und sich nicht auf die Weiden der Hackknife verirrte.
Nun wartete man in der Stadt auf Hilfe aus Amarillo.
Auf der Main Street erklangen Hufschläge. Sie näherten sich dem Saloon. Schließlich verstummten sie. Helles Wiehern erklang. Im Saloon machte sich Unbehagen breit. Die Gespräche verstummten. Die Männer schienen den Atem anzuhalten. Schritte polterten über den Vorbau, dann wurde die Pendeltür aufgestoßen. Nacheinander betraten die Banditen den Saloon. Hinter ihnen schlugen die Türpendel knarrend und quietschend aus. Die fünf Männer hielten ihre Gewehre in den Händen. Darüber hinaus war jeder von ihnen mit einem Revolver bewaffnet. Ein unsteter Lebenswandel jenseits von Recht und Ordnung hatte unübersehbare Spuren in den stoppelbärtigen Gesichtern hinterlassen.
Sie schritten zum Tresen. Leise klirrten die Sporen. Die Absätze riefen ein dumpfes Echo auf den sägemehlbestreuten Bohlen wach.
»Whisky!«, forderte Amos Sheppard, der dunkelhaarige Bandit, dessen Gesicht von einer Messernarbe verunstaltet wurde, die sich über seine linke Wange bis zum Mundwinkel zog. »Eine Flasche. Aber nicht das Gift, das du normalerweise ausschenkst.«
Sheppard drehte sich um und grinste blitzend. »Ich hab doch versprochen, dass wir zurückkommen. Ihr freut euch ja gar nicht.«
An einem der Tische rief ein Mann: »Ich möchte zahlen, Butch. Hab meiner Frau versprochen, bald nach Hause zu kommen. Es ist an der Zeit ...«
Sheppard heftete seinen Blick auf den Mann. Er war um die fünfzig und grauhaarig. Der Mann vermied es, in Blickkontakt mit dem Banditen zu treten. In Sheppards Mundwinkel kerbte sich ein böser Zug. Seine Lippen sprangen auseinander: »Unsere Gesellschaft ist dir wohl zuwider, Mister?«
»Das hat nichts mit euch zu tun«, versicherte der Mann. »Ich ...«
Sheppards linke Hand pfiff durch die Luft. Der Mann verstummte erschreckt. »Deine Alte kann warten.«
»Aber ...«
»Es gefällt mir nicht, dass du gehst, wenn wir kommen. Ich muss annehmen, es liegt an uns. Und das ärgert mich.«
»Na schön, dann bleibe ich noch ein wenig. Bring mir noch ein Bier, Butch. Annie wird Verständnis haben.«
»Hast du solchen Schiss vor deiner Alten?«, rief John Russell, ein rothaariger Mann von einunddreißig Jahren. Er verfügte über breite Schultern, sein Hals war kurz und dick, der Schädel kantig. Sein Gesicht war mit Sommersprossen übersät. Um seinen dünnlippigen Mund lag ein brutaler Zug.
»Ich habe keine Angst vor meiner Frau«, murmelte der Grauhaarige. »Ich – ich will aber auch keinen Streit mit ihr.«
Russell lachte wiehernd. »Mit einer Frau streitet man nicht!«, rief er dann. »Sie hat zu gehorchen. Wenn nicht, gibt‘s eins aufs Maul.«
Der Grauhaarige zog den Kopf zwischen die Schultern.
Duncan Forrester, ein blondhaariger Bandit, sagte verächtlich: »Diese Stadt ist eine Rattenburg. Die meisten Ratten sitzen in ihren Löchern. Ein paar haben sich herausgewagt und in den Saloon verirrt. Und denen schlottern die Knie vor Angst. Seht sie euch an. Sie sind zu feige, uns in die Augen zu schauen.«
Tatsächlich vermieden es die Männer der Stadt, die Banditen anzusehen. Sie hatten Angst, die Bande herauszufordern und ihrer gewiss sehr wechselhaften Stimmung zum Opfer zu fallen. Die Atmosphäre im Saloon war angespannt. Plötzlich drehte sich Sheppard um und griff nach dem Glas Whisky, das ihm der Keeper hingestellt hatte. »Lasst sie in Ruhe. Sie machen sich in die Hosen. Es reicht, wenn sie Respekt vor uns haben. Sie müssen uns nicht mögen.«
Langsam nahmen die Männer an den Tischen wieder ihre Gespräche auf. Und dann erklangen erneut Hufschläge. Auch sie endeten vor dem Saloon. Die Banditen schossen sich schnelle, vielsagende Blicke zu. Dann nahmen sie ihre Gewehre und glitten auseinander. Schritte dröhnten auf dem Vorbau, dann kamen vier Männer in den Saloon. Es waren Cowboys. Sie sahen die Banditen, die sich im Schankraum verteilt hatten und blieben abrupt stehen. Einer sagte: »Von der Nordweide der Hackknife wurden zweihundert Rinder abgetrieben. Wir sind der Spur gefolgt und auf eine Herde von mehr als tausend gestohlenen Rindern gestoßen. Die Spur der Viehdiebe führt nach Tascosa.«
»Hier sind keine Rustler angekommen«, rief Amos Sheppard grollend. »Ihr habt den Weg umsonst gemacht.«
»Wer bist du?«, fragte der Cowboy.
»Man Name ist Sheppard. Wir sind auf dem Durchritt und haben beschlossen, einige Tage in dieser schönen Stadt zu bleiben.«
»Was ist euer Ziel?«
»Wir wollen nach Norden, durchs Niemandsland, hinauf nach Kansas.«
»Und dort wolltet ihr die Herde verkaufen, die ihr auf dem Weideland der Hackknife zusammengetrieben habt, nicht wahr?«
»Du beschuldigst uns des Viehdiebstahls?«, fragte Sheppard mit klirrender Stimme, in seinen Augen funkelte ein böses Licht, er vermittelte eine tödliche Drohung. Jeder konnte den unsichtbaren Strom von Härte und Brutalität fühlen, der plötzlich von der Bande ausging. Ein Blick in die Gesichter führte die ganze Unberechenbarkeit und Skrupellosigkeit der Banditen vor Augen.
Murmeln und Flüstern ging durch den Schankraum. Stuhlbeine scharrten. Die Männer beeilten sich, aus der Schusslinie zu kommen. Viele drängten zur Tür und verließen den Saloon. Die Luft schien vor Spannung zu knistern. Der Satan mischte die Karten für ein höllisches Spiel ...
»Eure Pferde stehen draußen am Holm«, sagte der Cowboy. »Sie sind abgetrieben und staubig. Ihr seid die Kerle, auf deren Spur wir in die Stadt gekommen sind.« Unvermittelt zog der Cowboy seinen Revolver und richtete ihn auf Sheppard. »Lasst die Gewehre fallen und dann zieht vorsichtig die Revolver aus den Futteralen. Wer eine falsche Bewegung macht, wird erschossen.«
Ehe die anderen Cowboys ihre Waffen ziehen konnten, rissen die Banditen die Gewehre an die Hüften. Sheppard bewegte sich blitzschnell zur Seite. Die Kugel, die ihm der Weidereiter schickte, verfehlte ihn. Und dann peitschten die Gewehre. Die Cowboys wurden herumgerissen und geschüttelt und stürzten tot oder sterbend zu Boden.
Pulverdampf zerflatterte. Der Geruch von verbranntem Pulver hing in der Luft. Sheppard lud die Winchester durch. Eine Hülse wurde ausgeworfen und klimperte auf den Boden. »Narren!«, stieß er hervor. Er ging zu einer der reglosen Gestalten hin und stieß sie mit der Stiefelspitze an. Ohne jede Gemütsregung blickte er auf den Toten hinunter. Dann sagte er laut: »Ihr habt es alle gesehen. Es war Notwehr. Sie griffen zuerst zu den Waffen.«
Ein Mann sagte heiser: »Das wird Glenn Stirling nicht schlucken. O verdammt, Sheppard. Stirling wird jeden verfügbaren Mann in den Sattel jagen und Jagd auf euch machen. An Ihrer Stelle würde ich mich aufs Pferd schwingen und so viele Meilen wie möglich zwischen mich und diesen Landstrich bringen.«
»Legt die vier auf ihre Pferde und bringt sie Stirling«, versetzte Sheppard unbeeindruckt. »Bestellt ihm, dass wir seine Kuhhirten nicht fürchten. Sollte er dennoch welche schicken, bekommt er sie quer über den Rücken ihrer Pferde zurück. Bestellt ihm das.«
*
Einige Cowboys und Ranchhelfer hatten sich vor der Mannschaftsunterkunft der Hackknife Ranch versammelt. Sie trugen nur zerschlissene, ausgewaschene Unterwäsche, waren barfuß und schauten ziemlich schlaftrunken drein.
Vor dem Haupthaus waren die Pferde mit den Toten abgestellt. James Lancer, der Vormann, stand mit einer Laterne in der Hand daneben. Licht und Schatten wechselten auf dem Boden, Licht- und Schattenreflexe zuckten über die Pferde mit ihrer traurigen Last hinweg. Auf zwei weiteren Pferden saßen Männer aus Tascosa. Auf den Vorbau war Glenn Stirling, der Verwalter der Hackknife, getreten. Ohne den Mann aus der Stadt ein einziges Mal zu unterbrechen hatte er sich dessen Bericht angehört. Seine Hände hatten sich um das Geländer verkrampft, als wollten sie das verwitterte Holz auswringen. Jetzt rief der Ranchboss: »Zieht euch an, Männer, bewaffnet euch und sattelt Pferde. Wir reiten in die Stadt.«
Ohne jede Begeisterung begaben sich die Männer in ihre Unterkunft, um sich anzuziehen. Glenn Stirling wandte sich an die Männer aus der Stadt: »Ihr könnt mit uns zurückreiten. Ich verlange aber nicht von euch, dass ihr euch beteiligt, wenn wir uns die Schufte vornehmen. Es ist Sache der Hackknife und ihr könnt euch raushalten.«
»Sie sollten diese Banditen nicht unterschätzen, Mister Stirling«, warnte einer der Städter. »Dieser Sheppard hat auch gar keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass er nicht davonzulaufen gedenkt. Das sind Sattelstrolche, die keinem Streit aus dem Weg gehen. Sie sollten es sich überlegen, ob Sie tatsächlich Ihre Männer gegen die Kerle ins Feld schicken.«
»Habt ihr mich nicht gebeten, euch zu helfen?«, grollte der Ranchboss. »Wieso dieser plötzliche Gesinnungswechsel?«
»Diese Kerle sind tödlicher als die Pest im Mittelalter. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Sie gehorchen den niedrigsten Trieben. Gegen sie haben Ihre Männer keine Chance. Die Stadt hat einen Boten nach Amarillo geschickt. Da Sheppard vom Gesetz gesucht wird, muss das Bezirksgericht tätig werden. Ich denke, dass innerhalb der nächsten zwei Tage Hilfe eintrifft. Überlassen Sie es dem Gesetz, die Kerle zur Verantwortung zu ziehen.«
Glenn Stirling war ein wenig nachdenklich geworden.
James Lancer, der Vormann, ergriff das Wort. Er sprach eindringlich: »Es handelt sich um die Viehdiebe, die seit kurzer Zeit die Weiden der Hackknife heimsuchen. Sie haben vier unserer Männer zusammengeknallt. Wir können das nicht einfach schlucken, Boss. Ich bin dafür, dass wir nach Tascosa reiten und den Kerlen die Hammelbeine langziehen.«
Stirling presste die Lippen zusammen. Seine Backenknochen mahlten. In ihm schien ein Zwiespalt aufgebrochen zu sein, und er konnte sich nicht entscheiden.
»Es sind unsere Rinder und unsere Männer«, drängte der Vormann.
Stirling entschloss sich. »Gut, Lancer. Wir reiten. Sie haben recht. In diesem Landstrich gilt das Gesetz der Hackknife. Und das kennt keine Kompromisse.«
Zwanzig Minuten später stoben sie von der Ranch. Es waren mit den beiden Männern aus Tascosa zehn Reiter. Staub quoll unter den wirbelnden Hufen in die Höhe. Der Hufschlag rollte vor der Kavalkade her durch die Nacht. Ein lauwarmer Wind kam den Reitern entgegen und stellte vorne die Krempen ihrer Hüte auf. Die Halstücher flatterten.
Nach einer Stunde passierten sie die ersten Häuser von Tascosa. Es war nach Mitternacht. Die Stadt lag im Dunkeln. Trügerische Ruhe lastete über ihr – es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt aber begann irgendwo hinter den Häusern ein Hund zu bellen. Andere Hunde stimmten ein. Bald war die Stadt voll vom Kläffen.
In den Häusern schlugen die Herzen höher. Angst schlich sich in die Gemüter. Wurde die Stadt in dieser Nacht zum zweiten Mal Schauplatz eines blutigen Kampfes? Wetzte der Knochenmann schon die Sense?
Die Hufschläge prallten gegen die Fassaden der Häuser zu beiden Seiten der breiten Main Street und wurden zurückgeworfen. Die Reiter von der Hackknife Ranch ließen die Pferde jetzt im Schritt gehen. Die beiden Männer aus der Stadt sonderten sich ab und verschwanden in einer finsteren Gasse.
Vor dem Hotel verhielt der Pulk. James Lancer saß ab und stieg auf den Vorbau. Die Tür war verschlossen. Er schlug mit der Faust dagegen. Da ertönte auf der anderen Straßenseite eine brechende Stimme: »Sucht ihr uns?«
Die Hände fuhren zu den Waffen. Köpfe zuckten herum. Die Männer von der Hackknife atmeten gepresst. Sie begriffen, dass die Banditen auf sie gewartet hatten. Nur selten zuvor hatten sie sich in einer ähnlichen schrecklichen Stimmung befunden wie in diesen Augenblicken. Der Schreck pulsierte in langen, heißen Wogen durch die Adern der Reiter.
»Sind Sie Sheppard?«, rief Stirling, als er sich gefasst hatte.
»Ja.«
»Sie haben Vieh der Hackknife gestohlen, und Sie haben vier Reiter der Hackknife erschossen.«
»Sie haben uns als Viehdiebe bezeichnet und dann nach den Waffen gegriffen. Es war Notwehr.«
»Ich weiß, wie es sich zugetragen hat. Schnappt sie euch, Männer!«
Die Reiter von der Ranch trieben ihre Pferde auseinander. Schüsse krachten. Zwei Männer stürzten aus den Sätteln. Die Detonationen stießen durch die Stadt wie eine Warnung vor Unheil und Verderben. Ein Pferd stob von Panik erfasst mit fliegenden Steigbügeln die Straße hinunter.
Die Männer von der Hackknife sprangen aus den Sätteln und schossen auf die Mündungsfeuer. Geduckt rannten sie in Deckung. Einer kroch unter einen Vorbau, ein anderer kauerte hinter einem Regenwasserfass. Glenn Stirling war in eine Passage zwischen zwei Häusern gelaufen und presste sich eng an eine Hauswand. James Lancer, der Vormann, hatte die Eingangstür des Hotels aufgerammt und stand nun neben einem Fenster in der Halle, durch das er die Straße beobachtete. Zwei weitere Männer waren irgendwo in der Dunkelheit verschwunden.
Die Schüsse waren verhallt. Nur das Bellen der Hunde war zu hören. Nach den Schüssen gebärdeten sich die Tiere wie verrückt. Die Stadt stand voll und ganz im Banne des Bösen. Der Wind wirbelte den Straßenstaub auf und trug ihn vor sich her, brach sich an den Häusern und winselte leise. Abgestorbene Sträucher, die wie Bälle hüpften, verfingen sich an Hausecken, in Gerümpel und Abfall – Tumbleweeds.
Man belauerte sich, jeder wartete auf seine Chance. Nervige Hände hatten sich um die Griffe der Revolver festgesaugt. Die Männer witterten und ließen ihren Instinkten freien Lauf. Leises Knirschen von feinem Sand unter harten Stiefelsohlen war zu vernehmen, das Klirren von Sporenrädern, das Knarren von Stiefelleder.
Der Tod schlich auf leisen Sohlen durch Tascosa.
Dann dröhnte ein Schuss. Ein Mündungslicht stieß in die Finsternis. Ein Mann taumelte hinter einer Hausecke hervor und brach am Fahrbahnrand zusammen. Die Echos erweckten die Detonation immer wieder zum Leben, bis sie schließlich verhallte.
James Lancer rannte durch die Hintertür aus dem Hotel, lief ein Stück hinter den Häusern entlang und kam durch eine schmale Gasse zur Main Street. Er stand im Schutz eines Hauses und schwenkte seinen Blick die Fahrbahn hinauf und hinunter. Vor dem Hotel standen die Pferde. Lancer bohrte seinen Blick in die Dunkelheit zwischen den Häusern auf der anderen Straßenseite. Die Finsternis mutete greifbar und stofflich an und schien Unheil zu verkünden. Dem Vormann war klar, dass sie schon drei Männer verloren hatten. Es schürte seinen Hass. Er setzte alles auf eine Karte und rannte geduckt in die Straße, überquerte sie halb und schlug einen Haken, als es ihm aus der Finsternis entgegenblitzte. Er spürte den sengenden Hauch der Kugel und feuerte. Zweimal, dreimal bäumte sich der Revolver in seiner Faust auf, handlange Mündungsblitze stießen aus dem Lauf. Lancer nahm eine flüchtige Bewegung in der Dunkelheit wahr. Er ließ sich zu Boden fallen und rollte herum. Heißes Blei pfiff über ihn hinweg. Er jagte noch zwei Kugeln in die Finsternis hinein. Ein gepresster Aufschrei erklang, dann war ein dumpfer Fall zu hören.
Lancer schnellte hoch und rannte zwischen die Häuser. Er lud seinen Revolver nach.
Gleich darauf ertönte es: »Es hat Ernest erwischt! Verdammt, er ist tot! Diese verdammten Hunde!«
Eine Gestalt glitt an Amos Sheppard heran, der im Schlagschatten eines Schuppens kauerte. »Nicht schießen, Amos, ich bin‘s.«
»Verdammt, was schleichst du hier herum?« Sheppard senkte die Hand mit dem Revolver.
»Es wird noch mehr von uns erwischen, Amos. Wir sollten zusehen, dass wir aus der Stadt kommen. In den Hügeln können wir ihnen einen Hinterhalt legen. Hier in der Stadt aber ist der Ausgang ziemlich ungewiss. Wenn wir ihnen lebend in die Hände fallen, hängen sie uns auf.«
»Ich reiße nicht aus vor einer Handvoll Kuhtreiber!«, blaffte Sheppard.
»Ich für meinen Teil verschwinde, Amos. Und wenn du gescheit bist, dann setzt du dich auch ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Bürger besinnen und ihre Waffen in die Hände nehmen. Vielleicht lassen sie dir noch die Zeit für ein kurzes Gebet.«
»Zur Hölle mit dir, John! Du verstehst es, einem Mut zu machen.«
»Du musst der Realität ins Auge sehen, Amos.« John Russells Stimme hob sich. »Forrester, Webster!«
In einiger Entfernung erklang es: »Was ist los?«
»Ich verschwinde, Duncan. Hier wird mir der Boden zu heiß unter den Füßen. Ich will nicht die Hauptrolle in einer Hängepartie übernehmen.«
»Wir haben keine Pferde!«, schrie Duncan Forrester.
»Auf der Straße stehen genug.« John Russell rannte los. Hakenschlagend wie ein Hase hetzte er schräg über die Main Street. Schüsse krachten. Mit einem Bocksprung landete Russell auf dem Rücken eines der Pferde. Er erwischte die Zügel, beugte sich weit nach vorn und hämmerte dem Tier die Sporen in die Seiten. Das Pferd streckte sich. Eine Staubfahne hinter sich herziehend stob es die Straße hinunter.
Duncan Forrester folgte dem Beispiel seines Kumpans. Er gelangte in den Sattel, das Pferd machte zwei Sprünge, dann brach es mit dem Knall eines Schusses zusammen. Forrester überschlug sich auf der Straße, kam hoch – und wurde in den Kopf getroffen. Als er am Boden aufschlug, war er tot.
Amos Sheppard zog sich zurück. Er lief hinter den Häusern entlang zum Mietstall. Das Tor ließ sich öffnen. Im Stall war es finster wie im Schlund der Hölle. Der Bandit riss ein Streichholz an. Vages Licht breitete sich aus. Neben dem Tor hing an einem Nagel eine Laterne. Sheppard zündete sie an. Die Flamme rußte und flackerte, Sheppard stülpte den Glaszylinder darüber und sie brannte ruhig. Helligkeit kroch auseinander.
Im Schein der Laterne sattelte und zäumte Sheppard sein Pferd. Er arbeitete mit fliegenden Fingern. Dann saß er auf. Als er das Stalltor durchritt, musste er sich ducken. Er lenkte das Tier in die Gasse, in der der Mietstall lag und wandte sich stadtauswärts.
Ungeschoren verließ der Bandit die Stadt.
*
John Russell riss zwischen den Hügeln sein Pferd in den Stand. Die bremsenden Hufe des Tieres schlitterten über den Boden. Der Bandit lauschte angespannt. In der Stadt krachten immer noch Schüsse. Ein eisiger Schauer rann ihm den Rücken hinunter. Er begriff, dass sie die Reiter der Hackknife Ranch zu sehr auf die leichte Schulter genommen hatten. Nur nach und nach bekam er den Aufruhr in seinem Innersten unter Kontrolle.
Er trieb sein Pferd auf eine Anhöhe. Kühler Nachtwind streifte sein Gesicht. Leises Säuseln erfüllte die Finsternis, die ihn umgab. In der Stadt herrschte jetzt Ruhe. Russell fragte sich, was wohl aus Amos Sheppard und seinen anderen Kumpanen geworden war. Da vernahm er Hufschläge. Das Getrappel schlug heran wie eine Brandungswelle. Und dann sah Russell den Reiter aus der Dunkelheit kommen. Der Bandit ahnte, dass es sich um einen seiner Kumpane handelte. Er jagte den Abhang hinunter und schnitt dem Reiter den Weg ab. Vorsichtshalber behielt er den Revolver in der Hand.
»Stopp!«, schrie Russell.
Der Reiter stemmte sich gegen die Zügel. Das Pferd stieg auf die Hinterhand und drehte sich auf der Stelle. Dann krachten die Vorderhufe auf den Boden, das Tier schnaubte erregt. Ein Revolverhahn knackte. »Wer bist du?«, rief Russell.
»Ich bin‘s, Amos!«
Russell entspannte den Revolver und stieß ihn ins Holster. Dann ritt er zu Sheppard hin. »Was ist mit den anderen?«
»Duncan und Ernest hat es erwischt. Was mit Chuck ist, weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls auch vorgezogen, zu verschwinden.«
»Warten wir«, murmelt Russell. »Vielleicht taucht Chuck noch auf.«
Der Bursche, über dessen Schicksal die beiden Banditen vor der Stadt nicht Bescheid wussten, lauerte zwischen einem Haus und einem Schuppen. Die Finsternis, die ihn einhüllte, war tief und mit den Augen kaum zu durchdringen. Er hatte die Hufschläge vernommen und ahnte, dass sich seine Kumpane – soweit sie dazu noch in der Lage waren – abgesetzt hatten.
Er gab sich keinen Illusionen hin. Wenn er den Hackknife-Reitern in die Hände fiel, würde er baumeln. Beim Gedanken daran drohte ihm das Blut in den Adern zu gefrieren. Er zog sich zurück. An die Pferde vor dem Hotel wagte er sich nicht heran. Ihm war nicht entgangen, dass einer seiner Kumpane bei dem Versuch, sich eines der Tiere zu holen, erschossen wurde.
Hinter den Häusern angekommen atmete Chuck Webster auf. Er begann zu laufen. Die Angst vor dem Strick peitschte ihn vorwärts. Seine Lungen begannen zu pumpen, das Seitenstechen stellte sich ein, das Herz drohte ihm in der Brust zu zerspringen. Die Hügel nahmen ihn auf. Er hielt an und krümmte sich. Seine Bronchien pfiffen. Er presste seine rechte Hand auf die Lebergegend und hustete.
Es dauerte einige Minuten, bis bei dem Banditen Atmung und Herzschlag wieder den regulären Rhythmus aufnahmen. Dann machte er sich auf die Suche. Er bewegte sich zwischen den Hügeln, eine fast schmerzliche Anspannung erfüllte ihn und brachte seine Nerven zum Schwingen. Er war noch längst nicht in Sicherheit und vermutete, dass die Hackknife-Reiter die Gegend durchkämmen würden. Ohne Pferd hatte er kaum eine Chance.
Er umrundete die Stadt. Plötzlich wurde er aus der Dunkelheit angerufen: »Bist du es, Chuck?«
Er atmete auf. Es war Sheppards Stimme, die gerufen hatte. »Ja. Verdammt, ich dachte schon, ihr wärt über alle Berge.«
Zwei schattenhafte Gestalten tauchten auf. »Duncan und Ernest hat es erwischt«, gab Sheppard zu verstehen.
»Sie werden Jagd auf uns machen«, murmelte Webster. »Darum sollten wir so schnell wie möglich von hier verschwinden.«
»Ja, verduften wir«, murmelte John Russell. »Du kannst bei mir mit aufs Pferd steigen, Chuck.«
Sie ritten etwa vier Meilen, dann beschlossen sie, zu lagern. Sheppard übernahm die erste Wache, nach zwei Stunden weckte er Webster, und dann graute der Morgen. Die Nacht war ruhig verlaufen. Im Osten verfärbte sich der Himmel schwefelgelb. Der helle Schein kündete den Sonnenaufgang an. Sie wuschen sich den Schlaf aus den Gesichtern, ließ die Pferde saufen, dann saßen sie auf. Sie ritten am Fluss entlang nach Osten.
Im ersten Licht des Tages sahen sie vom Kamm einer Bodenwelle aus die Zelte. Sie waren bei einer Gruppe von Büschen am Ufer des Canadian errichtet. Ein Feuer brannte. Fünf Männer kauerten um das Feuer herum. Ein eisernes Dreibein war aufgestellt, von dem an dünnen Ketten eine metallene Platte baumelte, auf der eine verrußte Kaffeekanne stand. Die Pferde der fünf befanden sich in einem Seilcorral. Die Tiere zupften an dem Gras, das hier wuchs.
»Was sind das für Kerle?«, murmelte Sheppard wie im Selbstgespräch.
»Von der Hackknife Ranch scheinen sie nicht zu sein«, versetzte John Russell.
»Was treiben die hier?«, fragte Chuck Webster. »Sie scheinen sich auf einen längeren Aufenthalt hier eingerichtet zu haben. Wegen einer Nacht hätten sie sicher keine Zelte aufgestellt.«
»Da steht ein Pferd für dich, Chuck«, knurrte Sheppard.
Die Männer am Feuer erhoben sich und gingen zum Fluss. Zwei zogen sich aus, unter ihren Armen wurden Lassos durchgezogen, dann schwammen sie zu einem Felsen und tauchten.
»Was holen die vom Flussgrund?«, murmelte Sheppard nachdenklich.
Carter und Holbrook blieben fast eine Minute unter Wasser. Dann tauchten sie fast gleichzeitig auf. Sie schwammen zum Ufer und hielten den Delaney-Brüdern die Leinensäcke hin, in die sie Gold gefüllt hatten. Sie hatten am Vortag die Kiste mit dem Gold gefunden. Stundenlang tauchten sie nach dem Gold. Und jetzt hatten sie fast den gesamten Schatz gehoben.
Lance und Earl Delaney nahmen die Säcke und trugen sie zu den Zelten, schütteten den Inhalt in die Satteltaschen, die am Boden lagen, und brachten ihren Kumpanen die leeren Säcke zurück. Carter und Holbrook schwammen zurück zu dem Felsen und tauchten erneut.
Die Banditen hatten Stellung bezogen.
Die fünf Männer am Fluss hatten keine Ahnung, dass sie über Kimme und Korn der Gewehre beobachtet wurden. Carter und Holbrook brachten wieder gefüllte Säcke an Ufer und stiegen aus dem Wasser. Holbrook sagte: »Das war‘s. Die Kiste ist leer. Wir haben alles.«
Lance und Earl Delaney füllten den Inhalt der Leinensäcke in die Satteltaschen. Fünf prallgefüllte Satteltaschenpaare lagen am Boden. Sie hatten dem Canadian das Gold abgetrotzt. Carter und Holbrook begannen sich anzuziehen. Plötzlich peitschten Schüsse. Die Männer am Fluss wurden umgerissen. Die ineinander verschmelzenden Detonationen wurden über den Canadian geschleudert und rollten die Hügelflanken hinauf, um über den Anhöhen zu zerflattern. Nach den Schüssen trat tödliche Stille ein.
Die Banditen warteten ein wenig. Dann erhoben sie sich und näherten sich – die Gewehre an den Hüften im Anschlag – dem Camp. Doch von den reglos daliegenden Männern ging keine Gefahr aus. Sie lagen verkrümmt da, die absolute Leere des Todes in den gebrochenen Augen.
Amos Sheppard hatte eine der Satteltaschen geöffnet. »Ich werd verrückt!«, entrang es sich ihm. John Russell und Chuck Webster gingen zu ihm hin. »Die Taschen sind voller Gold«, murmelte Sheppard mit rauer Stimme. »Wir haben ausgesorgt, Leute. Holt die Pferde her. Wir beladen sie mit den Satteltaschen, und dann verduften wir nach Norden. In Kansas können wir das Geld in aller Ruhe verscherbeln.«
Sie holten die Pferde aus dem Seilcorral und legten ihnen die Sättel auf. Hinter den Sätteln schnallten sie die Satteltaschen fest. Sheppard und Russell holten ihre Pferde, die zwischen den Hügeln standen. Sie saßen auf und ritten an. Die ledigen Tiere führten sie an den langen Zügeln ...
*
Wir erreichten Tascosa und ritten den Mietstall an. Es war später Vormittag. Die Nacht hatten wir im Freien verbracht. Der Tag war warm, der Himmel ungetrübt blau, ein schraler Wind wehte und trieb feine Staubwirbel über die Fahrbahn.
Der Stallmann trat über die Schattengrenze unter dem hohen Tor, als wir absaßen. Es war ein bärtiger Mann um die vierzig, dessen braune Hose von breiten Hosenträgern gehalten wurde. Die Hemdärmel hatte er zurückgekrempelt. Er sah unsere Sterne und sagte: »Ihr kommt zu spät, Marshals. Die Bande hat in der Nacht hier für Furore gesorgt. Insgesamt sieben Männer der Hackknife Ranch wurden getötet. Allerdings hat es auch zwei der Banditen erwischt.«
Wir führten unsere Pferde in den Stall. Typischer Stallgeruch stieg mir in die Nase. Es war düster. Durch die Ritzen in den Wänden fielen in schräger Bahn Lichtstreifen, in denen Staubpartikel tanzten. Stampfen und Prusten erfüllte den Stall.
»Erzählen Sie«, forderte ich den Stallmann auf.
Der Mann räusperte sich, dann begann er: »Sheppard und seine Bande kamen vor einer Woche nach Tascosa. Die Kerle ließen die Stadtbewohner zwar in Ruhe, aber jeder in Tascosa fürchtete sie. Sie ritten jeden Tag fort und kamen am Abend zurück. Vorgestern Abend folgten ihnen vier Reiter der Hackknife in die Stadt. Die Bande hat Hackknife-Rinder gestohlen und zu einer Herde zusammengetrieben. Nun, es kam im Saloon zu einer Schießerei, bei der die Hackknife-Männer getötet wurden. Gute zwei Stunden später tanzte Glenn Stirling mit einer Crew in der Stadt an. Die Bande erwartete sie. Wieder krachte es. Am Ende waren drei Hackknife-Reiter und zwei Banditen tot. Sheppard und zweien seiner Banditen ist die Flucht gelungen.«
»Wurden Sie verfolgt?«
»Am Morgen versuchten Glenn Stirling und seine Mannschaft, die Spur der geflohenen Banditen aufzunehmen. Aber die Schufte waren verschwunden, als hätte sie die Erde geschluckt. Die Hackknife-Mannschaft kehrte auf die Ranch zurück. Stirling versprach aber, die Banditen zu jagen, bis ihnen die Zungen zu den Hälsen heraushängen.«
Joe und ich nahmen unsere Gewehre und gingen zur Schreinerei. Der Schreiner war auch Sargmacher und Totengräber. Er stand an der Hobelbank und bearbeitete ein breites Brett. Als wir seine Werkstatt betraten, hielt er inne. Es roch nach frischem Holz. Ein Haufen Hobelspäne lag dort am Boden, wo der Schreiner arbeitete. Ich grüßte, dann fragte ich, wo die beiden toten Banditen waren. Er führte uns in einen angebauten Schuppen. Die beiden lagen noch auf der zweirädrigen Karre, mit der er sie abgeholt hatte.
»Weiß man, wer sie sind?«
»Einer heißt Forrester, der andere Douglas. Stirling hat seine toten Männer mit auf die Hackknife genommen und wird sie dort beerdigen. Dabei könnte ich das Geld sehr gut gebrauchen.«
»Wer kommt für die Kosten der Beerdigung der beiden Banditen auf?«, fragte Joe.
»Die Stadt. Allerdings ist die Pauschale so knapp bemessen, dass ich gerade meine Unkosten decken kann.«
Joe schaute mich an und hob die Brauen. Dann verließen wir die Werkstatt wieder. »Alles dreht sich nur ums Geld«, murmelte mein Partner.
»Nichts ist umsonst«, versetzte ich. »Nicht mal der Tod. Er kostet das Leben.«
Wir begaben uns in den Saloon. Der Schankraum war leer. An den beiden Frontfenstern tanzten Fliegen. Der Keeper saß an einem der runden Tische und las in einer Zeitung. Wir ließen uns nieder. Der Keeper hatte sich erhoben und kam nun heran. »Was darf ich Ihnen bringen?«
»Zwei Bier«, sagte ich, »und etwas zu essen.«
»Ich kann Ihnen ein Steak braten.«
»Hervorragend.«
Er brachte die beiden Krüge mit dem Bier, dann verschwand er in der Küche. Ich hörte seine Stimme. Gleich darauf kam er zurück. »Gestern Abend und in der Nacht war in Tascosa die Hölle los«, sagt er laut. »Es ist eine Menge Blut geflossen.«
»Wir wissen Bescheid«, gab ich zu verstehen. »Wie lief die Schießerei ab?«
Der Keeper berichtete ausführlich. Während er sprach drehten wir uns Zigaretten und rauchten. Wir unterbrachen ihn nicht. Auf dem Vorbau waren Schritte zu hören, dann kamen drei Männer in den Schankraum. Ich erkannte den Town Mayor. Sein Name war Bannister. Ich kannte ihn von früheren Einsätzen in Tascosa. Er kam zu unserem Tisch und stellte uns die beiden anderen Männer als Mitglieder des Bürgerrats vor. Die drei setzten sich. »Ich habe veranlasst, dass das Distriktgericht verständigt wird«, erklärte Bannister.
»Wir sind zu spät gekommen«, antwortete ich. »Da wir keine Ahnung haben, wohin sich die geflohenen Banditen gewandt haben, und es keinen Sinn hat, aufs Geratewohl nach ihnen zu suchen, werden wir morgen Früh nach Amarillo zurückreiten. Kaum anzunehmen, dass sich Sheppard und seine beiden Kumpane noch einmal hierher wagen.«
»Wenn Sie wollen, bilden wir ein Aufgebot und helfen Ihnen, die Gegend nach den Schuften abzusuchen.«
»Das dürfte kaum Sinn machen«, erwiderte ich und winkte ab.
»Es ist nicht auszuschließen, dass sich Sheppard an der Stadt rächen will«, gab der Town Mayor zu bedenken.
»Wir bleiben bis morgen Früh«, sagte ich abschließend. »In der Stadt gibt es genug Männer, die den Banditen entgegentreten können, sollten sie noch einmal auftauchen.«
Der Town Mayor vermied es, mich anzusehen. Seinen Gesichtsausdruck konnte man als unglücklich bezeichnen. »Sheppard ist ein vom Gesetz gesuchter Verbrecher«, murmelte er. »Sie können ihn nicht einfach laufen lassen.«
»Irgendwo wartet der Strick oder eine Kugel auf ihn«, knurrte Joe.
»Es ist Ihre Entscheidung«, murmelt der Bürgermeister und erhob sich. »Hoffen wir, dass diese Banditen tatsächlich das Weite gesucht haben.« Auch die beiden Bürgerräte standen auf. Von ihren Gesichtern konnte ich ablesen, dass sie mit dem Ausgang des Gesprächs nicht zufrieden waren.
Wenig später waren wir wieder allein. Die Steaks kamen und wir aßen mit gesundem Appetit. Plötzlich war auf der Straße Geschrei zu vernehmen. Der Keeper ging zur Tür und trat ins Freie. Gleich darauf kam er zurück. »Da kommt einer die Straße entlang. Sein Gesicht ist voll Blut. Der Bursche scheint ziemlich am Ende zu sein.«
Nach dem letzten Wort lief der Keeper wieder hinaus.
Wir standen auf und verließen den Saloon. Der Mann schleppte sich mitten auf der Straße dahin. Er hatte kaum noch die Kraft, die Füße zu heben. Sein Gesicht war eine blutende Grimasse. In seinem Schlepptau befanden sich Männer, Frauen und Kinder. Stimmen schwirrten durcheinander. Von allen Seiten kamen weitere Neugierige hinzu. Der Mann erreichte den Saloon und fiel vor den Stufen zum Vorbau auf die Knie nieder. Er war Mitte der dreißig und blond. Eine Kugel hatte ihm einen Scheitel gezogen. Sein Kinn war auf die Brust gesunken, sein Oberkörper pendelte vor und zurück. Ein Stöhnen brach aus seiner Kehle.
»Holen Sie einen doppelten Whisky!«, trug ich dem Keeper auf, dann sprang ich vom Vorbau und trat neben den mitgenommenen Burschen hin. Joe half mir, ihn aufzurichten. Wir setzten ihn auf die Stufen des Vorbaus. Der Keeper brachte ein großes Glas voll Whisky und der blutende Mann trank gierig.
»Was ist geschehen?«, fragte ich. »Wer sind Sie?«
»Mein – mein Name ist Delaney – Lance Delaney. Wir – wir wurden am Fluss von drei Kerlen überfallen – etwa fünf Meilen von hier. Meine Brüder und meine Freunde – alle tot. Das Gold ...«
Die Stimme Delaneys brach. Sein Kopf sank wieder nach vorn und baumelte vor der Brust. Speichel tropfte von seinen Lippen.
»Hol jemand den Doc!«, rief ich.
Die Neugierigen standen Schulter an Schulter. Keiner wollte etwas versäumen. Murmeln und Raunen erhob sich.
»Ich hole ihn«, erbot sich der Keeper und eilte davon.
Der Verwundete versuchte sich zu erheben. Joe und ich halfen ihm. Wir brachten ihn in den Saloon und setzten ihn an einen Tisch. »Sie – sie dachten wohl, ich wäre tot. Wir kamen gar nicht zum Denken. Die Schufte nahmen unsere Pferde mit.«
»Sheppard und seine Kumpane«, sagte ich zu Joe, und mein Partner nickte. Ich heftete meinen Blick wieder auf Delaney. »Von welchem Gold sprachen Sie?«
»Wir – wir haben den Schatz gehoben. Er lag auf dem Grund des Canadian. Gold im Wert von einer Viertelmillion Dollar. Wir tauchten den ganzen Tag. Heute Früh dann kamen die ...«
Er verlor die Besinnung. Ich konnte ihn gerade noch festhalten, ehe er vom Stuhl fiel. Vorsichtig legten wir ihn auf den Fußboden. Ich zog meine Jacke aus, legte sie zu einem Bündel zusammen und schob es unter den Kopf des Mannes.
Der Arzt kam und untersuchte Delaney. »Die Kugel hat ihm eine ziemlich tiefe Furche über den Schädel gezogen«, sagte er. »Der Bursche hat viel Blut verloren und wird ein paar Tage Kopfschmerzen haben. Aber er hatte wohl Glück im Unglück. – Bringen wir ihn zu mir. Die Wunde muss gesäubert und desinfiziert werden.«
Im Saloon drängten sich die Menschen. Joe und ich hoben Delaney auf. Eine Gasse bildete sich, durch die wir den Besinnungslosen trugen. Der Arzt ging voraus. Ich bat den Keeper, meine Jacke aufzuheben und sie für mich aufzubewahren. Das Haus des Arztes lag am Ende einer Gasse inmitten eines gepflegten Gartens. Wir brachten Delaney in den Behandlungsraum und legten ihn auf das Feldbett, das in dem Raum stand.
Der Arzt machte sich an die Arbeit. Seine Frau ging ihm zur Hand. Sie sorgte für warmes Wasser und Leinentücher. Während der Arzt ihn versorgte, kam Delaney wieder zu sich. Mit dem stupiden Ausdruck des absoluten Nichtbegreifens starrte er zur Decke hinauf. Seine Augen glitzerten fiebrig und waren entzündet. In seinen Mundwinkeln zuckte es. Der Arzt verband die Wunde und Delaney sah aus, als hätte er eine weiße Haube auf.
Delaneys Atem ging rasselnd. Seine Brust hob und senkte sich unter den keuchenden Atemzügen. Sein Gesicht war jetzt vom Blut gesäubert. Die Augen lagen in tiefen, dunklen Höhlen. Seine Lippen waren trocken und rissig. In seinem Zustand musste der Fußmarsch in die Stadt eine Tortur gewesen sein.
»Sind Sie in der Lage zu sprechen?«, fragte ich.
»Ja.« Er schaute mich an. In seinen Augen flackerte es. Die Erinnerung schien sich bei ihm einzustellen.
»Berichten Sie«, forderte ich.
Er schluckte würgend, dann begann er mit lahmer Stimme: »Vor fünfzehn Jahren hat Shorty Kellock mit seiner Bande in Colorado einen Goldtransport überfallen, der auf dem Weg zur Münze in Denver war. Die Bande stahl Münzgold im Wert von 250.000 Dollar. Auf ihrer Flucht nahm sie den Weg durch den Panhandle, weil Kellock der Meinung war, dass sie im Indianerland etwaige Verfolger abschütteln konnten. Als sie den Canadian überquerten, waren plötzlich die Rothäute da. Der Schatz versank im Fluss. Nur einer der Banditen konnte sich retten.«
»Und er ist jetzt nach fünfzehn Jahren zurückgekehrt, um den Schatz zu heben«, resümierte ich.
»Es – es handelt sich um meinen Bruder Jack. Ja, er war damals dabei. Es gelang ihm, sich nach New Mexico durchzuschlagen. Der Schatz ließ ihm keine Ruhe. – Wir haben ihn gefunden. Die Kiste war noch nicht verrottet. Wir holten das Gold nach und nach aus dem Fluss. Es waren Münzrohlinge. Heute Früh krachten plötzlich Schüsse.«
»Das Gold gehört dem Staat«, murmelte Joe. »Ihr wolltet es euch unter den Nagel reißen. Das ist Diebstahl.«
»Die Regierung hatte das Gold längst abgeschrieben«, versetzte Delaney mit lahmer Stimme.
»Wo geschah der Überfall?«, fragte ich.
»Fünf Meilen flussabwärts.«
Joe und ich verließen das Haus des Arztes, begaben uns zum Mietstall und halfen dem Stallburschen, unsere Pferde zu satteln und zu zäumen ...
*
Wir folgten dem Canadian. Nachdem wir eine Stunde geritten waren, stießen wir auf den Lagerplatz. Einige kleine Zelte standen am Rand des Ufergebüsches. Vier Männer lagen am Boden. Wir saßen ab und banden unsere Pferde an einen Strauch. Von den Männern lebte keiner mehr. Zwei von ihnen waren in den Rücken geschossen worden.
Ich begann den Lagerplatz zu umrunden. Die Spur vieler Pferde führte am Fluss entlang. Ich ging zu Joe und sagte: »Sie sind nach Osten geritten, nehme aber an, dass sie diese Richtung nicht beibehalten. Sie werden versuchen, sich nach Norden abzusetzen, denn in Texas dürfte ihnen der Boden verdammt heiß werden unter den Füßen.«
»Wir sind nicht ausgerüstet für einen längeren Ritt durch die Wildnis«, gab Joe zu bedenken.
»Wir rüsten uns aus, dann folgen wir ihnen«, versetzte ich. »Wir müssen auch dafür sorgen, dass die vier Toten nach Tascosa gebracht werden.«
»Die nächste Stadt im Norden ist Channing«, bemerkte Joe. »Vielleicht wenden sie sich dorthin.«
»Möglich. Auch sie müssen sich für einen längeren Ritt durch die Wildnis ausrüsten. Ja, es ist nicht auszuschließen, dass sie nach Channing reiten.« Ich schaute nach dem Stand der Sonne. »Es ist gleich Mittag. Die Banditen haben vier – fünf Stunden Vorsprung. Aber sie haben einige ledige Pferde dabei und werden nicht so schnell vorankommen. Wir haben gute Chancen, sie vor der Grenze einzuholen.«
»Vorausgesetzt, sie haben sich nach Norden gewandt.«
»Wir werden es sehen.«
Eine gute Stunde später waren wir wieder in der Stadt. Wir ritten zur Schreinerei und trugen dem Totengräber auf, die Leichen der Delaney-Brüder und ihrer Gefährten in die Stadt zu holen. Dann begaben wir uns zum Haus des Arztes. Wir erfuhren, dass Lance Delaney gegen den Rat des Arztes dessen Haus verlassen hatte. Wir fanden Delaney im Saloon. Außer ihm waren fast ein Dutzend Männer der Stadt anwesend. Delaney saß vor einem Bier und rauchte. Seine Augen blickten wieder klar. Wir setzten uns zu ihm.
»Wart ihr draußen?«, fragte er.
Ich nickte. »Wir haben vier Tote gefunden. Der Totengräber holt sie in die Stadt. Der Doc meint, Sie sind noch nicht in der Lage ...«
Delaney winkte ab. »Die Schufte haben meine Brüder ermordet. Ich werde mir ein Pferd besorgen und Jagd auf sie machen. Das habe ich mir geschworen. Ich werde nicht ruhen, bis ich die Hurensöhne zur Rechenschaft gezogen habe.«
»Geht es Ihnen wirklich nur um Vergeltung?«, fragte ich und beobachtete das Gesicht des Burschen.
Seine Brauen schoben sich zusammen. »Es geht auch um das Gold.«
»Es gehört der Regierung.«
»Zumindest einen Finderlohn kann ich beanspruchen.«
»Das ist fraglich. Ihr Bruder gehörte zu den Banditen, die das Gold raubten. Sie wollten ihm helfen, sich den Schatz unter den Nagel zu reißen.«
Delaneys Kiefer mahlten. Er gab mir keine Antwort. Aber ich konnte in seinen Zügen lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Sein Entschluss stand fest und war unumstößlich.
Ein Mann trat an unseren Tisch heran. Er war dunkelhaarig und Mitte der vierzig. Sein Gesicht war unbewegt. »Eine interessante Geschichte«, sagte er. »Glauben Sie, Marshal, dass die Regierung eine Wiederbeschaffungsprämie für das Gold bezahlt?«
»Ich weiß es nicht«, versetzte ich. »Es ist jedoch möglich. Wollen Sie das Gold zurückholen?«
Der Mann spitzte die Lippen. »Wenn sie nur zehn Prozent zahlen, wären das 25.000 Dollar. Dafür lohnt es sich, in den Sattel zu steigen. Meinen Sie nicht, Marshal?«
»Sie können sich aber auch heißes Blei einhandeln«, antwortete ich. »Sheppard und seine Kumpane haben bewiesen, dass sie erst schießen und dann die Fragen stellen.«
Der Bursche zuckte mit den Schultern, machte kehrt und ging zu seinem Tisch zurück. Er und die beiden anderen Kerle, die dort saßen, steckten die Köpfe zusammen und flüsterten angeregt.
Joe und ich verließen den Saloon und gingen in den Store. Wir kauften Proviant für ein paar Tage, hängten die Leinensäcke mit den Lebensmitteln an unsere Sättel und saßen auf. Als wir den Saloon passierten, stand auf dem Vorbau Lance Delaney. Der Verband um seinen Kopf leuchtete weiß. Ich lenkte mein Pferd zum Saloon und zügelte es. »Sie sollten es sich gut überlegen, ob Sie in Ihrem Zustand auf ein Pferd steigen«, gab ich zu bedenken.
»Ich habe mich entschieden«, versetzte Delaney hart.
»Sie sind uneinsichtig und stur.«
»Nein, Marshal. Ich habe lediglich ein Ziel vor Augen.«
»Es geht um das Gold, nicht wahr?«
»Auch. Es geht aber auch um Rache für meine Brüder.«
»Hass führt in die Hölle, Delaney.«
Der Bursche hob die Schultern, ließ sie wieder sinken und erwiderte: »Keiner kann aus seiner Haut. Ich habe einen Schwur abgelegt.«
Ich zog mein Pferd halb um die rechte Hand und folgte Joe, der schon weitergeritten war.
*
Delaney schaute den beiden Marshals hinterher und nagte gedankenverloren an seiner Unterlippe. Sein Blick schien sich nach innen verkehrt zu haben. Drei Männer drängten aus der Tür des Saloons. Delaney hörte ihre Schritte hinter sich und drehte den Kopf. Die drei schauten ihn an. Er ahnte, dass sie etwas von ihm wollten und wandte sich um. Einer sagte: »Mein Name ist James Benbow. Das sind Elwell O‘Mally und Liam Jones.«
»Was wollt ihr?«
»Wir nehmen an, dass du den Mördern deiner Brüder folgen willst. Wir könnten dir helfen, sie zur Rechenschaft zu ziehen.«
»Ihr wollt das Gold, wie?«
»Natürlich sind wir auf das Gold scharf. Wenn wir durch vier teilen, hat jeder so viel, dass er sich für den Rest seines Lebens zur Ruhe setzen kann.«
Misstrauisch musterte Delaney die drei. Benbow mochte Mitte der vierzig sein. Die anderen beiden waren jünger. Um die dreißig. Plötzlich nickte Delaney und sagte zwischen den Zähnen: »In Ordnung. Wir reiten in einer halben Stunde. Kommt zum Mietstall. Ich warte dort auf euch.«
»Ich wusste doch, dass du unser Angebot nicht ausschlägst«, sagte Benbow grinsend. »Bis in einer halben Stunde also.«
Delaney begab sich zum Mietstall. Der Stallmann saß auf einer Futterkiste und nähte einen Sattel, den er auf seinem linken Oberschenkel liegen hatte. Neben ihm auf der Kiste lag ein handlicher Klumpen Schusterpech, durch das er den Faden zog, um ihn wasserabweisend zu machen.
Jetzt nahm der Stallmann den Sattel von seinem Oberschenkel, legte ihn auf den Boden und erhob sich. Fragend blickte er Delaney entgegen. Dieser sagte: »Ich würde gerne ein Pferd und einen Sattel kaufen.«
»Dann sind Sie bei mir richtig«, antwortete der Stallbursche. »Suchen Sie sich ein Pferd aus. Über den Preis können wir dann verhandeln.«
Delaney entschied sich für einen hochbeinigen Braunen mit breiter Brust, was kräftige Lungen verriet. Der Stallmann sagte: »Der kostet hundert Dollar. Den Sattel und das Zaumzeug lege ich drauf. Das ist ein fairer Preis.«
Delaney zahlte die hundert Dollar. Der Stallmann sattelte und zäumte das Pferd. Währenddessen ging Delaney zum Store. Er kaufte sich eine Winchester und Munition sowie einen Sack voll Proviant. Damit kehrte er zum Mietstall zurück. Benbow, O‘Mally und Jones warteten schon. Der Stallmann führte den Braunen ins Freie. Die Männer saßen auf und ritten vom Hof des Mietstalles.
*
Die Sonne schien auf dem Horizont im Westen zu stehen. Die Schatten waren lang. Im Osten verfärbte sich der Himmel von blau nach grau. Sheppard, Russell und Webster zügelten die Pferde auf der Kuppe eines Hügels, über den der Weg führte. Unten, in der Senke, lag Channing, ein ehemals kleiner Ort, der sich innerhalb weniger Wochen zu einer richtigen Stadt gemausert hatte, nachdem die Bahnlinie daran vorbeiführte. Russell und Webster führten jeweils zwei der Pferde, die sie Delaney und seinen Leuten weggenommen hatten. Die Satteltaschen an den Sätteln der Pferde waren prall mit Gold gefüllt.
Die Banditen hatten keine Ahnung vom Namen des Ortes, der vor ihren Blicken lag. Sie sahen den in der Sonne glitzernden Schienenstrang und die Menschen zwischen den Häusern. Ein Fuhrwerk fuhr von Westen her in die Stadt. Hier und dort standen an den Holmen Pferde.
»Reiten wir hinunter?«, fragte Chuck Webster, ein dreißigjähriger, dunkelhaariger Bandit.
»Ich weiß nicht, ob das gut ist«, murmelte Amos Sheppard. »Wenn drei wie wir vier ledige Sattelpferde mit sich führen, wirft das Fragen auf. Und die prall gefüllten Satteltaschen sind nicht zu übersehen.«
»Vielleicht sollten wir uns einen leichten Wagen beschaffen«, sagte John Russell. »Im Mietstall ist man sicher bereit, einen Einspänner gegen die vier Pferde einzutauschen.«
»Gute Idee«, lobte Chuck Webster.
Sheppard wiegte skeptisch den Kopf. »Mit einem Wagen kommen wir in der Wildnis nicht so gut voran. Im Übrigen ist es nicht gut, wenn ich mich in dem Nest sehen lasse. Möglicherweise erkennt man mich. Es ist nicht auszuschließen, dass es einen Town Marshal oder Deputysheriff gibt. Außerdem verfügen sie über einen Telegrafen.«
»Wir brauchen aber Proviant«, gab Chuck Webster zu verstehen. »Weiß der Teufel, wann wir wieder auf eine Ansiedlung stoßen.«
»Reite du in die Stadt und besorge den Proviant, Chuck«, sagte Sheppard. »John und ich warten vor der Stadt auf dich.«
»Und wenn ich zurückkomme, seid ihr über alle Berge, wie? Durch zwei geteilt bringt das Gold jedem von euch einiges mehr als wenn man es durch drei teilen muss.«
»Du misstraust uns?«, fragte Sheppard fast drohend.
»Ja«, gab Webster offen zu. »Beim Geld endet jede Freundschaft. Ein alter, aber weiser Spruch.«
»Verdammt, Chuck, du beleidigst mich!«, blaffte Sheppard.
»Und mich auch!«, pflichtete John Russell bei.
»Seit wann seid ihr so sensibel?«
»Ich reite in das Nest«, erbot sich Russell und schoss Webster einen bösen Blick zu. »Mit dir unterhalte ich mich noch.«
Sie zogen an der Stadt vorbei und lagerten nördlich von ihr zwischen den Hügeln.
»Willst du nicht noch einmal über meinen Vorschlag mit dem Einspänner nachdenken, Amos?«, fragte John Russell, der rothaarige Bandit.
»Mit den Pferden kommen wir besser voran«, entgegnete Sheppard. »Und im Niemandsland müssen wir vielleicht ausgesprochen beweglich sein. Dort oben treiben sich Cheyenne und Comanchen herum. Und diese Brüder sind noch immer nicht gut auf uns Bleichgesichter zu sprechen.«
»Wie du meinst.« John Russell trieb sein Pferd mit einem Schenkeldruck an und verschwand wenig später zwischen den Hügeln. Er folgte den Windungen zwischen den Anhöhen und schließlich erreichte er die Straße, die zur Stadt führte. Das verwitterte Ortsschild, von dem die Farbe schon abblätterte, verriet ihm, dass der Ort Channing hieß.
Er ritt zum Saloon. Am Hitchrack standen ein halbes Dutzend Pferde. Sie trugen das Brandzeichen der Hackknife Ranch. John Russell hatte plötzlich ein ungutes Gefühl, und er überlegte, ob er hineingehen sollte. Schließlich überwand er sich, saß ab, stellte sein Pferd in die Reihe der anderen, zog das Gewehr aus dem Scabbard und ging in den Saloon. Es war düster im Schankraum. Der Keeper hatte noch kein Licht gemacht. Die sechs Männer, die zu den Pferden am Hitchrack gehörten, standen am Tresen und tranken Whisky. An verschiedenen Tischen saßen einige Männer. Russell setzte sich an einen freien Tisch und lehnte das Gewehr an einen Stuhl. »Ein Bier!«, rief er.
Einer der Cowboys stieß sich vom Schanktisch ab und kam mit wiegenden Schritten näher. Vor Russells Tisch blieb er stehen und hakte die Daumen in seinen Patronengurt. Unter zusammengeschobenen Brauen hervor musterte er den Banditen.
»Hast du ein Problem?«, fragte der rothaarige Bandit, der den Blick trotzig erwiderte.
»Wir durchkämmen das Land auf der Suche nach drei Halsabschneidern, die in Tascosa den Teufel aus dem Sack gelassen haben. Der Anführer der Bande heißt Sheppard – Amos Sheppard. Er ist ein Mörder und Räuber und der Regierung fünfhundert Dollar wert.«
»Ich komme von Westen herüber«, versetzte Russell. »Mein Ziel ist das Eisenbahncamp. Bei der Union Pacific soll man nicht schlecht verdienen.«
»Du hast nicht die Hände eines Mannes, der Schwellen und Schienen verlegen könnte«, sagte der Cowboy.
Russell lachte amüsiert auf. »Schließt du von den Händen eines Mannes auf seine Qualitäten?«
»Hände verraten viel«, versetzte der Cowboy.
Russell zuckte mit den Schultern. »Ich kann dir nicht helfen, Hombre. Von den dreien, die ihr sucht, habe ich nichts gesehen.«
Der Cowboy wollte sich abwenden, um zum Tresen zurückzugehen, als ein hochgewachsener Mann den Saloon betrat. Er war mit einem schwarzen Anzug bekleidet, unter der Jacke trug er ein weißes Hemd, um seinen Hals lag eine weinrote Schnürsenkelkrawatte, auf seinem Kopf saß ein flachkroniger, schwarzer Stetson mit breiter Krempe. An seiner linken Brustseite blinkte ein Stern.
»Hallo, Marshal«, dehnte der Cowboy.
Der Town Marshal nickte dem Burschen zu, dann kam er zu Russells Tisch und sagte: »Guten Tag, Fremder. Ich bin Town Marshal Clint Dexter. Wie ist Ihr Name?«
»Buck Callagher«, log der Bandit. »Ich will zum Eisenbahncamp. Es soll zwischen dieser Stadt und Tascosa liegen.«
»Viele wollen dorthin«, versetzte Dexter. »Unter den vielen sind Glücksritter, Abenteurer, Spieler und – Banditen. Zu welcher Sorte gehören Sie?«
»Ich suche Arbeit bei der Eisenbahn, Marshal.«
»Wann reiten Sie weiter?«
»Ich denke, ich verlasse heute Abend noch die Stadt. Ich habe so viele Nächte im Freien verbracht, dass es mir auf diese eine Nacht auch nicht mehr ankommt.«
Russell setzte ein schiefes Grinsen auf.
Der Marshal nickte. Dann ging er zum Tresen. Der Cowboy, der mit Russell gesprochen hatte, folgte ihm. Russell trank das Bier, dann verließ er den Saloon. Schräg gegenüber war der Store. Er führte sein Pferd am Zaumzeug über die Straße und stellte es an den Holm vor dem Laden. Dann ging er hinein.
Auf den Vorbau des Saloons trat der Marshal. Er stellte sich ans Geländer und legte die Hände darauf. Dann wartete er. Es dauerte über eine Viertelstunde, dann kam Russell wieder ins Freie. Er trug einen prallgefüllten Leinensack, ging zu seinem Pferd, hängte den Sack ans Sattelhorn, band das Tier los und schwang sich in den Sattel.
Der Marshal tauchte unter dem Vorbaugeländer hindurch und sprang auf die Fahrbahn. Russell zog das Pferd halb um die linke Hand und wollte es antreiben. »Einen Augenblick, Callagher!«, rief der Marshal.
Der Bandit zerrte das Pferd in den Stand. Ihm war ein wenig unbehaglich zumute. Sein Gesichtsausdruck verriet es. »Was ist?«
Der Town Marshal blieb zwei Schritte vor Russell stehen. »Wozu der Proviant, Callagher. Sie haben höchstens noch vier Stunden zu reiten bis zum Camp.«
Russell legte beide Hände übereinander auf den Sattelknauf und beugte sich ein wenig nach vorn. »Bin ich Ihnen Rechenschaft schuldig, Marshal? Befinden wir uns nicht in einem freien Land?«
»Sicher, Callagher. Schreiben Sie‘s meiner berufsmäßigen Neugier zu.« Der Town Marshal grinste. »Gute Reise, Callagher.«
»Danke.« Russell schnalzte mit der Zunge. »Hüh!« Sein Pferd setzte sich in Bewegung.
*
Wir fanden die Stelle, an der die Banditen den Fluss überquert hatten. Deutlich zeichneten sich die Hufabdrücke der Pferde auf dem sandigen Ufersaum ab. Hier war der Canadian breit und ziemlich ruhig. Im Westen versank die Sonne. Der Himmel hatte sich glutrot verfärbt. Hügel, Bäume und Sträucher hoben sich vor dieser Kulisse scharf und schwarz ab.
Wir ritten in den Fluss. Bald reichte das Wasser den Pferden bis zu den Bäuchen. Schließlich mussten sie schwimmen. Wir hielten unsere Revolver und die Gewehre in die Höhe. Dann hatten die Tiere wieder festen Boden unter den Füßen. Wir trieben sie die Uferböschung hinauf und saßen ab. Die Spur der Banditen lag deutlich vor uns. Sie führte nach Norden.
Nass bis unter die Brust machten wir ein Feuer, dann zogen wir uns aus und hängten unsere Kleidung rund um das Feuer an Stockkonstruktionen auf, die wir zu diesem Zweck errichteten. Während unsere Klamotten trockneten, aßen wir Dörrfleisch und trockenes Brot und tranken dazu Wasser. Die Pferde weideten. Dann rauchten wir. Nach einer Stunde etwa konnten wir uns wieder ankleiden. Es war jetzt ziemlich dunkel. Wir nahmen den Pferden die Sättel ab und banden die Tiere an. Nachdem wir unsere Decken am Boden ausgebreitet hatten, nahm ich das Gewehr und sagte zu Joe: »Ich übernehme die erste Wache. In fünf Stunden wecke ich dich. Bei Tagesanbruch reiten wir weiter.«
Mit dem letzten Wort setzte ich mich in Bewegung, stieg einen Hügel hinauf und setzte mich bei einigen Büschen auf einen Felsbrocken.
Die Dunkelheit nahm zu. Am Himmel blinkten die Sterne. Der Mond stand im Osten. Manchmal schoben sich Wolken vor den Mond, dann glitten dunkle Schatten über das Land. Irgendwo in der Ferne bellte ein Coyote. Das Feuer am Fuß des Hügels war niedergebrannt und war nur noch ein roter Glutpunkt in der Nacht.
Ich versuchte mich in die Situation Sheppards zu versetzen. An seiner Stelle würde ich die Städte und Ansiedlungen, die am Weg nach Norden lagen, meiden. Der Bandit musste damit rechnen, dass er die Neugierde der Menschen weckte und man sehr schnell herausfand, dass er und seine Kumpane Unmengen von Gold beförderten. Das konnte so manchen Mann auf dumme Gedanken bringen. Und gegen Kugeln aus dem Hinterhalt waren auch die Banditen nicht gefeit. Wenn er kein Risiko eingehen wollte, dann ritt er an den Ortschaften vorbei.
Meine Gedanken schweiften ab. Ich dachte an Jane, meine Verlobte. Seit mehreren Wochen hatte ich sie schon nicht mehr gesehen. Mein Job ließ mir nicht die Zeit, zu ihr zu reiten. Fühlte Jane sich überhaupt noch an mich gebunden? Ich spürte beim Gedanken daran, dass Jane sich vielleicht längst von mir losgesagt hatte, einen schmerzlichen Stich in der Brust. Und ich nahm mir vor, sobald ich wieder in Amarillo war, den Richter um drei Tage Urlaub zu bitten, um zum Mulberry Creek zu reiten und Jane zu sprechen. Ich verspürte plötzlich eine innere Unrast, die ich kaum zu bändigen vermochte.
Da trieb das Wiehern eines Pferdes heran. Es kam von der anderen Seite des Canadian. Ich hielt den Atem an und lauschte konzentriert. Die Gedanken an Jane hatte ich schlagartig ins Unterbewusstsein verbannt. Ich war hellwach und angespannt.
Das Wiehern wiederholte sich nicht. Aber ich hatte mich ganz sicher nicht getäuscht. Da kam auch schon Joe den Hügel herauf. Zunächst konnte ich ihn nur als Schemen erkennen, aber dann nahm seine Gestalt Formen an, und schließlich erreichte mich Joe. »Hast du das gehört?«
»Ja. Es kam von Süden. Es kann sich um Reiter der Hackknife handeln.«
»Kann«, murmelte Joe grimmig. »Es kann aber auch jemand sein, der auf unserer Fährte klebt, weil er denkt, dass wir ihn zu dem Gold führen.«
»Lance Delaney«, murmelte ich.
»Genau von dem rede ich«, sagte Joe.
Ich dachte unwillkürlich an den dunkelhaarigen Burschen im Saloon, der mich fragte, ob die Regierung gegebenenfalls eine Wiederbeschaffungsprämie bezahlen würde. Er hatte mit zwei Kerlen am Tisch gesessen. Nach dem Gespräch mit mir hatten sich die drei ziemlich angeregt unterhalten. Ich verlieh meinen Gedanken Ausdruck. Als ich geendet hatte, knurrte Joe: »Das ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass diese Narren hinter uns herreiten. Wir werden es morgen sehen.«
»Leg dich wieder hin«, sagte ich.
Joe stieg den Hügel hinunter. Es blieb ruhig. Nach fünf Stunden weckte ich Joe. Ich rollte mich in meine Decke und schlief sofort ein.
Als Joe mich weckte, hatte sich die Nacht gelichtet, die Sterne begannen zu verblassen, von Osten her näherte sich der Tag. Es dauerte kurze Zeit, bis ich mich richtig zurechtfand. Nachdem ich mir einige Hände des kalten Wassers ins Gesicht geworfen hatte, sah ich klar. Wir rollten unsere Decken zusammen, sattelten die Pferde, nahmen die Gewehre zur Hand und warteten.
Es wurde schnell hell. Zwischen den Hügeln auf der anderen Flussseite tauchten vier Reiter auf. Ich erkannte Lance Delaney an dem weißleuchtenden Verband um seinen Kopf. Mit ihm ritten die drei Kerle, die sich bei uns nach einer Wiederbeschaffungsprämie für das Gold erkundigt hatten.
Sie trieben ihre Pferde ins Wasser. Nach einiger Zeit erklommen die Tiere die Uferböschung. Die Kerle saßen ab. Sie waren nass bis über die Hüften hinauf. Nun setzten sie sich auf den Boden, zogen ihre Stiefel aus und entleerten sie vom Flusswasser.
Der Augenblick für uns war günstig. Wir traten, die Gewehre an der Hüfte im Anschlag, in Erscheinung. Die vier hielten inne und starrten uns finster an. Joe ging halb um sie herum, sodass wir sie zwischen uns hatten. »Das Gold wiederzubeschaffen und die Mörder zu strafen ist Sache des Gesetzes«, erklärte ich mit klirrender Stimme.
Delaney, der sich zuerst gefangen hatte, knirschte zwischen den Zähnen: »Sie können uns nicht daran hindern, nach Norden zu reiten.«
»Sicher nicht. Aber ich warne euch. Kommt uns nicht in die Quere.« Ich heftete den Blick auf Delaney. »Die Zeiten, in denen jemand das Gesetz in seine eigenen Hände nehmen durfte, sind vorbei, Delaney. Wenn Sie einen der Mörder Ihrer Brüder erschießen, wird zu prüfen sein, ob sie nicht aus niedrigen Beweggründen handelten. Und es ist nicht auszuschließen, dass der Schuss mit einer Anklage wegen Mordes endet. Was auf Mord steht, wissen Sie sicher.«
»Das Distriktgericht wird Steckbriefe erlassen, und auf ihnen wird es heißen tot oder lebendig.«
»Noch sind keine Steckbriefe erlassen«, versetzte ich. »Und darum sind Sie nicht legitimiert, auf Sheppard und seine Kumpane mit der Waffe in der Hand loszugehen.«
Delaney schwieg verbissen.
Ich beugte mich ein wenig im Sattel vor. »Sind Sie überhaupt Lance Delaney?«, fragte ich einer jähen Eingebung folgend.
»Wer soll ich sonst sein?«
»Vielleicht sind Sie Jack Delaney. Jack Delaney darf seinen richtigen Namen nicht nennen, denn er war dabei, als damals das Gold geraubt wurde. Auf ihn wartet noch nach fünfzehn Jahren der Galgen.«
»Jack Delaney ist tot«, presste der Bursche hervor.
Ich richtete den Oberkörper wieder auf und reckte die Schulter. »Kehren Sie um«, sagte ich. »Es ist ein guter Rat, den Sie sich zu Herzen nehmen sollten.«
Die vier Kerle starrten uns an.
Mir wurde schlagartig klar, dass sie nicht davon abzubringen waren, Sheppard und seinen Kumpanen zu folgen. Ein Blick in die verkniffenen Gesichter sagte es mir. Bei Delaney mochte der Gedanke an blutige Rache im Vordergrund stehen; bei den Männern aus Tascosa war es die reine Habgier.
*
Sheppard, Russell und Webster hatten gefrühstückt. Nun brachen sie auf. Die Nasen der Pferde zeigten nach Norden. Bis zur Grenze zum Niemandsland lagen etwa achtzig Meilen vor ihnen. Der Streifen zwischen Texas und Kansas war etwa vierzig Meilen breit. Drei – vier Tagesritte, dann würden sie in Kansas und in Sicherheit sein.
Die Banditen gaben sich keinen falschen Hoffnungen hin. Im Niemandsland trieben sich Comanchen und Cheyenne herum. Vor ihnen lag unter Umständen die Hölle. Sie kamen an eine Wegkreuzung. An einen Pfahl waren drei Schilder genagelt. Zwei wiesen nach Norden, auf einem stand Hartley, 20 miles, auf dem anderen Dalhart, 40 miles. Das dritte Schild wies nach Osten. Sanford, 65 miles hieß es da.
Die Banditen verließen die Straße und hielten auf einen Einschnitt zwischen den Hügeln zu. Auf den Abhängen und Kämmen wuchsen kniehohe Sträucher. Dazwischen wucherte Gras. Da es schon lange nicht mehr geregnet hatte, war es braun verfärbt. Die Banditen zogen zwischen den Hügeln hindurch.
Um einen der Hügel kam ein Reiter. Er lenkte das Pferd mit den Schenkeln und hatte sich den Kolben der Winchester unter die Achsel geklemmt. Die Linke hielt das Gewehr am Schaft fest, der Zeigefinger seiner Rechten krümmte sich um den Abzug.
Es war Town Marshal Clint Dexter. Seit die Eisenbahn Channing erreicht hatte, war er im Amt. Mit der Eisenbahn war eine Menge zwielichtiges Gesindel ins Land gekommen; Spieler, Huren, Revolvermänner, Banditen ... Sie hatten die Städte entlang des Schienenstrangs in Sündenpfuhls und Lasterhöhlen verwandelt. Die Bürger mussten sich irgendwie schützen. Und so setzten sie Town Marshals ein.
Die Banditen zügelten ihre Pferde. Ihre Hände tasteten zu den Revolvern. In den Gesichtern arbeitete es. Das Pferd mit Clint Dexter stampfte näher. Drei Pferdelängen vor den Banditen parierte der Town Marshal seinen Vierbeiner. »Ich ahnte doch gleich, dass mit dir etwas nicht stimmt, Rotschopf. Ihr seid die drei Kerle, hinter denen die Hackknife her ist wie der Teufel hinter der armen Seele, nicht wahr?«
»Machen Sie den Weg frei, Marshal«, sagte Amos Sheppard mit schmalen Lippen.
Clint Dexter ignorierte diese Aufforderung. »Was sind das für Pferde, die ihr da führt? Habt ihr sie geklaut?«
»Ihr Stern ist außerhalb der Stadt gerade mal das Blech wert, aus dem er gestanzt wurde«, ergriff wieder Sheppard das Wort. »Also gehen Sie zur Seite, ehe wir Ihnen Beine machen.«
Jetzt richtete Dexter den Blick auf Amos Sheppard. »Dein Gesicht kenne ich von dem Steckbrief, der bei mir im Office im Schreibtischschub liegt. Wenn ich mich nicht irre, dann bist du fünfhundert Bucks wert.«
Sheppards Miene verschloss sich noch mehr. »Willst du versuchen, dir das Geld zu verdienen?«
»Ja. Nehmt die Hände in die Höhe. Wer nach dem Revolver greift, stirbt. Und das ist kein leeres Versprechen.«
Der Sheriff drückte ab. Die Kugel pfiff über Sheppards Kopf hinweg. Es war ein Signal. Zu beiden Seiten auf den Anhöhen erschienen Reiter. Ein Aufgebot aus Channing, das am Morgen losgeritten war, um sich an der Suche nach Amos Sheppard und seinen Banditen zu beteiligen.
Chuck Webster fluchte und zog den Revolver. Das Gewehr in Clint Dexters Händen ruckte ein wenig herum und brüllte auf. Webster spürte den Einschlag, sein Oberkörper pendelte zurück. Sheppard und Russell feuerten fast gleichzeitig. Der Town Marshal wurde vom Pferd gerissen. Die Banditen gaben ihren Pferden die Sporen. Die ledigen Pferde wurden mitgerissen. Sie jagten auf der Sohle zwischen den Hügeln dahin. Schüsse peitschten hinter ihnen her, aber das Auf und Ab des stiebenden Galopps ließ es nicht zu, das Ziel richtig zu erfassen. Und so richteten die Kugeln der Männer aus Channing keinen Schaden an.
Die Hügel öffneten sich, eine weitläufige Ebene lag vor den Banditen. Die Hufe ihrer Pferde wirbelten und schienen kaum den Boden zu berühren. Aus Websters Schulterwunde pulsierte Blut. Das Gesicht des Banditen war schmerzverzerrt. Aber er hielt durch. Wenn er ihnen in die Hände fiel, war er verloren.
Die beiden Verfolgergruppen hatten sich dort, wo der Town Marshal am Boden lag, getroffen. Zwei Männer waren abgesessen und kümmerten sich um den Verwundeten. Die anderen trieben ihre Pferde an. Schon bald jagten sie in die Ebene hinein, die die Banditen schon zur Hälfte durchquert hatten. Weiter nördlich buckelten wieder Hügel.
Mit den langen Zügeln und heiserem Geschrei feuerten die Banditen ihre Pferde an. Sheppard schaute über die Schulter zurück. Es waren sieben Reiter, die die Verfolgung aufgenommen hatten. Sie jagten in einem Pulk über die Ebene.
»Reitet weiter!«, brüllte Sheppard und der Reitwind riss ihm die Worte von den Lippen. Er zügelte und drehte das Pferd herum. Die Winchester flirrte aus dem Scabbard. Der Bandit repetierte und schoss. Ein Pferd ging vorne nieder und überschlug sich. Der Reiter flog durch die Luft. Die anderen Reiter fächerten auseinander. Sheppards zweite Kugel ging fehl. Er gab noch einen dritten Schnappschuss ab, dann riss er das Pferd herum und setzte unbarmherzig die Sporen ein. Seine Kumpane waren schon an die hundert Yards entfernt.
Einige der Verfolger rissen ihre Pferde zurück, zerrten sie in den Stand und hoben die Gewehre an die Schulter. Eine Salve peitschte hinter Sheppard her. Sein Pferd brach nach links aus. Eine Kugel hatte das Tier gestreift. Sheppard konnte es nicht bändigen. Es vollführte einige Bocksprünge, dann stob es in Richtung Westen davon. Wieder peitschten die Gewehre. Das Pferd brach zusammen. Im letzten Moment konnte der Bandit die Steigbügel abschütteln, dann rollte er sich über die Schulter ab und kam sofort hoch. Sein Pferd lag am Boden, keilte aus und hatte den Kopf gehoben. Ein gequältes Wiehern erhob sich. Sheppard riss das Gewehr an die Hüfte und schoss auf die heranstiebenden Verfolger. Er fegte einen Sattel leer, dann schaute er sich nach seinen Kumpanen um. John Russell hatte angehalten und schoss ebenfalls auf die Reiter des Aufgebots. Sie drehten ab.
Russell trieb sein Pferd an. Die beiden Pferde, die er führte, wurden mitgerissen. Im hämmernden Galopp näherte er sich Sheppard, erreichte ihn und der Bandit warf sich auf eines der ledigen Pferde. Dann stoben sie hinter Chuck Webster her, der schon zwischen die Hügel ritt. Einige Meilen jagten sie die Pferde erbarmungslos nach Norden. Schaum tropfte von den Nüstern der Tiere. Sie röchelten und röhrten. Ihre Flanken zitterten, das Fell war nass vom Schweiß.
Webster ließ sich aus dem Sattel gleiten und ging sofort zu Boden. Er war bleich, seine Lippen zuckten, seine Augen waren blutunterlaufen. Er stöhnte und presste die linke Hand auf die Schulter. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hindurch.
Sheppard und Russell sprangen ebenfalls von den Pferden. Während sich Russell über Webster beugte, rannte Sheppard einen Hügel hinauf und hielt in Richtung Süden Ausschau. Dort zeigte sich niemand. Scheinbar hatte das Aufgebot aus Channing aufgegeben.
Russell half Webster Weste und Hemd auszuziehen. Die Kugel hatte das Schlüsselbein zerschmettert und war nicht wieder ausgetreten.
»Sieht schlecht aus«, murmelte Russell.
»Wie meinst du das?«, fragte Webster mit schmerzgepresster Stimme.
»Du brauchst einen Arzt. Die Kugel muss raus, und das Schlüsselbein ...« Russell zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich bin kein Doc. Ich weiß nur, dass du es mit dieser Verletzung nicht bis Kansas schaffst.«
»Du musst mich verbinden. Ich blute wie ein abgestochenes Schwein.«
Russell richtete sich auf, ging zu dem Pferd, das er in Channing gestohlen hatte, durchsuchte die Satteltaschen und fand tatsächlich Verbandszeug. Während er Webster den Verband anlegte, sagte er: »Wenn sich Wundbrand hinzuzieht, stirbst du, Chuck. Ich kann dir die Kugel nicht herausholen. Und Amos kann das auch nicht. Du musst versuchen, nach Hartley zu kommen. Dort gibt es sicher einen Arzt.«
»Nach Hartley besteht eine Telegrafenverbindung. Man hat von Channing aus sicher bereits durchgegeben, dass wir auf dem Weg nach Norden sind. Wenn ich nach Hartley reite, schnappen sie mich. Außerdem ...«
»Was?«
»Mir gehört ein Anteil an dem Gold.«
Russell verzog das Gesicht. »Was hast du von dem Anteil, wenn du stirbst?«
»Verdammt, ihr wollt mich betrügen. Da mache ich nicht mit. Ihr kommt mit mir nach Hartley. Ich lass mir die Kugel rausholen, und dann reiten wir weiter.«
»Hören wir, was Amos dazu meint.«
Amos Sheppard kam hangabwärts. »Sie haben wohl aufgegeben«, erklärte er, als er heran war. »Wo hat es dich erwischt, Chuck?«
»Die Schulter.«
»Er braucht einen Arzt, der ihm die Kugel herausholt. Außerdem ist sein Schlüsselbein zerschmettert. Ohne ärztliche Hilfe zieht sich Wundbrand hinzu, und dann stirbt er. Die nächste Stadt ist Hartley. Ich habe Chuck empfohlen, dorthin zu reiten.«
»Und?«
»Er denkt, dass wir ihn um seinen Anteil betrügen wollen.«
»Channing und Hartley sind per Telegraf miteinander verbunden«, murmelte Sheppard nachdenklich. »Ich weiß nicht, ob es in Hartley ein Gesetz gibt. Das ist aber anzunehmen. Der Marshal oder Sheriff dort oben ist sicher schon alarmiert.«
»Was heißt das?«, fragte Chuck Webster.
John Russell drehte eine Zigarette, zündete sie an und gab sie Webster. Tief inhalierte der verwundete Bandit den ersten Zug.
»Das heißt, dass wir nicht nach Hartley können«, versetzte Sheppard.
»Dann soll ich also verrecken!«, schnappte Webster.
»Du verlangst doch nicht, dass wir deinetwegen unsere Hälse riskieren?«, kam es kalt von Sheppard. »Wir können aber auch keine Rücksicht auf dich nehmen, Chuck. Reite nach Hartley und geh dort zum Arzt. Wir warten in Dodge City auf dich.«
»Ihr seid zwei niederträchtige Hurensöhne!«, erregte sich Webster.
»Indem du uns beleidigst machst du es sicher nicht besser«, knurrte John Russell.
»Dodge City«, sagte Sheppard, dann ging er zu seinem Pferd und schwang sich in den Sattel. Er übernahm die Pferde, die Webster geführt hatte.
Russell zuckte mit den Schultern. »Ich kann dir nicht helfen, Chuck«, murmelte er fast bedauernd. »Aber in diesem Fall muss jeder sehen, wo er bleibt. Es geht um Kopf und Kragen.«
Webster knirschte mit den Zähnen. »Die Pest an eure Hälse!«
*
Um die Mitte des Nachmittags erreichten wir Channing. Im Hof des Mietstalls saßen wir ab. Im Tor zeigte sich der Stallmann. Wir führten unsere Pferde am Kopfgeschirr in den Stall. Es roch nach Heu und Stroh und Pferdeausdünstung. »Wenn ihr auf der Fährte der drei Banditen reitet, so kommt ihr um gute acht Stunden zu spät. Die Kerle haben ganz schön für Furore gesorgt. Unser Marshal ist mehr tot als lebendig. Und einige andere Burschen haben auch ganz schön Federn gelassen.«
»Erzählen Sie«, forderte ich den Mann auf.
Er kratzte sich am Hals. Dann begann er: »Gestern Abend kam einer der Kerle in die Stadt. Er erzählte dem Marshal, dass er zum Eisenbahncamp wollte. Dann aber kaufte er im Store einen Sack voll Proviant und Dexter stellte ihn zur Rede.«
»Dexter?«
»Das ist der Town Marshal. Also, er fragte den Kerl, wozu er den Proviant brauche, wenn er nur noch wenige Stunden bis zum Camp zu reiten habe. Der Rotschopf konnte dem Marshal keine befriedigende Antwort geben. Von Reitern der Hackknife wussten wir, dass sie drei Kerle jagten, die in Tascosa ziemlich auf den Putz hauten und die Mannschaft der Hackknife brutal dezimierten. Dexter zog den richtigen Schluss und ritt in aller Frühe mit einem Aufgebot los ...«
Der Stallmann sprach noch eine ganze Weile. Er schloss mit den Worten: »Ein höllisches Trio, wenn ihr mich fragt. Und jetzt, wo sie wahrscheinlich mit Verfolgung rechnen, sind sie doppelt wachsam und gefährlich.«
Wir zogen unsere Gewehre aus den Scabbards und gingen zum Saloon. Während wir am Rand der staubigen Fahrbahn dahinschritten, sagte Joe: »Ob sie Hartley anreiten?«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie wissen, dass nach Hartley und hinauf nach Dalhart die Telegrafenleitung steht. Das wagen sie nicht. Darum haben sie sich hier auch mit Proviant versorgt. Sie wollen ins Niemandsland und hinauf nach Kansas.«
Wir gingen in den Saloon. Es dauerte etwa zwanzig Minuten, dann kam das Essen, das wir bestellt hatten. Durch das große Frontfenster sah ich die Main Street. Vier Reiter zogen in mein Blickfeld. Ich presste die Lippen zusammen. Es waren Delaney und seine drei Begleiter, denen ich am Canadian empfohlen hatte, umzukehren.
Sie parierten vor dem Saloon ihre Pferde und saßen ab. Wenig später kamen sie in den Schankraum. Als sie uns sitzen sahen, verkniffen sich ihre Mienen. Sie gingen zu einem freien Tisch und setzten sich. Joe und ich wechselten einen vielsagenden Blick.
Die vier Kerle bestellten sich Bier und ebenfalls etwas zu essen, und dann erhob sich Delaney und ging zum Schanktisch. Er sprach leise auf den Keeper ein. Was er sprach, konnten wir nicht verstehen. Ich vermutete aber, dass er sich nach Sheppard und dessen Kumpanen erkundigte. Der Keeper antwortete, und er sprach ziemlich lange. Dann kehrte Delaney an seinen Tisch zurück und berichtete flüsternd.
Ich erhob mich und ging zu ihrem Tisch hin. »Ihr wisst sicher Bescheid. Jetzt dürfte auch euch klar geworden sein, dass Sheppard und seine Kumpane um sich beißen wie tollwütige Hunde. Weil das so ist, solltet ihr darüber nachdenken, ob es sich lohnt, ihnen weiterhin zu folgen.«
»Sie können uns nicht davon abbringen, Marshal«, erwiderte Delaney. »Sobald Sheppard und seine Leute Texas verlassen, zählt Ihr Stern nicht mehr. Uns aber interessieren Grenzen nicht. Ich werde die Kerle zur Rechenschaft ziehen, ich werde ihnen eine höllische Rechnung präsentieren.«
»Und was treibt euch?« Nacheinander musterte ich die drei Begleiter von Delaney.
Sie schwiegen.
»Es ist das Gold«, gab ich mir selbst die Antwort. »Ihr habt doch sicher Familien in Tascosa.«
Einer erwiderte: »Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Mit dem, was ich verdiene, kommen wir gerade so über die Runden. Wenn uns die Regierung eine Wiederbeschaffungsprämie für das Gold zahlt, kann ich uns ein Stück Land kaufen und Getreide anbauen.«
»Ihr werdet heißes Blei kassieren«, murmelte ich und heftete meinen Blick auf Delaney. Er hatte die Mundwinkel leicht nach unten gezogen und hielt meinem Blick stand. Er wollte das Gold, davon war ich überzeugt. Dass er seine Brüder rächen wollte, mochte ein Grund sein, der ihn den drei Banditen folgen ließ. Primär aber ging es ihm um das Gold. Dieser Bursche war selbst ein Bandit. Und wieder fragte ich mich, ob es sich bei ihm tatsächlich um Lance Delaney handelte.
Sein Blick drückte Spott aus. Was mochte hinter seiner Stirn vorgehen? Delaney gefiel mir nicht. Er trieb ein falsches Spiel mit den drei Männern aus Tascosa. Dies wurde mir in diesen Momenten klar.
»Man muss im Leben etwas wagen«, sagte ein anderer der Männer aus Tascosa. »Auch ich habe Familie. Für sie mache ich es. Ich kann uns mit einem Schlag zu einem Leben ohne finanzielle Sorgen verhelfen. Ich bin von dem, was ich tue, überzeugt. Und für seine Überzeugungen muss ein Mann Risiken eingehen, wenn nicht, taugen entweder seine Überzeugungen oder er selbst nichts.«
»Sie suchen nach einer Rechtfertigung«, versetzte ich. »Sie möchten dem Ganzen einen Sinn verleihen und sich damit beruhigen.«
»Den Sinn habe ich Ihnen klarzumachen versucht, Marshal.«
»Ich kann Sie nicht zwingen, von Ihrem verrückten Entschluss abzulassen.« Nach dem letzten Wort machte ich kehrt und ging zu unserem Tisch zurück. Wir tranken aus, dann verließen wir den Saloon, holten unsere Pferde aus dem Mietstall und verließen Channing. Eine halbe Meile hinter der Stadt kamen wir an die Weggabelung, an der die Hinweisschilder an den Pfahl genagelt waren. Pferdespuren führten auf das Grasland. Ich war mir sicher, dass hier die Banditen die Straße verlassen hatten und äußerte gegenüber Joe meine Vermutung.
Joe schaute skeptisch. »Vielleicht sollten wir uns trennen«, meinte er. »Während einer von uns nach Hartley reitet, um dort nachzusehen, folgt der andere der Spur.«
»Und wo treffen wir uns wieder?«, fragte ich.
»Oben, in Stratford.«
»In Ordnung«, sagte ich. »Reitest du nach Hartley?«
Joe nickte.
Wir trennten uns. Während Joe auf der Straße blieb, die nach Norden führte, ritt ich auf der Fährte, die sich deutlich im kniehohen Gras abzeichnete, in die Ödnis. Ich bewegte mich zwischen den Hügeln, stieß auf einen Platz, an dem das Gras von vielen Hufen niedergetrampelt war, und folgte dann der Fährte, die weiter nach Norden führte. Dann ritt ich in eine Ebene hinein. Schon bald stieß ich auf ein totes Pferd. Die Spur führte weiter nach Norden. Ich ritt auf ihr und fand nach einigen Meilen die Stelle, an der das Gras niedergetreten war. Da lag auch ziemlich frischer Pferdedung. Hier trennten sich die Spuren. Einige Pferde waren nach Norden gezogen, ein Reiter hatte sich nach Nordwesten gewandt. In dieser Richtung lag Hartley. Was zog den Reiter in die Stadt? Warum hatten sich die Banditen getrennt.
Ich saß ab und untersuchte den Platz, an dem das Gras niedergetreten war, genau. Und ich fand eine Zigarettenkippe, an der Blut klebte. Jemand, dessen Finger voll Blut waren, hatte diese Zigarette geraucht. War einer der Banditen verwundet und hatte er sich auf den Weg nach Hartley gemacht, um ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Joe war unterwegs nach Hartley und würde es herausfinden.
Ich ritt weiter.
*
Es war finster, als Joe in Hartley ankam. Aus vielen Fenstern fiel gelbes Licht. Niemand zeigte sich auf der Straße. Vor dem Saloon standen einige Pferde am Holm. Joe sah über einer Tür ein Schild mit der Aufschrift Marshal‘s Office und ritt auf das Gebäude zu. Das Fenster neben der Tür war erleuchtet, von innen waren die Vorhänge zugezogen. Joe saß am Holm ab, schlang lose den Zügel um den Querbalken, dann klopfte er gegen die Tür. Ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten, öffnete er. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und reinigte seinen Revolver. An seiner Weste funkelte ein Stern. Er legte den Revolver zur Seite und fixierte Joe fragend.
Joe stellte sich vor und erklärte, dass er als Marshal für das Distriktgericht in Amarillo ritt, dann sagte er: »Mein Gefährte und ich reiten auf der Spur von drei Verbrechern, die am Canadian vier Männer erschossen haben und auf deren Konto sonst noch eine Reihe von Verbrechen gehen. Anführer des Rudels ist ein Bursche namens Amos Sheppard. Er wird bereits steckbrieflich gesucht.«
Der Stadtmarshal nickte, wies auf einen Stuhl, der vor seinem Schreibtisch stand, und forderte Joe auf, Platz zu nehmen. Dann sagte er: »Man hat mich telegrafisch auf die drei Banditen aufmerksam gemacht. Sie sollen einige ledige Pferde mit sich führen.« Der Marshal zuckte mit den Schultern: »Ein Mann kam heute in Hartley an. Er war verwundet. Er nennt sich Mel Jackson und bestreitet, etwas mit der Bande zu tun zu haben.«
»Wie erklärt er seine Verletzung?«
»Er sei von drei Banditen überfallen worden. Ich kann ihm das Gegenteil nicht beweisen. Ein Steckbrief existiert von dem Hombre nicht. Eine Beschreibung der drei erhielten wir nicht aus Channing. Das einzige, was man uns sagen konnte, ist, dass einer der Kerle rote Haare hat.«
»Wo befindet sich der Mann?«, fragte Joe.
»Der Doc hat ihn verarztet und ihm einige Tage der Ruhe verordnet. Er hat sich im Hotel ein Zimmer gemietet. Jetzt dürften Sie ihn allerdings im Saloon antreffen. Denken Sie, dass es sich bei dem Burschen um einen der Banditen handelt?«
»Ich weiß es nicht«, versetzte Joe. »Ich habe eine Beschreibung von den Banditen. Wobei von Sheppard ein Steckbrief existiert. Richtig ist auch, dass einer der Kerle rote Haare hat. Sein Name ist John Russell. Es kann sich bei dem Verwundeten nur um Chuck Webster handeln. Dunkelhaarig, etwa sechs Fuß groß, schlank und bärtig.«
Der Town Marshal nickte. »Ja, das könnte er sein.«
»Ich gehe in den Saloon«, sagte Joe.
»Ich komme mit«, erklärte der Town Marshal, ging zum Gewehrschrank und nahm eine doppelläufige Schrotflinte heraus. Er überprüfte die Ladung, indem er die Läufe abknickte, dann schloss er sie wieder und sagte: »Gehen wir.«
Nebeneinander überschritten sie die Straße. In irgendeinem der Häuser war die laute Stimme eines Mannes zu hören. Ein Kind weinte. Eine Tür schlug. Ein Hund begann zu bellen. Sie erreichten den Saloon. Verworrener Lärm drang auf die Straße. Auf den Vorbau führten vier Stufen. Der Town Marshal ging voraus. Er stieß mit beiden Händen die Pendeltür auf. Hinter ihm betrat Joe Hawk den Schankraum. Die beiden gingen zum Tresen. Fast alle Tische waren besetzt. Die Gespräche verstummten. Joe sah am Stirnende des Schanktisches einen Mann stehen, der den rechten Arm in einer Schlinge trug. Er war ungefähr sechs Fuß groß, dunkelhaarig und schlank, und er hatte einen Bart.
Der Bursche starrte Joe und den Marshal an. Er hatte die Schultern etwas angehoben. Irgendwie mutete er sprungbereit an. Sein Gesicht drückte jähe Unrast aus. Joe ging zu ihm hin. Er sah, dass das Holster des Burschen leer war. Der Colt steckte im Hosenbund, sodass ihn der Mann mit der linken Hand greifen konnte.
»Hallo, Webster!«, sagte Joe.
»Mein Name ist Jackson – Mel Jackson«, sagte der Bursche.
»Ich denke, dass du Chuck Webster heißt«, antwortete Joe gelassen. »Aber das ist kein Problem. Ich nehme dich vorläufig fest, und wir werden jemand aus Tascosa herholen, der dich kennt. Und dann ...«
Der Mann, der sich in Hartley als Mel Jackson ausgegeben hatte, griff nach dem Revolver. Es war Chuck Webster. Er war bereit, sich den Weg freizuschießen.
Aber Joe war schneller. Der Marshal zog nicht den Colt. Blitzschnell trat er einen Schritt nach vorn, seine Linke schoss vor, sie erwischte das Handgelenk des Banditen, und ehe dessen Hand den Knauf des Revolvers umklammern konnte, drehte ihm Joe den Arm herum. Webster schrie auf. Joe zog ihm den Revolver aus dem Hosenbund und versetzte ihm einen Stoß, der ihn gegen den Schanktisch trieb. Webster wirbelte herum. Joe richtete seinen eigenen Revolver auf ihn und spannte den Hahn.
Jetzt trat der Town Marshal in Aktion. Mit angeschlagener Schrotflinte näherte er sich dem Banditen von der Seite. »Pech gehabt, Webster.«
Der Bandit hob die Hände in Schulterhöhe und knirschte mit den Zähnen.
»Was ist das Ziel deiner beiden Kumpels?«, fragte Joe.
»Das geht dich einen Dreck an, Sternschlepper!«
»Ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes, Webster«, sagte der Town Marshal. »Sie gehen jetzt vor mir her zum Gefängnis. In den nächsten Tagen werden wir Sie nach Amarillo zum Distriktgericht bringen. Vorwärts!«
Der Marshal winkte mit der Shotgun.
Der Bandit setzte sich in Bewegung. Der Town Marshal folgte ihm, Joe schloss sich an. Er hatte die Hand mit dem Revolver gesenkt, der Arm baumelte schlaff nach unten, die Mündung der Waffe wies auf den Boden.
Fünf Minuten später befand sich Webster hinter Schloss und Riegel. Er ging zu einer der Pritschen und setzte sich. Joe stand an der Gitterwand. »Noch einmal Webster: Wohin wollen Sheppard und Russell?«
Der Bandit starrte vor sich hin. Plötzlich sagte er: »Die beiden wollen nach Dodge City. Sie haben mich schmählich im Stich gelassen, und es ist wohl so, dass sie mich um meinen Anteil an dem Gold betrügen wollen. Es sind elende Bastarde.«
Mehr wollte Joe nicht wissen. Er und der Marshal verließen den Zellentrakt. »Ich habe mich mit meinem Kollegen Logan oben in Stratford verabredet. Nun kennen wir das Ziel der Banditen. Wir werden uns bemühen, vor den Kerlen in Dodge zu sein.«
»Sie wissen wohl nicht, dass Ihr Stern dort oben nichts wert ist?«, fragte der Town Marshal.
»Den werden wir in die Tasche stecken«, versetzte Joe grinsend.
Der Town Marshal grinste ebenfalls. »Grenzen interessieren euch U.S. Marshals wohl nicht, wie?«
Darauf gab Joe keine Antwort. Er verabschiedete sich von dem Town Marshal, dann suchte er das Hotel auf, um sich für die Nacht ein Zimmer zu mieten.
*
Zwei Tage, nachdem sie dem Aufgebot aus Channing entkommen waren, erreichten die beiden Banditen den Coldwater Creek. Das Pferd, das John Russell ritt, lahmte. Es hatte ein Eisen verloren, ein zweites saß nur noch locker am Huf.
»Erschieß den Gaul und nimm eines der Reservepferde«, schlug Amos Sheppard vor.
»Das Tier ist hundert Dollar wert«, versetzte Russell.
»Wir haben zehn Packtaschen voller Gold. Machst du dir da wegen hundert Dollar noch Gedanken?«
»Reiten wir ein Stück am Fluss entlang«, knurrte Russell. »Vielleicht stoßen wir auf eine Ranch oder Farm, oder eine Ansiedlung.«
»Meinetwegen«, brummte Sheppard wenig begeistert. Und wie im Selbstgespräch fügte er hinzu: »Wir werden Zeit verlieren – Zeit, die wir vielleicht brauchen.«
»Durch die Wildnis haben wir sicher jeden Verfolger abgeschüttelt«, gab Russell zu verstehen.
Sie folgten dem Coldwater Creek nach Osten. Irgendwann stießen sie auf Rinder. Sie trugen das M-im-Kreis-Brandzeichen. Wo die Ranch lag, wussten die beiden Banditen nicht. Und dann verhielten sie an einem Stacheldrahtzaun. Hier begann Farmland. Jenseits des Zauns dehnte sich ein riesiges Weizenfeld. Der Zaun reichte bis zum Flussufer. Auf dem schmalen Uferstreifen umritten ihn die beiden Banditen. Dann zogen sie weiter am Fluss entlang. Die Sonne ging unter. Das letzte Licht der Sonne fiel durch die Kronen der hohen Bäume auf den Fluss und färbte das Wasser bronzen. Der Himmel über den Bergen im Westen brannte hellrot; Wolkenbänke schoben sich davor und glühten. Aus den Tiefen der Bergtäler zogen die ersten Dunstschwaden empor, krochen die Hänge hinauf und hüllten Bäume, Felsen und Sträucher ein.
Und dann lagen die Gebäude einer Farm vor den beiden Banditen. In einem Pferch standen einige Ziegen und Schafe. Auf einer Koppel graste eine Milchkuh. Hühner liefen frei im Hof herum und pickten in dem Staub. Ein schwarzer Hund schoss aus seiner Hütte und bellte. Die Kette, die ihn hielt, rasselte.
Alles wirkte grau in grau.
Im Farmhaus hatte Brad Foster am Fenster Stellung bezogen und äugte nach draußen. Hinter ihm stand seine Frau und versuchte über seine Schulter zu blicken. Ein Halbwüchsiger saß am Tisch. Auf dem Stubenboden spielten zwei Kinder von etwa acht Jahren mit Holzklötzen, die ihnen ihr Vater zurechtgesägt hatte. An der Wand hing ein Regulator; das Messingpendel schlug rhythmisch hin und her, die Uhr tickte leise.
Die Abenddämmerung hüllte die Gesichter der beiden Ankömmlinge ein. Draußen bellte der Hund wie von Sinnen. Brad Foster, der Farmer, wandte sich um. »Ich gehe hinaus. Bleibt im Haus.«
Er nahm sein Gewehr, das an der Wand über der Tür auf zwei langen Nägeln lag, lud es durch und ging hinaus. »Still, Rex!« Sein Befehl kam schroff und der Hund hörte zu bellen auf. Nur noch ein gefährliches Grollen stieg aus der Kehle des Tieres.
Die Hufe der sechs Pferde pochten leise und rissen kleine Staubfontänen in die Abendluft. Brad Foster hatte sich den Kolben des Gewehres unter die Achsel geklemmt, die Mündung der Waffe wies schräg auf den Boden. Er hatte keine Ahnung, was es für Kerle waren, die sich seiner Farm näherten. Es konnte sich um zwei harmlose Pilger handeln, ebenso gut aber um zwei Sattelstrolche, die ohne zu fragen nahmen, was sich ihnen bot.
Die beiden waren bärtig. Foster entging nicht, dass sie Revolvergurte umgeschnallt hatten. Sie sahen abgerissen und mitgenommen aus. Die Gesichter lagen im Schatten der Hutkrempen. Sie lenkten ihre Pferde in den Hof und verhielten zwei Pferdelängen vor dem Farmer.
»Hallo, Farm«, grüßte Amos Sheppard und tippte gegen die Krempe seines Hutes. »Wir sind auf dem Ritt nach Norden. Das Pferd meines Gefährten hat ein Eisen verloren, ein weiteres sitzt locker. Können Sie uns helfen?«
»Ich habe ein paar Eisen vorrätig, weiß natürlich nicht, ob sie passen. – Sie möchten nach Norden? Wissen Sie denn nicht, dass sich dort oben Cheyenne und Comanchen tummeln? Es ist gefährlich, das Niemandsland zu durchqueren.«
»Wir fürchten die roten Hombres nicht«, versetzte Sheppard. »Außerdem ist fraglich, ob sie überhaupt merken, dass zwei Weiße durch ihr Gebiet reiten.«
»Nun, Sie müssen selbst wissen, was Sie tun. Wenn Sie wollen, können Sie die Nacht über hier bleiben. Allerdings müssen Sie in der Scheune im Heu schlafen. Morgen Früh könnte ich dann das Pferd beschlagen.«
»Gute Idee«, murmelte Sheppard. »Wir sahen Rinder mit dem M-im-Kreis Brand. Befindet sich die Ranch in der Nähe?«
»Sie liegt am Mustang Creek, südwestlich von hier. Die Ranch ist fünfzehn Meilen entfernt. Sie gehört zur Panhandle Cattle Company und ist eine Unterranch der Bar-H.«
»Gibt es in der Nähe eine Stadt?«
»Sieben Meilen weiter östlich liegt Stratford. Dort gibt es einen Schmied. Falls Sie ...«
Sheppard winkte ab. »Wir nehmen Ihr Angebot an.« Der Bandit hob das rechte Bein über das Sattelhorn und ließ sich vom Pferd gleiten. Russell folgte seinem Beispiel. »Sie leben doch sicher nicht alleine hier?«, fragt der rothaarige Bandit lauernd.
»Nein. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Haben Sie Hunger?«
»Ein vernünftiges Abendessen könnte nicht schaden«, meinte Sheppard grinsend.
»Mary«, rief Foster über die Schulter, »bereite den beiden Gentlemen ein Abendessen. Sie bleiben die Nacht über hier.«
Sheppard und Russell führten ihre Pferde zu einem Holm und banden sie an. Dann wandten sie sich dem Farmer zu. »Kommen Sie ins Haus«, forderte Foster die beiden Banditen auf, einzutreten. Er trat in die Küche, Sheppard und Russel folgten ihm. Bei einer Anrichte stand Mary Foster. Sie war fünfunddreißig Jahre alt und dunkelhaarig. Es war düster im Raum. Foster zündete eine Laterne an. Helligkeit kroch auseinander, das Licht legte dunkle Schatten in die Gesichter. Die beiden Kinder, die am Boden spielten, hatten sich erhoben und drängten sich an ihren großen Bruder, dessen Hände auf den Schultern der beiden lagen. Scheu musterten sie die Ankömmlinge.
»Guten Abend, Ma‘am«, grüßte Sheppard. »Ihr Mann hat uns zum Essen eingeladen. Ich hoffe, wir bereiten Ihnen keine Umstände.«
Die Frau lächelte. »Etwas Warmes kann ich Ihnen leider nicht anbieten, denn wir haben bereits gegessen. Aber wir haben Schinken und frisches Brot.«
»Das ist in Ordnung, Ma‘am«, erwiderte Sheppard und setzte sich an den Tisch. Er warf seinem Gefährten einen schnellen Blick zu und ihm blieb der habgierige Blick nicht verborgen, mit dem Russell die Frau anstarrte.
»Ich kümmere mich um Ihre Pferde«, sagte Foster.
Auch Russell setzte sich.
Mary Foster begab sich in einen angrenzenden Raum. Joel Foster, der Halbwüchsige, folgte seinem Vater nach draußen. Die beiden Kleinen hatten nur Augen für die Fremden.
Die Frau kam zurück und trug einen Schinken. Auf der Anrichte schnitt sie einige dicke Scheiben ab, dann holte sie einen Laib Brot aus einem Schub und schnitt es ebenfalls. Sie verteilte den Schinken und das Brot auf zwei Teller und trug sie zum Tisch, stellte sie vor die beiden Banditen hin und wünschte ihnen guten Appetit.
»Sie leben recht einsam hier draußen«, begann Sheppard ein Gespräch mit der Frau.
Sie zuckte mit den Schultern. »Wir haben uns für dieses Leben entschieden, und es gefällt uns. Die Farm wirft genug ab, sodass wir unser Auskommen haben. Es gibt zwar eine Menge Arbeit, aber das wussten wir, als wir hierher zogen. Wir sind zufrieden.«
»Und Sie wünschen sich nicht mal etwas Abwechslung?«
Mary Foster lachte. »Wir fahren jeden Sonntag nach Stratford zur Messe. Dort treffe ich mich mit anderen Frauen. Das ist Abwechslung genug.«
»Das ist doch kein Leben«, murmelte John Russell.
Sheppard erhob sich. »Ich sehe draußen mal nach dem Rechten.«
Russell verstand und nickte.
»Wollen Sie nicht erst essen?«, fragte die Frau. Sie spürte plötzlich Beklemmung. Worauf sich dieses Gefühl bezog, wusste sie nicht zu sagen. Es entzog sich ihrem Verstand. Aber es war da und ließ sich nicht vertreiben.
»Wir haben nämlich etwas bei uns, was die Habgier deines Mannes wecken könnte«, knurrte Sheppard, rückte das Holster an seinem rechten Oberschenkel zurecht und ging noch etwas sattelsteif nach draußen.
Etwas schnürte den Hals der Frau zusammen. Sie hatte plötzlich Angst. Sie schaute Russell an und ihr entging nicht der stechende Blick, mit dem er sie anstarrte. Und plötzlich stieß der Bandit hervor: »Kaum zu glauben, dass du nicht etwas mehr Abwechslung wünscht. Eine Frau wie du ... Hast du nicht mal Lust auf einen richtigen Mann?«
Er grinste schmierig.
Mit erschreckender Schärfe wurde der Frau klar, dass Unheil und Verderben auf der Farm Einzug gehalten hatten. Eine unsichtbare Hand schien sie zu würgen.
Draußen schritt Amos Sheppard zu den Pferden hin. Joel Foster hatte sich eine der schweren Satteltaschen über die Schulter gehängt und trug sie zur Scheune, aus der soeben Brad Foster trat. Sie hatten den fünf Pferden die Sättel abgenommen. Die Sättel lagen auf dem Boden.
Foster winkte Sheppard. »Kommen Sie, ich will Ihnen zeigen, wo Sie schlafen können.«
Der Junge verschwand in der Scheune. Der Farmer holte zwei der Sättel und wollte sie zur Scheune tragen. Sheppard trat vor ihn hin. »Du hast sicher herausgefunden, was sich in den Satteltaschen befindet.«
Der Farmer spürte das Unheil plötzlich tief in der Seele. Sein Blick irrte ab. »Sie sind verdammt schwer. Aber ich habe nicht nachgesehen. Es – es geht mich nichts an. Ich stöbere nicht im Gepäck anderer Leute.«
»Du lügst!«, peitschte Sheppards Stimme.
Mit hängenden Schultern stand der Farmer da, in jeder Hand einen Sattel. Die Gefahr, die von dem Banditen ausging, prallte geradezu gegen ihn. »Bitte, Mister, Sie – Sie haben nichts zu befürchten. Ich werde morgen das Pferd beschlagen und dann ...«
»... reitest du nach Stratford, um dort zu melden, dass zwei Kerle mit Gold im Wert von mindestens zweihunderttausend Dollar auf dem Weg nach Norden sind. Gibt es in Stratford einen Telegrafen?«
»Nein, die Telegrafenverbindung wurde entlang der Bahnlinie errichtet und führt über Dalhart hinauf nach Kerrick.«
»Jetzt ist dir sicher auch klar, weshalb wir ins Indianerland wollen«, knurrte Sheppard und zog den Revolver. Foster wechselte die Farbe, als der Bandit die Waffe auf ihn anschlug. »Dein Pech«, murmelte Sheppard, »dass es gerade deine Farm war, die auf unserem Weg lag.« Mit dem letzten Wort feuerte er. Foster brach zusammen. Aus der Scheune kam Joel gelaufen. Er sah seinen Vater am Boden liegen und den Revolver in der Faust des Banditen. Aus der Mündung kräuselte ein dünner Rauchfaden.
»Dad!« Der Schrei löste sich aus der Kehle des Jungen. Er rannte zu seinem Vater hin und warf sich bei ihm auf die Knie nieder. »Dad ...« Joels Stimme brach.
Wieder dröhnte der Revolver. Der Halbwüchsige kippte über seinen Vater.
Im Haus wollte Mary zur Tür laufen. Russell vertrat ihr den Weg und packte sie mit beiden Händen an den Oberarmen. »Deinem Mann und deinem Sohn kannst du nicht mehr helfen, Lady«, hechelte er. »Und nun zu dir. Ich denke, du wirst mir und meinem Freund ein paar angenehme Stunden bereiten.«
Die beiden Kinder begriffen, dass etwas nicht mehr stimmte, und eines begann zu weinen. Draußen bellte der Hund. Ein weiterer Schuss krachte. Abrupt brach das Bellen ab. Das zweite Kind stimmte in das Weinen des anderen ein. Zur Angst der Frau gesellte sich das Entsetzen. Schritte waren zu hören, Sporen klirrten leise, dann kam Sheppard in die Küche.
Er mutete die Frau an wie der Teufel in Menschengestalt.
*
Ich erreichte Stratford. Die kleine Stadt am Coldwater Creek vermittelte Ruhe und Frieden. Licht fiel aus den Fenstern und streute auf die Vorbauten und Gehsteige. Aus dem Saloon wehte Klaviermusik. Ahnungslos, ob Joe schon angekommen war, ritt ich zum Mietstall. Es handelte sich um einen zugigen Bretterverschlag. Das große Tor stand halb offen und hing schräg in den verrosteten Angeln. Wahrscheinlich ließ es sich gar nicht mehr schließen. Die Kerosinlampe, die mitten im Gang von einem Balken hing, war weit heruntergedreht. Ich warf einen Blick zum Ende des Ganges. Die Tür zur Kammer war geschlossen.
»Hallo, Stall!«, rief ich. Und jetzt wurde die Tür geöffnet. Der Stallmann kam aus seinem Verschlag und schlurfte näher. Ich war schon einige Male in Stratford und so kannte er mich.
»Hi, Marshal«, grüßte er krächzend. »Sie sind alleine unterwegs?«
Das sagte mir, dass Joe noch nicht angekommen war und ich antwortete: »Ich habe mich hier mit meinem Partner verabredet. Er ist nach Hartley geritten.«
»Hinter wem sind Sie denn her?«
»Drei Banditen, die in der Nähe von Tascosa einige Männer brutal ermordet haben. Sie sind auf dem Weg nach Norden.« Ich nahm meine Satteltaschen und das Gewehr. »Nach Stratford sind sie nicht zufällig gekommen?«
»Hier habe ich schon seit fast einer Woche keinen Fremden mehr gesehen, Marshal. In Stratford liegt der Hund begraben. Aber das wissen Sie sicher.«
»Ich bleibe die Nacht über in der Stadt.«
»Ich werde mich um Ihr Pferd kümmern, Marshal.«
Ich ging in den Saloon und aß etwas, dann mietete ich im Hotel ein Zimmer. Da ich müde war, ging ich sofort zu Bett. Als ich wieder erwachte, hing vor dem Fenster das Morgengrau. Ich erhob mich, wusch mir das Gesicht und zog mich an, dann ging ich hinunter in den Frühstücksraum. Der Owner kam durch eine Tür neben der Treppe und sagte: »Gegen Mitternacht ist ihr Kollege Hawk angekommen. Er hat mich gebeten, ihn zu wecken, sobald auch Sie auf den Beinen sind.«
Ich setzte mich und der Mann verschwand. Zehn Minuten später kam Joe und setzte sich zu mir. »Und?«, fragte er.
»Ich habe die Spur verloren«, versetzte ich. »Wie war es bei dir?«
»Chuck Webster sitzt in Hartley hinter Schloss und Riegel. Als das Aufgebot aus Channing die Bande stellte, wurde er verwundet. Er hat sich von seinen Kumpanen getrennt, um in Channing ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Webster hat mir verraten, dass Sheppard und Russell nach Dodge City wollen.«
Draußen war Rumpeln und Poltern zu hören. Ich schaute aus dem Fenster und sah einen leichten Farmwagen, der von einem Pferd gezogen wurde. Auf dem Bock saßen eine Frau und zwei Kinder. Es mutete mich seltsam an, dass die drei schon so früh unterwegs waren. Da kam auch schon der Hotelier und sagte: »Das war Mary Foster mit ihren beiden kleinen Kindern. Die Fosters besitzen eine Farm etwa sieben Meilen westlich der Stadt. Da stimmt was nicht.«
Der Mann lief nach draußen. Ich sah, dass er das Gespann aufhielt. Die Frau bewegte den Mund. Der Hotelier warf sich herum und stürmte wenig später in den Frühstücksraum. »Zwei Banditen haben die Foster Farm überfallen. Brad Foster und sein Sohn Joel sind tot. Die Frau haben sie vergewaltigt. Du lieber Himmel ...«
Ich ruckte hoch. Auch Joes Gestalt wuchs in die Höhe. Schnell gingen wir hinaus. Mit erloschenem Blick schaute mich die Frau an. Ihre Augen waren vom Weinen gerötet und verquollen. Ihre Lippen zitterten. Während ich ihr vom Wagenbock half, hob Joe die beiden Kinder herunter. Wir dirigierten sie ins Hotel. In die Gesichter stand das Grauen geschrieben.
»Erzählen Sie«, forderte ich die Frau auf.
Sie senkte das Gesicht, dann begann sie mit brüchiger Stimme: »Es waren zwei Männer, die vier Pferde mit sich führten. Eines der Tiere hatte ein Eisen verloren. Wir gewährten den beiden Gastfreundschaft. Mein Mann und Joel wollten ihre Pferde versorgen. Einer ging hinaus und – und ...« Die Stimme brach. Ein Schluchzen quälte sich in der Brust der Frau hoch und entrang sich ihr. Sie schlug beide Hände vor das Gesicht. Ihre Schultern zuckten. Auch die beiden Kinder begannen zu weinen.
»Kümmern Sie sich um die Frau und die Kinder«, sagte ich zum Hotelier.
Eine Viertelstunde später ritten wir. Wir ließen die Pferde laufen. Dennoch benötigten wir eine Stunde, bis wir die Farm erreichten. Die Frau hatte ihren Mann und den Jungen in die Scheune geschleppt und dort auf den Boden gelegt.
»Diese elenden Schweine!«, entrang es sich Joe.
Von der Frau wussten wir, dass die Kerle das Pferd mit dem verlorenen Huf zurückgelassen und das Tier des Farmers gestohlen hatten. Ich fand die Spuren, die in den Creek führten. Die Banditen hatten sich von hier aus also nach Norden gewandt. Ihr Vorsprung betrug vielleicht vier Stunden.
Wir hielten uns nicht auf. Ihre Toten wollte die Frau sicher selbst begraben. Ohne zu zögern nahmen wir die Verfolgung auf. Das Wasser des Creeks reichte den Pferden gerade bis zu den Sprunggelenken. Auf der anderen Seite sahen wir deutlich die Spuren in der sandigen Uferbank.
Wir ließen die Pferde traben. Die Fährte zog sich durch das Gras. In der Ferne erhoben sich Hügel. Meile um Meile legten wir zurück. Und dann befanden wir uns im Niemandsland. Von jetzt an war äußerste Vorsicht geboten. Die Indianer hatten es nicht gern, wenn Weiße in den von ihnen beanspruchten Jagdgründen herumritten. Und unseren Skalp wollten wir auf jeden Fall behalten ...
*
Es waren sechs Comanchen, die auf die Fährte der Banditen stießen. Sie schlossen aus den Spuren, dass hier mehrere Reiter unterwegs gewesen waren. Einige Zeit palaverten sie in ihrer Sprache, dann trugen sie Feuerholz zusammen, schürten ein Feuer und warfen grünes Zweigwerk in die Flammen. Mit Hilfe einer zerschlissenen Decke schickten sie Rauchsignale zum Himmel. Der Rauch ballte sich am Himmel und zog träge nach Osten davon.
Die Krieger warfen sich auf die ungesattelten Pferde und folgten der Spur. Sie waren auf der Jagd. Bewaffnet waren sie mit Henrystutzen. Zwei führten Pfeil und Bogen mit sich. Den Blick auf die Spur geheftet ritt einer voraus.
Im Norden erhob sich eine Rauchsäule. Die Signale, die die Comanchen zum Firmament geschickt hatten, wurden beantwortet. Einer der Krieger wies seine Brüder darauf hin. Sie ließen ihre Mustangs laufen.
Nach einer Stunde etwa sahen sie die Reiter. Es waren zwei, die vier Sattelpferde mit sich führten. Die Comanchen zerrten an den Rohlederzügeln und zwangen die Pferde in den Stand. Die beiden Reiter mit den ledigen Pferden im Schlepptau ritten zwischen die Hügel.
Wieder machten die Krieger Feuer und teilten per Rauchzeichen ihren Brüdern im Norden mit, dass es sich um zwei Weiße handelte, die vier Pferde mit sich führten. Wenig später wurden die Rauchsignale beantwortet ...
*
Amos Sheppard hielt sein Pferd an. »Verdammt. Schon wieder Rauchzeichen. Wahrscheinlich werden wir im Norden schon erwartet.«
Seine Hoffnungen, ungesehen das Niemandsland durchqueren zu können, verwehten wie der Rauch der Signale am Himmel.
»Weichen wir nach Westen aus!«, schlug Russell vor. »Zwei – drei Tage, dann sind wir in New Mexiko.«
»Und in anderthalb Tagen können wir in Kansas sein«, versetzte Sheppard. »Darum reiten wir weiter. Notfalls schießen wir uns den Weg nach Norden frei.«
Sie erreichten den North Canadian. Die Pferde mussten schwimmen, um auf die andere Seite zu gelangen. Tropfnass zogen die Banditen weiter. Und dann versperrte ihnen über ein halbes Dutzend Comanchen den Weg zwischen die Hügel. Die Krieger verharrten in einer Reihe auf ihren Pferden. Dunkle Augen starrten den beiden Weißen entgegen. Sheppard und Russell hatten angehalten. Russells Backenknochen traten hart aus seinem Gesicht hervor, so sehr hatte er die Zähne zusammengebissen. »Jetzt ist die Kacke am Dampfen«, murmelte er. »Da kommen wir nicht durch.«
Drei der Comanchen trieben ihre Pferde an. Der Reiter in der Mitte trug drei Federn im Haarknoten an seinem Hinterkopf. In seinem Gürtel steckte ein Tomahawk. Eine Henry Rifle hatte er quer vor sich auf dem Mähnenkamm seines Mustangs liegen. Er hielt sie mit der rechten Hand am Kolbenhals fest. Sein Gesicht war unbewegt.
Sheppard und Russell nahmen ihre Gewehre in die Hände.
»Nicht schießen«, murmelte Sheppard. »Sicher wollen Sie verhandeln.«
Als sich die Nasen ihrer Pferde fast berührten, hielten die Indianer an. »Was wollt ihr in unserem Land?«, fragte der Krieger mit den drei Federn im Haar. Sein Englisch war holprig.
»Wir wollen hinauf nach Kansas«, versetzte Sheppard. »Wenn wir durch euer Gebiet reiten, nehmen wir euch nichts weg.«
»Warum habt ihr so viele Pferde?«
»Sie gehören uns. Warum soll ein Mann nicht mehrere Pferde besitzen?«
»Was ist in den Taschen?«
»Proviant, Kleidung, alles, was man auf einem langen Ritt benötigt.«
»Ich will es sehen.«
Sheppard und Russell wechselten einen schnellen Blick. Dann sagte Sheppard: »Seit wann sind die Krieger der Comanchen neugierig wie alte Squaws? Was sollen wir sonst in den Satteltaschen befördern?«
»Wir wollen zwei von euren Pferden.«
»Die Pferde brauchen wir. Aber du kannst das haben.« Sheppard zog drei Münzrohlinge aus seiner Westentasche, legte sie auf die flache Hand und hielt sie dem Indianer hin. »Das ist pures Gold. Nimm es an Stelle der Pferde. Ihr könnt damit Gewehre und Munition kaufen.«
Der Krieger starrte auf das Gold. »Hast du mehr davon?«
»Den Rest brauchen wir selber. Drei Goldstücke sind besser als der Tod.«
»Gib mir das Gold.« Der Krieger streckte Sheppard die flache Hand hin. Dieser legte das Gold hinein und der Krieger schloss die Hand. »Ich spreche mit meinen Brüdern.«
Die drei ritten zurück zu den anderen Comanchen, der Krieger mit den Federn zeigte die drei Goldstücke, dann begann eine lange Debatte. Plötzlich löste sich ein Reiter aus dem Pulk, jagte sein Pferd einmal um Sheppard und Russell herum, dann zerrte er den Mustang zurück und blaffte: »Wir euch töten!«
Sheppard schoss ihn vom Pferd. Und auch Russells Gewehr peitschte. Ein zweiter Pferderücken wurde leergefegt. Jetzt kam Leben in die Comanchen. Sie trieben ihre Mustangs an und stoben davon, jagten die Hänge zu beiden Seiten hinauf und verschwanden über den Kämmen.
»Zurück!«, knirschte Sheppard und zog sein Pferd um die linke Hand. Sie stoben zum Fluss und ritten hinein. Bald verloren die Pferde den Boden unter den Hufen und schwammen. Da erschienen am anderen Ufer die sechs Krieger, die den Banditen von Süden herauf gefolgt waren.
»Zur Hölle!«, schrie Russell entsetzt und eröffnete das Feuer. Ein Indianer stürzte vom Pferd. Auch Sheppard schoss. Ein zweiter Pferderücken wurde leergefegt. Die anderen Comanchen zerrten ihre Pferde herum und flohen.
Sheppard und Russell ließen sich im Fluss treiben. Nun begannen die Comanchen aus sicherer Deckung zu schießen. Die Banditen warfen sich von den Pferden. Eines der Tiere wurde getroffen und ging unter. Die anderen Pferde versuchten voll Panik das rettende Ufer zu erreichen.
»Ohne Pferde sind wir verloren!«, brüllte Russell und hielt sich verzweifelt über Wasser. Die Strömung hatte ihn erfasst. Nur drei Yards von ihm entfernt schwamm Sheppard. Das Gewehr behinderte diesen. Aber er schaffte es, aus der Strömung zu schwimmen und ruhigeres Wasser zu erreichen. Dann spürte er Boden unter den Füßen und watete ans Ufer.
Russell mühte sich ab, ebenfalls das Ufer zu erreichen. Die Pferde befanden sich bereits auf dem Trockenen. Ein Schuss krachte und eines der Tiere brach zusammen. Die anderen Pferde prusteten erregt, spielten mit den Ohren und witterten. Eines der Tiere warf den Kopf in den Nacken und wieherte.
Gebüsch schützte Sheppard vor den Blicken der Comanchen. Wasser lief aus seiner Kleidung. Seinen Hut hatte er im Fluss verloren. Er beobachtete Russell, dem es jetzt gelang, sich aus der Strömung zu lösen und ans Ufer zu schwimmen. Dann konnte der Bandit stehen und kämpfte sich ans Ufer. Er war etwa hundert Yards von Sheppard entfernt.
Helles, abgehacktes Geschrei erhob sich. Es ließ die Herzen der beiden Weißen erbeben. Geduckt rannte Russell am Ufergebüsch entlang in Sheppards Richtung. Neben ihm warf sich Russell keuchend zu Boden. Ihre Pferde standen ein ganzes Stück weiter am Fluss und witterten mit erhobenen Köpfen.
»Wir müssen versuchen, zu den Pferden zu gelangen und durchzubrechen«, sagte Sheppard zwischen den Zähnen.
»Darauf warten diese roten Bastarde nur«, gab Russell zu verstehen. »O verdammt! Wenn du mich fragst, dann sitzen wir bis zum Hals in der Tinte.«
»Solange ein Funke Leben in uns ist, haben wir eine Chance«, versetzte Sheppard. Er lugte durch das Zweiggespinst und bog es etwas mit der Hand auseinander, um besser sehen zu können. Die Comanchen ließen sich nicht blicken. Es war, als hätte es sie nie gegeben.
»Ich versuche es«, murmelte Sheppard.
Ein zitternder Atemzug entrang sich Russell. »Wir versuchen am Fluss entlang nach Westen zu fliehen. Nimm eines der ledigen Pferde mit. Um das andere kümmere ich mich. Hals- und Beinbruch, Amos.«
Geduckt rannte Amos Sheppard los. Es galt etwa siebzig Yards bis zu den Pferden zurückzulegen. Jeder Yard konnte der letzte sein. Wie von Furien gehetzt rannte der Bandit. Schüsse krachten, aber keine der Kugeln traf ihn. Er erreichte die Pferde, kam mit einem kraftvollen Satz in den Sattel und angelte sich die Zügel. Schüsse peitschten. Aber Sheppard trieb das Tier schon an. Es streckte sich. Sheppard nahm keines der Reservepferde mit. Er wollte nur noch seine Haut retten. Und zwei Satteltaschen voller Gold reichten ihm, um bis ans Ende seiner Tage ein sorgenfreies Leben zu führen.
Es war ein Wettlauf mit dem Tod. Die Hufe des Pferdes schienen kaum den Boden zu berühren. Nervenzermürbendes Geschrei mischte sich in die trommelnden Hufschläge. Zwei Comanchen trieben ihre Pferde hinter einem Hügel hervor und versuchten, Sheppard den Weg abzuschneiden.
Russell sagte sich, dass die Aufmerksamkeit der Comanchen in diesen Augenblicken wohl Sheppard galt und stieß sich ab. Auch er erreichte die Pferde und saß auf. Im Gegensatz zu seinem Kumpan nahm er ein Reservepferd mit. Aber er machte die Rechnung in diesem Fall ohne den Wirt. Mit dem Donnern einer Salve brach das Pferd unter ihm zusammen. Hals über Kopf stürzte Russell zu Boden, überschlug sich, brüllte sein Entsetzen hinaus und blieb benommen liegen. Das Pferd, das er an der Longe geführt hatte, stob davon. Ein Pferd stand noch am Fluss. Russell begann zu kriechen. Sein Atem flog. Die Panik ließ keinen anderen Gedanken mehr zu.
Da traf ihn eine Kugel in die Seite. Er fiel auf das Gesicht.
Währenddessen stoben die beiden Comanchen Sheppard entgegen. Sie schossen, verfehlten aber das Ziel. Der Bandit driftete nach links ab und wollte zwischen die Hügel. Die Comanchen waren bis auf dreißig Yards heran. Sheppard zog den Revolver und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Munition im Wasser nicht unbrauchbar geworden war.
Er zügelte das Pferd, und ehe es zum Stehen kam, sprang er ab. Die beiden Krieger jagten auf ihn zu, die Gewehre wie Keulen schwingend. Ihre Gesichter hatten sich verzerrt. Als sie auf fünfzehn Yards heran waren, riss Sheppard die Hand mit dem Revolver hoch. Der Hammer fiel auf die Bodenplatte der Patrone. Der Colt bäumte sich auf in der Faust des Banditen. Als hätte ihn die Faust des Satans heruntergerissen, stürzte einer der Krieger vom Pferd.
Sheppards Stoßgebet war erhört worden.
Der andere Krieger sprang im vollen Galopp ab und riss den Tomahawk aus dem Gürtel. Schreiend stürmte er auf Sheppard zu. Dieser zielte eiskalt und erschoss den Comanchen. Dann lief er zu seinem Pferd und schwang sich behände in den Sattel. In einem raumgreifenden Galopp sprengte er davon ...
Russell trieb in der Halbwelt der Trance. Er spürte keinen Schmerz, und er fragte sich, ob der Tod schon mit gebieterischer Hand nach ihm griff. Ahnungslos, ob Sheppard die Flucht gelungen war, lag er da und versuchte klar zu denken. Er war verloren. Wie aus weiter Ferne vernahm er das Stampfen von Hufen. Vor seinen Augen begann alles zu verschwimmen. Schwindelgefühl erfasste ihn. Sein Atem ging stoßweise und rasselnd.
Die Comanchen zügelten bei ihm ihre Pferde. Einige von ihnen saßen ab und beugten sich über Russell. Einer rief etwas. Über den Fluss kamen die Krieger, die den beiden Banditen den Weg nach Norden verlegt hatten. Einige der Krieger schlugen dicke Äste von den Sträuchern, verkürzten sie und spitzten sie zu. Diese Pfähle trieben sie mit Steinen in den Boden, daran banden sie Hände und Füße des Verwundeten Banditen fest. Er sollte hier elend an seiner Verletzung oder am Durst zugrunde gehen.
Einer der Indianer holte das Pferd, das am Ufer stand. Den toten Pferden wurden die Satteltaschen abgenommen. Die Indianer schnallten sie auf und sahen das Gold. Überraschte Rufe wurden laut. Sie trugen die Satteltaschen zwischen die Büsche. Auch dem Pferd, das den Kampf überlebt hatte, wurden die Taschen abgenommen.
Dann saßen die Comanchen auf und machten sich an die Verfolgung von Sheppard.
*
Wir erreichten den North Canadian. Eine Menge Spuren von unbeschlagenen Hufen waren im Sand des Ufersaumes zu sehen. Sie kamen von Osten und führten nach Westen. Ich stieg vom Pferd und untersuchte die Spuren. Da war auch die Spur eines beschlagenen Pferdes. Ich teilte Joe meine Beobachtung mit. Dann saß ich wieder auf und wir ritten nach Osten, von wo die Spuren kamen. Und dann sahen wir den Mann neben dem Ufer liegen. Nicht weit von ihm entfernt lagen zwei tote Pferde. Seine Hände und Füße waren an Pflöcke gefesselt, die die Indianer in den Boden gerammt hatten.
Ich sicherte in die Runde. Joe stieg schon vom Pferd und beugte sich über Russell. Ich erkannte keine unmittelbare Gefahr und schwang mich ebenfalls aus dem Sattel. Russell röchelte. Joe schnitt die Fesseln auf. Ich nahm die Wasserflasche vom Sattel, schraubte sie auf, schob meine Linke flach unter den Kopf des Verwundeten, hob ihn etwas an und setzte ihm die Flasche an die rissigen Lippen. Russell begann mechanisch zu schlucken. Wasser rann über sein Kinn. Seine Lider flatterten. Nach und nach klärte sich sein Blick.
Mir war nicht verborgen geblieben, dass Russells linke Seite voll Blut war. Hemd und Weste hatten sich vollgesaugt. Sein eingefallenes Gesicht mit den tief in ihren Höhlen liegenden Augen war bereits vom nahen Tod gezeichnet.
Ich brauchte nicht zu fragen, was geschehen war.
Die Lippen des Verwundeten bewegten sich. Unzusammenhängendes Gestammel drang über sie. Ich ging neben ihm auf das linke Knie nieder. »Gold – Büsche – Indianer ...« Ich hatte Mühe, die drei Worte zu verstehen, erfasste aber ihren Sinn, erhob mich und drang in das dichte Buschwerk ein. Und ich stieß auf die Satteltaschen, die die Comanchen auf einen Haufen geworfen hatten. Ich öffnete eine der Taschen und sah, dass sie voller Gold war. Nachdem ich sie wieder geschlossen hatte, kehrte ich zu Joe zurück. »Vier Satteltaschenpaare voll Gold«, sagte ich. »Wir werden sie irgendwo vergraben und später abholen. Sheppard scheint die Flucht geglückt zu sein.«
»Das ist fraglich«, versetzte Joe. »Aber wir werden den Spuren folgen und es sehen.« Er deutete auf Russell. »Wir können ihn nicht einfach sich selber überlassen. Versuchen wir, ihn nach Stratford zu bringen?«
»Wir bauen eine Schleppbahre«, versetzte ich. »Einer von uns bringt ihn in die Stadt. Der andere folgt der Spur.«
Joe presste die Lippen zusammen. »Ich verwette einen Monatslohn gegen ein verlaustes Hemd, dass du dich bereits festgelegt hast, wer was macht.«
Ich musste lachen. »Du reitest mit Russell nach Stratford, Joe.«
»Ich dachte es mir. Warum willst du wieder einmal den gefährlicheren Part übernehmen, Logan-Amigo?«
»Das ist die Frage, was der gefährlichere Part ist«, erwiderte ich. »Ich bin beweglich und kann den Indianern gegebenenfalls davonreiten. An deinem Pferd wird eine Schleppbahre mit einem Verwundeten befestigt sein. Und vor dir liegen an die zehn Meilen bis zur Grenze.«
Plötzlich bäumte sich Russell auf. Er öffnete den Mund wie zu einem Schrei, aber es kam kein Laut über seine Lippen. Dann fiel er zurück. Sein Kopf rollte auf die Seite. Sein Blick wurde starr. Russell war gestorben.
»Die Entscheidung ist uns aus der Hand genommen worden«, murmelte Joe. »Wir bleiben beisammen.«
An unseren Sätteln waren handliche Spaten befestigt. Damit hoben wir ein Grab aus, in das wir den Banditen legten. Wir hatten ihn in eine Decke gewickelt, die wir vom Sattel eines der toten Pferde genommen hatten. Nachdem wir etwas Erde auf ihn geschaufelt hatten, holten wir die Satteltaschen mit dem Gold und legten sie in das Grab. Und dann schaufelten wir es zu. Überschüssige Erde warfen wir in den Fluss. Das Grab tarnten wir mit Grassoden, die wir sauber ausgestochen hatten, ehe wir die Grube schaufelten, mit abgefallenem, halb verfaultem Laub und mit abgebrochenen, dürren Ästen. Als wir diesen Platz verließen, ließ nichts vermuten, dass wir hier ein Grab zurückgelassen hatten, das neben einem toten Mann einen Goldschatz beinhaltete. Ich prägte mir die Stelle genau ein.
Wir ritten zu der Stelle, an der die vielen Hufspuren auf der Uferbank zu sehen waren und folgten der Fährte. Sie führte nach Westen. Nach etwa drei Meilen endete sie am Fluss. Auf der anderen Seite war sie wieder zu sehen. Wir überquerten den North Canadian. Nass bis über die Hüften folgten wir der Spur. Dann fanden wir ein totes Pferd. Es war unbeschlagen. Fliegen, die der Blutgeruch angezogen hatte, hatten sich auf dem Kadaver niedergelassen. Hier musste Sheppard den Comanchen einen Kampf geliefert haben. Wir folgten weiterhin der Spur. Bald war uns klar, dass der Bandit nach seinem Kampf mit den Indianern seine Flucht fortgesetzt hatte. Wir ritten auf der Fährte.
Und plötzlich erhoben sich Hufschläge. Auf einen Hügelkamm zu unserer Rechten trieben vier Indianer ihre Pferde. Im Norden, in einer Hügellücke, zeigten sich fünf Comanchen. Unwillkürlich drehte ich den Kopf und ließ meinen Blick über den Hügel zu unserer Linken schweifen. Auch dort erschienen jetzt berittene Indianer.
Ein eisiger Schauer lief mir über den Rücken hinunter.
»Jetzt wird‘s haarig«, knurrte Joe. »Kaum anzunehmen, dass die roten Hombres Respekt vor unseren Sternen haben.«
Ich schaute zurück. Auch der Rückweg war uns verlegt. Drei Comanchen trieben ihre Pferde hinter einem Hügel hervor und verhielten in einer Reihe. Der Stahl ihrer Gewehre reflektierte das Sonnenlicht.
Selbst auf die Entfernung konnte ich die verkniffenen Gesichter erkennen. Der Eindruck von Wucht und Stärke, den die Krieger vermittelten, war nicht zu übersehen. Es bedurfte starker Nerven, um dem Anblick standzuhalten.
»Reiten wir weiter«, knurrte ich. »Vielleicht lassen sie mit sich reden.«
Die fünf Reiter in der Hügellücke vor uns trieben ihre Mustangs an und kamen uns entgegen. Als wir aufeinander trafen, zügelten wir. Ich hob die rechte Hand und zeigte die Handfläche. »How«, sagte ich. »Spricht einer von euch die Sprache des weißen Mannes?«
»Ich«, sagte ein Krieger mit drei Federn im Haarschopf. Er trug ein fransenbesetztes Rehlederhemd und eine ausgewaschene Kavalleriehose, von der die gelben Biesen entfernt worden waren. »Ich bin Eagle Heart. Ihr seid weiße Gesetzesmänner. Kommt ihr aus Fort Smith?«
»Wir kommen aus Amarillo in Texas«, versetzte ich.
»Ihr jagt die Männer mit dem Gold.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
Ich nickte. »Es sind Mörder, Räuber und Vergewaltiger. Der Mann, den ihr am Fluss zurückgelassen habt, ist gestorben. Was ist mit dem anderen, der euch am Fluss entkommen ist? Habt ihr ihn erwischt?«
»Er hat einige von uns getötet. Wir haben es aufgegeben, ihn zu verfolgen.«
»Auf ihn wartet ihn Amarillo der Galgen. Ihr wisst, was das Gesetz der Weißen für Mörder vorsieht. Es gibt einen Vertrag, wonach weiße Marshals im Indianer-Territorium tätig werden dürfen.«
»Das gilt nur für die Marshals aus Fort Smith«, versetzte der Comanche.
»Das mag richtig sein«, sagte ich. »Aber ist es im Endeffekt nicht egal, ob es zwei Marshals aus Fort Smith oder aus Amarillo sind, die einen gemeinen Mörder aus dem Indianerland holen, um ihn der gerechten Strafe zuzuführen?«
Eagle Heart war nachdenklich geworden. Plötzlich nickte er. »Ja, es ist egal. Darum lassen wir euch ziehen. Also reitet eures Weges. Ich werde unseren Brüdern und Vettern signalisieren, dass sie euch ungeschoren lassen sollen.«
Ich legte meine Hände übereinander auf das Sattelhorn. »Du bist ein weiser Mann, Eagle Heart. Ich war einige Male im Dorf von Häuptling Büffelhorn. Kennst du ihn?«
»Büffelhorn ist alt und krank. Er ist nicht mehr Häuptling. Er predigte immer Frieden und nahm es hin, dass die Weißen gegen die geschlossenen Verträge verstießen. Niemand hört mehr auf Büffelhorn.«
»Er war ein guter Mann. Hör zu, Eagle Heart. Es ist möglich, dass vier Männer auf unserer Fährte reiten. Die beiden Brüder eines dieser Männer haben die Banditen, die wir verfolgen, in Texas ermordet. Er will Rache. Die drei Männer, die ihn begleiten, wollen ihm helfen.«
»Geht es den vieren wirklich nur um Rache, oder sind sie hinter dem Gold her?«
»Lance Delaney, dessen Brüder getötet wurden, sprach nur von Rache und Vergeltung«, erwiderte ich in dem Bewusstsein, den Comanchen zu belügen. »Drei der Männer haben in Texas Familie und wir wollen nicht, dass sie sterben. Darum bitte ich dich, Eagle Heart, die drei in Ruhe zu lassen.«
»Du verlangst viel, Marshal.«
»Was ist schon dabei, dass sie durch euer Land reiten? Sie treibt der Hass ...« Und die Habgier, fügte ich in Gedanken hinzu. »Was habt ihr davon, wenn ihr sie tötet? Die Soldaten in den Forts werden herausfinden, wer für den Tod der Männer verantwortlich ist, und man wird die Mörder zur Rechenschaft ziehen. Das Gesetz der Weißen gilt auch für die Comanchen, Cheyenne und Apachen.«
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach Eagle Heart.
Wir ritten weiter. Als wir zwischen die Hügel ritten, warf ich einen Blick zurück. Die Indianer rotteten sich zusammen. Dann stoben sie nach Süden davon.
Wir konnten uns nicht in Sicherheit wiegen. Wenn sie das Gold nicht fanden, würden sie vielleicht umkehren und wie die Teufel hinter uns her sein. Also mussten wir zusehen, in möglichst kurzer Zeit viele Meilen zwischen uns und sie zu bringen.
Wir gaben unseren Pferden die Sporen ...
*
Sheppard ritt die ganze Nacht hindurch. Der Tag brach an. Die Natur erwachte zum Leben. Der Bandit hatte keine Ahnung, ob er das Indianerland bereits verlassen hatte. Es gab weder Weg noch Steg. Über ihm spannte sich seidenblauer Himmel. Wie ein Fanal stand die Sonne im Osten.
Sheppard ritt durch eine staubige Mulde und gelangte auf den Kamm einer Bodenwelle. Und von hier aus sah er die kleine Ortschaft am Ende einer Ebene, die von bewaldeten Hügeln und Tafelbergen begrenzt wurde. Der Bandit atmete auf. Er war in Kansas. Ein Glücksgefühl, wie er es schon lange nicht mehr erlebt hatte, durchströmte ihn. Er war gerettet. An seinen Kumpel John Russell verschwendete er keinen Gedanken mehr. Jeder war sich selbst der Nächste. Lediglich an das Gold, das sie verloren hatten, dachte Sheppard mit Bedauern. Aber er hatte zwei Satteltaschen voll gerettet, und wegen der Zukunft brauchte er sich keine Sorgen mehr zu machen.
Er trieb sein Pferd an. Am Ortsrand war ein Holzschild an einen Pfahl genagelt, auf das der Name des Ortes gepinselt war. Feterita! Auf der breiten Main Street standen vier Frauen und unterhielten sich. Einige Männer waren zu sehen. Helle Hammerschläge verkündeten, dass der Schmied des Ortes seinem Tagwerk nachging. An einem Holm standen zwei Pferde und peitschten mit den Schweifen nach den lästigen Bremsen an ihren Seiten. Vor dem Store stand ein leichtes Fuhrwerk mit einem schweren Kaltblüter im Geschirr.
Langsam ritt Sheppard in den Ort. Er schaute nach links und rechts. Schließlich entdeckte er den Mietstall. In riesigen Lettern war auf die Giebelseite des Stallgebäudes Livery Stable geschrieben.
Ein paar Häuser weiter war der Saloon. Ein Mann, der eine grüne Schürze trug, fegte mit einem Reisigbesen den Vorbau. Um seinen Kopf zog sich ein grauer Haarkranz. Die wenigen Passanten blieben stehen und beobachteten den Fremden, der einen mitgenommenen, abgerissenen Eindruck vermittelte.
Vor dem Saloon hielt Sheppard an. »Hat der Laden schon geöffnet?«
Der Mann auf dem Vorbau nickte. »Kommen Sie herein, Fremder. Ich sorge für Ihr leibliches Wohl. – Sie kommen von Süden. Sind sie etwa durchs Niemandsland geritten?«
»Ja. Ich will nach Dodge City.« Sheppard schwang sich aus dem Sattel. Seine Augen waren rotgerändert und entzündet und lagen in tiefen Höhlen. Er war müde. Mit Verfolgung rechnete er nicht. Darum nahm er sich vor, ein paar Tage in dem kleinen Ort zu bleiben und sich von den Strapazen, die hinter ihm lagen, zu erholen.
Er schnallte die Satteltaschen mit dem Gold los und wuchtete sie sich auf die Schulter. Sie waren verdammt schwer. Der Salooner beobachtete ihn. Der Bandit zog die Winchester aus dem Scabbard, dann stieg er die Stufen zum Vorbau hinauf. Der Salooner folgte ihm in den Schankraum. Sheppard legte die Satteltaschen auf einen Stuhl und lehnte das Gewehr dagegen. »Geben Sie mir einen doppelten Whisky und ein Bier«, forderte er.
»Was befördern Sie denn in den Satteltaschen?«, fragte der Keeper neugierig. »Kieselsteine?«
»Erzhaltiges Gestein«, log Sheppard. »Ich habe es im Indianerland gefunden und will es in Dodge von einem Geologen prüfen lassen. Könnte Kupfer enthalten.«
»Was nützt es Ihnen im Indianerland? Sie können es dort nicht abbauen.«
»Das Land gehört den Rothäuten nicht«, versetzte Sheppard. »Sie nehmen es nur für sich in Anspruch.« Er winkte ab. »Erst muss ein Fachmann die Steine prüfen. Dann werde ich gegebenenfalls Anspruch auf das Land erheben. Aber das steht noch in den Sternen.«
Der Salooner brachte den Schnaps und das Bier. Sheppard schüttete den Whisky mit einem Zug in sich hinein. Die scharfe Flüssigkeit trieb ihm das Wasser in die Augen. Er hüstelte und trank schnell einen Schluck Bier hinterher.
»Ich will ein paar Tage in der Stadt bleiben. Können Sie dafür sorgen, dass mein Pferd in den Mietstall kommt? Oder verfügt das Hotel über einen eigenen Stall?«
»Nein. Ich werde meinem Sohn Bescheid sagen. Er wird sich um Ihr Pferd kümmern.«
»Vielen Dank.«
Nachdem er das Bier getrunken hatte, begab sich Sheppard zum Hotel, um sich ein Zimmer zu mieten.
*
Wir kamen nach Liberal, einen kleinen Ort am Rand des Indianerlandes. Wir kannten uns hier aus, denn wir waren nicht zum ersten Mal in dem Nest. Im Mietstall erfuhren wir, dass Sheppard nicht nach Liberal gekommen war. Wir hatten die Spur des Banditen verloren und konnten nur darauf vertrauen, dass er nach Dodge City wollte. Deshalb blieben wir eine Nacht in Liberal und brachen am folgenden Morgen noch vor Sonnenaufgang auf. Bis Dodge City lagen etwa achtzig Meilen vor uns. Wir mussten über den Cimarron. Aber wir hatten keine Wahl. Amos Sheppard musste zur Verantwortung gezogen werden. Er war ein gemeiner Mörder und Vergewaltiger und durfte nicht ungeschoren davonkommen.
Von Liberal aus wandten wir uns nordostwärts. Es war ein ausgefahrener Weg, den wir benutzten. Wagenräder hatten zwei schmale Spuren gezogen, zwischen denen Gras und Unkraut wuchs. Über Nacht waren Wolken aufgezogen und es sah nach Regen aus. Tatsächlich fing es nach etwa einer Stunde zu tröpfeln an. Die Wolken, die der Wind von Westen heranpeitschte, versprachen jedoch stärkeren Regen. Darum holten wir die imprägnierten Regenumhänge aus den Satteltaschen und zogen sie über.
Es dauerte etwa eine Viertelstunde, dann öffnete der Himmel seine Schleusen. Es regnete in Strömen. Trotz der Regenmäntel waren wir bald bis auf die Haut durchnässt. Die Straße weichte auf und die Hufe sanken tief ein. Große Pfützen bildeten sich.
Unbeirrt zogen wir dahin ...
*
Amos Sheppard blieb zwei Tage in Feterita. Am Vormittag des dritten Tages nach seiner Ankunft ging er in den Mietstall. Der Stallmann half ihm, sein Pferd zu satteln und zu zäumen. Er legte die schweren Satteltaschen hinter dem Sattel über den Rücken des Pferdes und schnallte sie fest. Der Stallmann sagte: »Es sind wohl an die hundert Meilen, die Sie bis Dodge reiten müssen. Am Besten, sie reiten von hier aus direkt nach Osten, bis sie auf die Poststraße stoßen, die von Liberal nach Dodge führt. Zwischen Liberal und Dodge gibt es eine Pferdewechselstation mit Handelsposten. Dort können Sie übernachten.«
»Ein guter Vorschlag«, erwiderte Sheppard. »Vielen Dank.«
Er führte das Pferd aus dem Stall. Seit zwei Tagen regnete es immer wieder. Der Regen hatte der Natur ein intensives Grün verliehen. Am Himmel zogen dunkle Wolken. Dennoch war es warm. Die Wälder dampften. Sheppard saß auf und ruckte im Sattel. Das Pferd ging an. Unter den Hufen schmatzte und gurgelte es. Die Abdrücke füllten sich sofort mit Wasser. Der Bandit ritt hinaus auf die Main Street. Der Schlamm war knöcheltief. Von den Vorbaudächern tropfte Regenwasser. Ein Ochsengespann kam von Westen her die Straße herunter.
Sheppard wandte sich nach Osten. Er ließ das Pferd im Schritt gehen. Der Bandit malte sich seine Zukunft in den schillerndsten Farben aus. Er würde reich und unabhängig sein. In Dodge würde niemand Fragen nach der Herkunft des Goldes stellen. Er würde es gegen eine Satteltasche voller Dollars eintauschen. Und dann konnte er sich in aller Ruhe überlegen, wo er sich einen Platz suchen wollte, an dem er sich niederlassen und sesshaft werden konnte. Ihm schwebte Kansas City vor. Er dachte daran, einen Inn zu eröffnen, vielleicht auch einen Spielsalon. Das Geld musste arbeiten und sich vermehren. Er würde zu einem angesehen Bürger avancieren – einem Mann, den man respektierte und achtete.
Er war etwa eine Stunde unterwegs, als zwei Reiter ihre Pferde hinter einem Hügel hervortrieben. Sie waren maskiert und hielten Gewehre in den Fäusten. Sheppard fiel seinem Pferd in die Zügel. Unwillkürlich blickte er über die Schulter nach hinten. Auch dort zeigten sich zwei Maskierte, die die Gewehre auf ihn gerichtet hielten. Der Mund des Banditen verkniff sich. Er rechnete sich seine Chancen aus. Sie tendierten gegen null. Angesichts der schussbereiten Waffen in den Händen der Wegelagerer war jeder Widerstand mit Selbstmord zu vergleichen. Ohne dazu aufgefordert zu werden hob der Bandit die Hände.
Die vier Reiter kreisten ihn ein. Einer ritt neben ihn hin, zog ihm den Revolver aus dem Holster und schleuderte die Waffe davon. Dann zog er die Winchester aus dem Scabbard und ließ sie dem Revolver folgen. »Rühr dich nur nicht«, warnte der Maskierte.
Einer saß ab und schnallte die Satteltaschen des Banditen los. Er legte sie auf den Boden und öffnete sie. Die Goldstücke glitzerten. Ein zufriedener Laut löste sich aus der Kehle des Maskierten. Er schloss die Tasche wieder, hob sie auf und trug sie zu seinem Pferd, legte sie über den Pferderücken und befestigte sie.
Einer der Maskierten stieß hervor: »Verschwinde, Mister. Und danke Gott, dass wir dich am Leben lassen.«
Sheppard trieb wortlos sein Pferd an. Die vier warteten, bis er zwischen den Hügeln verschwunden war. Er schaute sich nicht um. Dann zerrten sie die Pferde herum und trieben sie an.
Sheppard hatte zwischen den Hügeln angehalten. In ihm kochte der Zorn. Er ahnte, wem er den Überfall zu verdanken hatte. Seine Zähne knirschten übereinander. Er saß ab und stieg auf eine Anhöhe. Die Maskierten ritten zwischen die Hügel im Westen und verschwanden aus seinem Blickfeld. Sheppard kehrte zum Platz des Überfalles zurück und sammelte seine Waffen ein.
Düstere Rachepläne zogen durch seinen Kopf. Er war nicht der Mann, der sich so einfach die Butter vom Brot nehmen ließ. Aufgabe war ein Wort, das nicht in seinem Sprachschatz vorkam. Er nahm die Spur der Maskierten auf. Sie endete bei einem schmalen Weg, der wahrscheinlich zu einer Farm oder Ranch führte. Sheppard verlor die Fährte. Aber er war sich sicher, zu wissen, wohin er sich wenden musste.
Sheppard verbrachte den Tag zwischen den Hügeln. Die Zeit verging nur langsam. Er brannte vor Ungeduld. Es war eine fast fiebrige Erregung, die ihn im Klammergriff hielt. Hin und wieder regnete es. Die Langeweile schürte den Zorn des Banditen. Er war zu abgrundtiefem Hass und blinder Wut fähig. Hinter seiner starren Miene verbargen sich unheilvolle Gedanken.
Aber auch dieser Tag ging zu Ende, die Nacht vertrieb den Tag, Mond und Sterne waren hinter einer dicken Schicht aus tiefziehenden Wolken nicht zu sehen. Eine dunkle Nacht, wie geschaffen für blutige Rache.
Sheppard ritt in die Nähe der Stadt. Bei einer Gruppe von Büschen saß er ab und band das Pferd an einen armdicken Ast. In der Stadt brannten Lichter. Der Geruch von verbranntem Holz lag in der Luft. Der Rauch, der aus den Schornsteinen stieg, verbreitete diesen Geruch. Entschlossen glitt Sheppard durch die Dunkelheit. Der Mund des Banditen war eine harte, entschlossene Linie.
Sheppard begab sich zum Saloon. Aber er ging nicht in den Schankraum, sondern betrat das Gebäude durch die Hintertür und stieg die Treppe hinauf. In der oberen Etage befand sich die Wohnung des Salooners. Sheppard klopfte gegen die Wohnungstür. Eine Frau öffnete die Tür einen Spaltbreit. Mit der Schulter rammte der Bandit die Tür auf. Die Frau wurde zurückgestoßen. Die Kante der Tür traf sie an der Stirn. Ehe sie sich versah, war Sheppard in der Wohnung. Sie befanden sich in der Wohnstube. Ein Sofa und zwei Plüschsessel standen um einen Holztisch. An den Wänden standen Vitrinen. »Setz dich, Lady!«, gebot der Bandit. Und als die Frau nicht sogleich reagierte, packte er sie am Handgelenk und schleuderte sie auf das Sofa.
In ihren Augen wühlte die Angst. Aus ihrem Gesicht schien der letzte Blutstropfen gewichen zu sein. »Was – was wollen Sie?«, entrang es sich ihr. »Wer – wer sind Sie?«
»Dein Mann schuldet mir zwei Satteltaschen voller Gold!«, presste der Bandit hervor. »Wir werden hier gemeinsam auf ihn warten. Verhalte dich nur ruhig, Lady. Andernfalls werde ich dich zum Schweigen bringen.«
Er setzte sich in einen der Sessel und streckte die Beine weit von sich. Und dann wartete er wieder. Immer wieder wanderte sein Blick zu dem Regulator an der Wand. Die Zeit schien stillzustehen. Die Ungeduld zerrte an den Nerven des Banditen.
Eine Stunde nach Mitternacht kam der Salooner. Als ihn Sheppard an der Tür hörte, erhob er sich und stellte sich so an die Wand, dass ihn das aufschwingende Türblatt verdecken musste. Den Revolver richtete er auf die Frau, die ihn aus schreckensweiten Augen beobachtete.
Die Tür ging auf, Ron Watson, der Saloonbesitzer, betrat die Wohnung. »Du bist noch wach, Joana?«
Der Mund der Frau öffnete sich, aber sie brachte kein Wort hervor.
Sheppard stieß die Tür zu. Watson wirbelte herum. Da traf ihn auch schon ein brutaler Schlag gegen die Stirn. Er ging zu Boden. Blut sickerte aus einer Platzwunde über seiner Augenbraue. Sheppard richtete den Revolver auf Watson und brachte den Hahn in die Feuerrast. In seinen Augen schwelte eine gefährliche Flamme. Der Hauch der tödlichen Gefahr sprang den Salooner an. Er fühlte den unsichtbaren Strom von Härte und Brutalität, der von Sheppard ausging.
Und als der Bandit sprach, war seine Stimme so frostig wie das Glitzern des Revolvers in seiner Faust. Er sagte: »Habt ihr dreckigen Schufte das Gold schon unter euch aufgeteilt?«
»Ich habe keine Ahnung, wovon ...«
»Leugnen ist zwecklos. Du hast mit drei Kumpanen auf meinem Weg gelauert. Wo ist das Gold?« Sheppard richtete den Revolver auf die Frau. »Spuck es aus, Mister, oder ich erschieße die Lady.«
Watson kämpfte mit sich. Er konnte sich nicht entschließen.
»Ich zähle bis drei«, knurrte Sheppard. »Eins ...«
Watson atmete gepresst. Er kniete am Boden, seine Hände öffneten und schlossen sich.
»Zwei!«, kam es unerbittlich aus dem Mund von Sheppard.
»Wir haben es vor der Stadt vergraben«, gab Watson endlich zu. »Wir – wir dachten schon, dass du zurückkommst und nachforscht.«
»Du wirst mich zu der Stelle führen.« Sheppards Blick verkrallte sich an der Frau. »Und du verhältst dich ruhig, Lady. Wenn nicht, kannst du deinen Mann begraben. – Gehen wir.«
Sie verließen den Saloon. Watson führte Sheppard zu einem Platz außerhalb der Stadt. Hier wuchsen Büsche und Bäume. »Das ist die Stelle.«
»Dann grab mal die Satteltaschen aus«, befahl Sheppard.
»Mit den Händen?«
»Das Erdreich ist sicher locker. Fang an!«
Watson kniete sich nieder und grub seine Hände in die Erde. Er räumte lockeres Erdreich zur Seite, und dann zog er die Satteltaschen aus der Mulde, die sie mit dem Gewehrkolben in die Erde gekratzt hatten.
»Habt ihr euch schon bedient?«, fragte Sheppard.
»Nein. Wir wollten einige Zeit verstreichen lassen, ehe wir ...«
Sheppard schoss. Die Mündungsflamme, die auf ihn zustieß, war der letzte Eindruck im Leben des Saloonbesitzers von Feterita. Der Knall stieß durch die Nacht, trieb zwischen die Häuser und ließ Joana Watson erschauern. Sie ahnte, dass mit dem Schuss das Leben ihres Mannes ausgelöscht worden war. Eine Bruchteile von Sekunden andauernde Blutleere im Gehirn ließ sie taumeln ...
*
Drei Tage später erreichte Sheppard Dodge City. Er ritt die Front Street entlang. Hier reihten sich Saloons und andere Vergnügungsetablissements nebeneinander. Allerdings war die Zeit der großen Rindertriebe vorbei; Glanz und Gloria der Stadt waren verblasst. Aus dem Hexenkessel war ein verhältnismäßig ruhiger Ort geworden, in dem sich Frauen auf die Straße wagen konnten, ohne angepöbelt zu werden.
Vor einem Hotel parierte Sheppard sein Pferd, saß ab, band das Tier an den Hitchrack, nahm die Satteltaschen und das Gewehr und ging hinein. Hinter der Rezeption saß ein glatzköpfiger Mann, auf dessen Nase ein Zwicker saß. Er blickte dem Ankömmling entgegen.
»Ich möchte ein Zimmer mieten«, erklärte Sheppard, als er den Tresen erreicht hatte.
»Länger?«
»Zunächst mal für eine Woche. Gehört zum Hotel ein Stall?«
»Ja. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Pferd untergestellt und versorgt wird. – Bitte, tragen Sie sich ins Gästebuch ein.« Der Owner legte die Kladde aufgeschlagen vor den Banditen hin und reichte ihm einen Tintenstift. Sheppard befeuchtete mit der Zungenspitze die Miene, dann schrieb er den Namen Jack Hollister in das Buch. Der Owner reichte ihm einen Schlüssel. »Nummer drei. Die Treppe hinauf, das zweite Zimmer auf der rechten Seite.«
Sheppard brachte das Gewehr und die Satteltaschen auf das Zimmer, nahm einige Goldstücke heraus und schob sie in die Tasche. Die Satteltaschen schob er unter das Bett. Dann verließ er das Zimmer wieder, erkundigte sich an der Rezeption nach dem Weg zur Bank, erhielt ihn beschrieben und marschierte los.
Er fand die Bank auf Anhieb. Es gab zwei Schalter. Einer war nur besetzt. Ein junger Mann fragte lächelnd: »Was kann ich für Sie tun, Mister?«
Sheppard legte die Goldstücke auf den Tresen. »Ich brauche Bargeld. Darum will ich das Gold verkaufen. Ihre Bank kauft doch Gold an?«
»Natürlich, Sir. Woher haben Sie das Gold? Es handelt sich um Münzrohlinge. Daraus werden Golddollars geprägt.«
»Ich habe das Gold gefunden. Unten, in Texas. Es war Zufall. Natürlich habe ich meinen Fund gemeldet. Ich bekam zehn Prozent Finderlohn.«
»Haben Sie noch mehr davon?«
»Ja. Aber zunächst reicht es mir, wenn Sie mir das Gold hier abkaufen. Ich war viele Tage unterwegs. Im Niemandsland bin ich mit Mühe und Not den Comanchen entkommen. Ich will baden und mich rasieren lassen, und ich brauche neue Klamotten.«
»Ich verstehe, Sir. Warten Sie einen Moment.«
Der Clerk nahm die Goldstücke und ging damit in einen angrenzenden Raum. Es dauerte kurze Zeit, dann kam er zurück, einen mittelgroßen, dicken Mann mit grauen Haaren im Schlepptau. »Ich bin Adam Brown, der Direktor der Bank. Sie haben der Bank Gold angeboten. Mein Mitarbeiter erzählte mir, dass Sie mehr davon haben. Besitzen Sie eine Bestätigung, dass es sich bei dem Gold um Finderlohn handelt.«
»Ich hatte eine, nachdem ich den North Canadian überquert hatte, war sie nicht mehr leserlich und daher unbrauchbar geworden. Ich habe sie weggeworfen.«
»Na schön. Ich glaube Ihnen. Ich zahle Ihnen für das Gold dreihundert Dollar.«
»Ich bin einverstanden. Ich habe Gold im Wert von schätzungsweise 20.000 Dollar. Werden Sie es mir abkaufen?«
»Sicher, ich bin interessiert. – Geben Sie dem Gentleman dreihundert Dollar, Hank und lassen Sie ihn eine Quittung unterschreiben.«
Mit den dreihundert Dollar in der Tasche verließ Sheppard die Bank. Er war guter Dinge. Hier würde er das Gold loswerden. Ihm war klar, dass er nicht den wahren Wert des Goldes ausbezahlt bekam. Leben und leben lassen! Sollte die Bank ihren Vorteil haben. Dafür stellte der Bankier keine Fragen.
Sheppard schlenderte auf dem Gehsteig dahin. Niemand beachtete ihn. Nach Dodge City kamen ständig Fremde; sie kamen zu Pferde, mit dem Wagen oder mit dem Zug. Die Stadt war ein Schmelztiegel der verschiedensten Charaktere. Hier war alles anzutreffen; vom Prediger bis zum Banditen.
An der Ecke zu einer Seitenstraße sah Sheppard einen General Store. Er ging hinein und kaufte sich Unterwäsche, Socken, eine Hose, ein weißes Hemd und eine schwarze Lederweste. Der Storebesitzer packte die Sachen zu einem handlichen Paket zusammen. Sheppard erkundigte sich nach einem Barber Shop, der Mann im Store beschrieb ihm den Weg, und der Bandit fand den Laden auf Anhieb.
Eine Viertelstunde später saß er in einem Badezuber. Das Wasser roch nach Flieder. Die Frau des Barbiers hatte ein Salz darin aufgelöst. Das warme Wasser tat gut. Der Bandit entspannte sich.
Da ging die Tür zum Baderaum auf. Ein Mann, der einen grauen Anzug und ein weißes Hemd trug, trat ein. An seiner linken Brustseite funkelte das Symbol des Gesetzes. Er griff an die Krempe seines breitrandigen, ebenfalls grauen Stetsons und sagte: »Ich bin Town Marshal Jim Behan.«
»Mein Name ist Jack Hollister. Ich komme von Texas herauf. War ein weiter und gefährlicher Weg.«
»Ich sehe mir jeden Fremden an, der in die Stadt kommt«, erklärte der Town Marshal. »Warum haben Sie Texas verlassen?«
»Ich suche einen Platz, an dem ich bleiben kann. Arizona, New Mexico, Texas – nirgends behagte es mir. Man empfahl mir Dodge. Nun bin ich hier. Ich glaube aber nicht, dass ich bleibe. Kansas City soll noch größer sein. Ich werde mich dort wohl niederlassen und mir eine Existenz gründen. Zu irgendetwas muss ein Mann schließlich gut sein auf dieser Welt.«
Sheppard grinste.
»Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt in Dodge«, sagte der Town Marshal. »Ich will es aber nicht versäumen, Sie auf das Stadtgesetz aufmerksam zu machen. Es ist an der schwarzen Tafel des Office angeschlagen. Ich empfehle Ihnen, es zu lesen, ehe es zu einer unliebsamen Überraschung für Sie kommt.«
»Dodge hat ein eigenes Gesetz?«
»Ja. Zum Beispiel ist das Tragen von Waffen innerhalb der Stadtgrenzen verboten. Lassen Sie ihre Gürtelkanone also im Zimmer.«
»Ich sehe es schon«, murmelte Sheppard. »Man hat mir ein falsches Bild von Dodge vermittelt. Ich glaube nicht, dass es mir hier gefällt.«
»Den Bürgern gefällt es, dass keine blindwütig verschossenen Kugeln mehr die Wände ihrer Häuser durchschlagen«, versetzte der Town Marshal. »Wenn es in der Stadt Tote gab, dann war es meistens so, dass sie versehentlich erschossen wurden. Dem haben wir einen Riegel vorgeschoben.«
Der Town Marshal schwang herum und verließ den Baderaum. Er durchquerte den Laden, in dem der Barbier dabei war, einem Mann den Bart abzuschaben, dann trat er hinaus auf die Straße. Schnell ging er in Richtung Boardinghouse. Er nickte dem Mann hinter der Rezeption zu, stieg die Treppe in die obere Etage empor und klopfte gleich darauf an eine Tür. Sie wurde geöffnet. Der Town Marshal sagte: »Sheppard ist angekommen. Er nimmt ein Bad im Barber Shop. Ich glaube, er fühlt sich ziemlich sicher.«
*
»Vielen Dank, Marshal«, sagte ich, dann wandte ich mich an Joe, der auf der Bettkante saß und in seine Stiefel schlüpfte. »Sheppard ist da. Gehen wir.«
Joe hatte seine Stiefel angezogen, er griff nach meinem Gewehr und warf es mir zu, dann nahm er seine eigene Winchester. Der Town Marshal wartete auf dem Flur auf uns. Ich sagte: »Warten wir, bis Sheppard den Barber Shop verlässt.«
Joe postierte sich in der Mündung einer Gasse, von der aus er den Eingang des Barber Shops im Auge hatte. Ich wartete hinter der Ecke des Hauses. Der Marshal ging in einen Saloon auf der anderen Straßenseite und beobachtete durch die Frontfenster die Straße.
Unsere Geduld wurde auf eine ziemlich lange Probe gestellt. Doch dann kam Sheppard ins Freie. Er war frisch rasiert und trug nagelneue Kleidung. Lediglich seinen verbeulten Hut hatte er nicht gegen einen neuen ausgetauscht, und an den Füßen trug er seine brüchigen, verstaubten Stiefel. Um seine Hüften lag der Revolvergurt. Sheppard schaute sich um.
Ich trat hinter der Ecke hervor.
Joe verließ die Gasse.
Der Town Marshal ließ sich nicht sehen.
»Sheppard!« Ich rief es und zog den Remington. Der Kopf des Banditen zuckte zu mir herum. Seine Rechte sauste zum Revolver. Gleichzeitig sprang er zurück. Meine Kugel verfehlte ihn. Joes Colt krachte. Auch Sheppard feuerte. Die Detonationen verschmolzen ineinander und wurden von den Häuserwänden zurückgeworfen.
Ehe ich erneut zum Schuss kam, war Sheppard im Barber Shop verschwunden. Ich setzte mich in Bewegung ...
*
In die Tür des Barber Shops war ein kleines Fenster eingelassen, durch das Sheppard nach draußen spähte. Er hatte es mit zwei Gegnern zu tun. Bei dem einen hatte er einen Stern gesehen. Er vermutete, dass es sich um texanische Gesetzesbeamte handelte, die ihm nach Kansas gefolgt waren.
Der Barbier stand wie zu einer Salzsäule erstarrt neben dem Kunden, den er gerade rasierte. Das Gesicht des Mannes war halb voll Schaum. Die andere Hälfte hatte der Barbier schon abgeschabt.
»Gibt es eine Hintertür?«, fragte Sheppard.
»Ja – ja, durch den Baderaum ...«
Jetzt kam der dunkelhaarige Marshal ins Blickfeld des Banditen. Er zerschlug mit dem Revolverlauf das Fenster. Der Marshal stieß sich ab und rannte nach rechts davon. Ehe Sheppard zum Schuss kam, war er wieder aus seinem Sichtkreis verschwunden. Der Bandit biss die Zähne zusammen, wandte sich um und lief zu der Tür, die in den Baderaum führte. Er durchquerte den Raum, in dem es immer noch nach Flieder roch, öffnete eine weitere Tür und stand in einem kleinen Flur, von dem aus sich eine Treppe nach oben schwang. Am Ende des Korridors war eine Tür. Sie war verriegelt. Sheppard schlug den Riegel zur Seite und öffnete sie. Vor seinem Blick lag der Hof.
Damit hatte er nicht gerechnet. Sein Innerstes war aufgepeitscht. Der Gedanke, dass alles umsonst gewesen sein könnte, wühlte ihn auf.
Er sicherte in den Hof, dann verließ er das Haus. Unter seinen Schritten mahlte feiner Sand. Das Hoftor führte in eine Gasse. Er setzte seinen Fuß hinein. Dann rannte er hinter den Häusern entlang zum Hotel und ging sofort in den Stall, um sein Pferd zu satteln und zu zäumen. Das nahm etwa zehn Minuten in Anspruch. Dann betrat er das Hotel durch die Hintertür. Die Halle war leer. Die Rezeption war verwaist. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend stieg Sheppard die Treppe empor. In ihm war eine fiebrige Unrast. Wenig später betrat er sein Zimmer, nahm das Gewehr und holte die Satteltaschen unter dem Bett hervor.
Das schwere Taschenpaar auf der Schulter und das Gewehr links am langen Arm kehrte Sheppard in den Hof zurück. Er warf die Satteltaschen über den Pferderücken und schnallte sie fest. Dann stieß er die Winchester in den Scabbard und saß auf. In dem Moment, als er anritt, trat hinter dem Bretterzaun neben dem Hoftor der dunkelhaarige Bursche mit dem Stern hervor.
Sheppard stemmte sich gegen die Zügel. Das Pferd stand mit einem Ruck ...
*
Ich hielt den Remington in der Faust. Sheppard brachte sein Pferd zum Stehen. Seine Rechte tastete sich zum Revolver.
»Das würde ich sein lassen!«, warnte ich.
Neben mich trat Joe. Auch er hielt den Colt im Anschlag.
»Wer seid ihr?«
»Die U.S. Marshals Logan und Hawk«, erwiderte ich. »Ihr Trail ist zu Ende, Sheppard. In Texas wartet auf Sie der Galgen. Ziehen Sie vorsichtig den Revolver aus dem Holster und werfen Sie ihn auf den Boden. Und dann steigen Sie vom Pferd.«
Ein entschlossener Zug prägte plötzlich die Miene des Banditen. Das Aufblitzen in seinen Augen mutete an wie ein Signal. Seine Hand sauste zum Revolver. Ich wartete, bis er das Eisen gezogen hatte und es hochschwang. Im Hochschwingen spannte er den Hahn. Ich drückte ab. Meine Kugel traf und der Bandit verriss. Sein Geschoss fuhr schräg zum Himmel. Dann stürzte er rücklings vom Pferd. Sein Stöhnen erreichte mein Gehör.
Den Revolver im Anschlag ging ich zu ihm hin. Die Kugel hatte ihn in die rechte Schulter getroffen. Der Revolver war ihm entfallen. Ich hob ihn auf und reichte ihn Joe, der ihn in seinen Hosenbund schob.
Durch das Hoftor kam der Town Marshal. »Ah«, sagte er, »es hat Sheppard erwischt. Ist es schlimm?«
»Die Schulter. Wenn ihn der Arzt versorgt, kann er reiten. – Stehen Sie auf, Sheppard. Wir bringen Sie zum Doc und dann ins Gefängnis. Und morgen Früh brechen wir auf nach Texas.«
»Die Hölle verschlinge euch!«
»Sie werden vor uns dort sein«, stieß Joe hervor und zerrte den Banditen auf die Beine. Er presste seine linke Hand auf die Wunde. Seine Hand war rot von seinem Blut. Der Schmerz verzerrte sein Gesicht.
»Ich muss ein Protokoll fertigen«, erklärte der Town Marshal. »Das machen wir, sobald ihn der Doc verarztet hat.«
»In Ordnung«, antwortete ich. »Zeigen Sie uns das Haus des Arztes.«
Wir verließen den Hof. Joe führte Sheppards Pferd am Zaumzeug und sagte: »Während ihr zum Arzt geht, bringe ich das Pferd in den Mietstall und die Satteltaschen ins Office. Wir treffen uns im Marshalsbüro.«
Eine halbe Stunde später war der Bandit versorgt. Er trug den rechten Arm in der Schlinge. Wir dirigierten ihn ins Marshal‘s Office, wo Joe schon auf uns wartete. Bei ihm befand sich ein Deputy. Sheppard wurde hinter Schloss und Riegel gebracht.
Wir hatten den weiten Weg nach Dodge City nicht umsonst gemacht. Ich spürte ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit.
Am folgenden Morgen brachen wir beizeiten auf. Über dem Arkansas River, der an der Stadt vorbeifloss, hingen Nebelbänke. Eine hölzerne Brücke führte über den Fluss. Die Pferdehufe erzeugten auf den Bohlen ein hämmerndes Echo. Wir führten ein Maultier mit uns, das ich am Tag zuvor erworben hatte. Es trug einen Sattel. Das Tier sollte die Satteltaschen mit dem Gold tragen, die wir natürlich nicht im Indianerland zurücklassen wollten.
Sheppard ritt vor uns. Joe und ich folgten ihm. Wir ritten Steigbügel an Steigbügel. Da der Bandit mit seinem rechten Arm nichts anfangen konnte, hatten wir darauf verzichtet, ihn zu fesseln. Gegen Mittag des dritten Tages nach unserem Aufbruch in Dodge erreichten wir Liberal. Wir aßen im Saloon, ruhten eine Stunde aus und ritten dann weiter.
»Wollt ihr den Rückweg etwa durchs Indianerland nehmen?«, fragte Sheppard entsetzt. »Die roten Teufel warten doch nur darauf, dass wir ihnen in die Hände reiten.«
»Wir werden uns bemühen, ihnen nicht zu begegnen«, versetzte Joe mit einem Anflug von Sarkasmus. »Was haben Sie außerdem zu verlieren, Sheppard? Meinen Sie, es ist angenehm, am Hals aufgehängt zu werden?«
Der Bandit knirschte mit den Zähnen.
Wir ritten in die Wildnis hinein. Soweit es ging, nutzten wir den Schutz der Wälder aus. So kamen wir gut voran. Wir hüteten uns, durch Senken und Ebenen zu reiten und nahmen große Umwege in Kauf. Hügel umritten wir. Außerdem bemühten wir uns, so wenig Spuren wie nur möglich zu hinterlassen. Wenn Indianer auf die Spur stießen und herausfanden, dass hier beschlagene Pferde gegangen waren, würden sie ihr folgen.
Ungeschoren erreichten wir den North Canadian. Wir mussten den Fluss durchqueren. »Warte du hier mit Sheppard«, sagte ich zu Joe. »Ich gehe hinüber und sondiere die Lage.«
Joe nickte.
Ich trieb mein Pferd in den Fluss. Bald musste das Tier schwimmen. Ich hielt meine Waffen in die Höhe. Ungehindert gelangte ich auf die andere Seite und winkte. Sheppard setzte sein Pferd in Bewegung. Joe folgte ihm. Die Brust eines jeden Pferdes teilte das Wasser wie der Bug eines Bootes. Der Bandit und Joe erreichten das Ufer. Wir ritten zu der Stelle, an der wir das Gold vergraben hatten. Der Platz war von unbeschlagenen Hufen zertreten. Die Spuren der Comanchen führten nach Osten. Materielle Werte waren den Indianern nicht so wichtig.
Wir gruben die Taschen aus und beluden damit das Maultier. Dann ritten wir weiter. Bis nach Texas lagen noch etwa zehn Meilen vor uns. Zehn Meilen, auf denen die Gefahr überall lauerte und der Tod allgegenwärtig war.
Wir ritten zwischen den Hügeln, als ein Schuss peitschte. Amos Sheppard sackte zusammen und kippte nach vorn, verlor das Übergewicht und stürzte kopfüber vom Pferd.
Wir griffen nach den Waffen, da peitschte es erneut und die Kugel pflügte zwischen den Vorderbeinen meines Pferdes in den Boden. Das Tier schnaubte erregt und begann zu tänzeln. Ich nahm es in die Kandare.
Zwei Reiter trieben ihre Pferde über den Kamm des Hügels und kamen hangabwärts. Es waren Lance Delaney und einer der Männer aus Tascosa. »Haltet nur die Hände ruhig!«, rief Delaney. »Wenn ihr uns keinen Grund gebt, schießen wir auch nicht.«
Ich stieg vom Pferd und beugte mich über Sheppard. Er war tot. Die beiden Reiter waren heran und zügelten. Ich sagte: »Sie haben Ihren Bruder gerächt, Delaney. Aus Sicht des Gesetzes war es allerdings Mord. Sie werden sich dafür verantworten müssen.«
»Ich werde nicht mehr nach Texas zurückkehren, Marshal«, versetzte Delaney. »Haben Sie alles Gold retten können?«
»Zwei Satteltaschen sind im North Canadian versunken«, versetzte ich. »Wo sind übrigens ihre beiden anderen Begleiter?«
Delaney wies mit dem Daumen über seine Schulter. »Auf dem Hügel. Sie beobachten euch über Kimme und Korn. Wir wollten kein Risiko eingehen.«
»Das Gold bekommen Sie nur über unsere Leichen, Delaney«, sagte ich mit aller Entschiedenheit. »Und nun will ich von Ihnen die Wahrheit wissen. Sie sind gar nicht Lance Delaney. Sie sind Jack, der damals dabei war, als das Geld geraubt wurde.«
»Ja, ich ritt damals mit Shorty Kellock. Lance ist tot. Ich werde mich in einen Staat absetzen, in dem mir das Gesetz nichts anhaben kann. Legt eure Waffen ab und reitet weiter, Marshals. Das Maultier übernehmen wir.«
Ich schaute den dunkelhaarigen Burschen neben Delaney an. »Sie haben Familie in Tascosa. Wollen Sie diese einfach sich selber überlassen?«
»Auch wir werden in einen Staat gehen, in dem wir nicht gesucht werden, und unsere Familien nachholen.«
Ich wechselte mit Joe einen schnellen Blick. Wir verstanden uns ohne viele Worte. Und dann handelten wir. Ich hechtete zur Seite und zog den Remington. Schüsse krachten. Aber die Banditen konnten sich nicht schnell genug auf das so jäh veränderte Ziel einstellen. Unsere Revolver brüllten auf. Ich sah Delaney und den anderen Burschen von den Pferden kippen und rollte zur Seite. Dort, wo ich eben noch gelegen hatte, bohrte sich ein Geschoss in den Boden. Ich schnellte hoch, war mit einem Satz im Sattel und jagte das Tier um den Hügel herum, auf dem ich die beiden Gewehrschützen vermutete. Zwischen einer Gruppe von Büschen riss ich mein Pferd in den Stand, sprang ab, zog die Winchester aus dem Scabbard und rannte hangaufwärts.
Trommelnde Hufschläge erklangen. Als ich den Hügelkamm erreichte, sah ich zwei Reiter im Westen in einen Hügeleinschnitt stieben. Die beiden hatten die Flucht ergriffen. Es waren nur Mitläufer gewesen, die der Mut verlassen hatte, als es um Leben oder Tod ging.
Ich holte mein Pferd und ritt zu Joe zurück. »Delaney und der andere Bursche sind tot«, empfing mich mein Partner. »Die Schüsse haben eventuell Indianer alarmiert. Sehen wir zu, dass wir Land gewinnen.«
So schnell es das Packtier zuließ, sprengten wir nach Süden. Die Toten zu begraben hatten wir nicht die Zeit. Knapp zwei Stunden später erreichten wir die Grenze. Wir waren in Sicherheit.
Der Goldschatz hatte weder Shorty Kellock und seiner Bande noch Jack Delaney und seinen Kumpanen Glück gebracht. Auch Amos Sheppard und seine Bande hatte die Gier nach dem Gold ins Verderben gerissen. Am Ende hatte das Recht über sie alle triumphiert ...