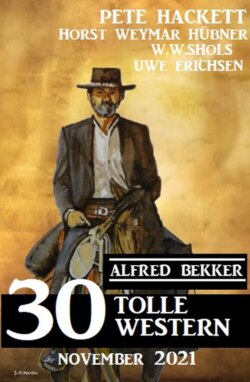Читать книгу 30 tolle Western November 2021 - Pete Hackett - Страница 58
Band 108 Und ich gab den Stern zurück
ОглавлениеIch hielt mein Pferd an. Der schrale Wind trieb Brandgeruch heran. Das Tier unter mir, ein Pinto, trat unruhig auf der Stelle und schnaubte. Ein Zweifel war ausgeschlossen. Weiter westlich brannte etwas. Kurzentschlossen trieb ich das Pferd an.
Der Brandgeruch wurde intensiver. Vor mir lag ein langgezogener Hügel. Er dehnte sich von Norden nach Süden. Rauch stieg hinter dieser Anhöhe zum Himmel und ballte sich vor der blauen Kulisse. Vom Kamm des Hügels aus sah ich dann die niedergebrannte Farm. Das Farmhaus war nur noch ein Haufen verkohlter Trümmer, aus denen dunkler Rauch stieg. Im Hof lag ein Mann auf dem Gesicht. Ich ritt hinunter. Funken stoben, Aschefetzen trieben über den Hof. Bei dem Mann saß ich ab und kniete neben ihm nieder. Er stöhnte. Ich drehte ihn auf den Rücken. Seine Brust war voll Blut. Der nahe Tod zeichnete bereits sein bleiches Gesicht.
»Meine Frau«, murmelte er mit kaum verständlicher Stimme.
»Wo ist Ihre Frau?«
»Im – im Haus. Es – es war ein Reiter. Er ritt einen Fuchs. Er – er kam auf die Farm und – und ...«
Die Stimme brach, der Kopf des Mannes rollte auf die Seite, in sein Gesicht senkte sich die Leere des Todes. Sekundenlang starrte ich auf den Brandschutthaufen. Für jemand, der sich im Haus befand, gab es keine Chance mehr. Mir wurde der Hals eng beim Gedanken daran, dass die Frau in dem Haus verbrannte.
Ich schloss dem Toten die Augen und richtete mich auf. In einem Pferch drängten sich einige Schafe und Ziegen zusammen. In einer Koppel stand eine Milchkuh und äugte zu mir her. Das Feuer hatte den Tieren nicht gefährlich werden können. Im Staub fand ich Hufspuren. Sie führten nach Norden.
Ich ging in den Stall. Dort stand ein schwerer Kaltblüter in einer Box. Ich brachte das Pferd ins Freie, dann öffnete ich die Fence, damit die Schafe und Ziegen heraus konnten. Auch der Milchkuh schenkte ich die Freiheit. In einem Schuppen fand ich eine Hacke und eine Schaufel. Ich machte mich daran, ein Grab auszuheben. Dann wickelte ich den Leichnam in eine Zeltplane, die ich ebenfalls in dem Schuppen gefunden hatte, und beerdigte ihn.
Die Frau des Farmers hatte unter dem Brandschutt des Farmhauses ihr Grab gefunden. Meine Zähne mahlten übereinander. Die Tat durfte nicht ungesühnt bleiben. Mein Entschluss, dem Mörder zu folgen, stand fest.
Das Pferd trug mich nach Norden. Deutlich zeichnete sich im Gras die Fährte des Reiters ab, dem ich folgte. Die Sonne näherte sich dem Westen. Die Schatten wurden lang. Ich ritt zwischen den Hügeln. Dumpf pochten die Hufe auf dem von der Sonne hartgebackenen Untergrund.
Dann lag vor mir eine Ortschaft. Es waren nicht mehr als fünfundzwanzig Häuser, die ohne besondere bauliche Ordnung zu beiden Seiten einer breiten Main Street errichtet worden waren. Aus einigen Schornsteinen stieg Rauch. Die Frauen bereiteten das Abendessen zu. Etwas außerhalb der Ortschaft befanden sich Pferche und Koppeln mit Ziegen, Schafen und Kühen.
Ein verwittertes Ortschild am Stadtrand verriet mir, dass das Nest den Namen Briscoe trug. Ich ritt zwischen die ersten Häuser. Unter den Vorbauten und an den Hauswänden hatten sich Tumbleweds verfangen. Staubwirbel glitten über die Straße. Ein Hund bellte. Zwei Männer, die sich auf dem Gehsteig bewegten, blieben stehen und beobachteten mich.
Ich ritt zu ihnen hin und zügelte das Pferd. »Guten Abend. Ich bin U.S. Deputy Marshal Bill Logan. Kam ein Reiter auf einem Fuchs in die Stadt?«
Einer der Männer nickte. »Er war vor zwei Stunden hier. Aber er hielt sich nicht auf in der Stadt. Nach einem kurzen Besuch im Store ritt er weiter.«
Ich ließ meinen Blick über die Fronten der Häuser gleiten und entdeckte den Laden, tippte an die Krempe meines Hutes und bedankte mich. Vor dem Store saß ich ab, schlang den langen Zügel lose um den Querbalken des Holms und ging in das Geschäft. Die Türglocke bimmelte. Hinter der Theke stand ein Mann und räumte ein Regal ein. Er wandte sich mir zu. Ich grüßte, nannte noch einmal meinen Namen und sagte dann: »Vor zwei Stunden war ein Fremder bei Ihnen. Er ritt einen Fuchs.«
Der Storehalter nickte. »Ja, ein Bursche, der nicht gerade vertrauenerweckend aussah. Er schien einen weiten Ritt hinter sich zu haben. Und er war abgebrannt.« Der Storehalter griff unter den Verkaufstresen, als seine Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie eine silberne Taschenuhr mit einer ebenfalls silbernen Kette. »Die bot er mir zum Kauf an.«
»Kann ich mal sehen?« Ich nahm die Uhr und ließ den Deckel aufspringen. Eine Gravur zeigte die Buchstaben B. und S. Ich richtete den Blick auf den Storehalter. »Ich komme vom Sweetwater herauf. Dort hat ein Mann, der einen Fuchs ritt, eine Farm überfallen und das Ehepaar getötet.«
Der Storehalter wurde bleich. »Der – der Kerl ritt einen Fuchs.« Plötzlich schlug sich der Mann mit der flachen Hand leicht vor die Stirn. »Fünf Meilen südlich von hier liegt die Swanson Farm. B. S. – Bruce Swanson! Großer Gott!«
»In welche Richtung ist der Mann geritten?«
»Norden.«
Ich bedankte mich, verließ den Laden, band mein Pferd los und schwang mich in den Sattel.
Die Sonne ging unter. Ihr Widerschein färbte den Himmel im Westen blutrot. Rötlicher Schein lag auf dem Land. Die Schatten waren verblasst. Die Abenddämmerung kam schnell. Von Norden her nahm der Himmel eine violette Färbung an. Aus den Senken erhob sich grauer Dunst. Am Westhimmel zeigte sich der Abendstern.
Unbeirrbar ritt ich weiter. Der Kerl hatte nur zwei Stunden Vorsprung, und sicher beeilte er sich nicht, denn er rechnete nicht mit Verfolgung. Bald war es finster. Es wurde merklich kühler. Die Hügel muteten an wie geduckt daliegende, vorsintflutliche Ungeheuer. Der Schrei eines Kauzes wehte heran.
Ich wusste nicht genau, wie viel Zeit vergangen war, als sich vor mir eine Buschreihe aus der Dunkelheit schälte. Die Büsche wurden hier und dort von hohen Pappeln überragt. Ich hatte den Washita River erreicht. Der Mond stand im Süden und versilberte mit seinem kalten Licht die Flanken der Hügel. Ich hielt an. Das Pferd unter mir trat auf der Stelle. Die Gebisskette klirrte, das Sattelleder knarrte. Ich ließ meinen Blick über die Buschreihe gleiten.
Da wieherte zwischen den Büschen ein Pferd. Wie ein Fanfarenton erhob es sich. Schnell saß ich ab. Die Winchester flirrte aus dem Scabbard, ich riegelte eine Patrone in den Lauf und führte mein Pferd am Kopfgeschirr zu einem Strauch, schlang den Zügel um einen Ast, dann glitt ich lautlos durch die Finsternis.
Ich war mir fast sicher, den Mörder des Farmerehepaares eingeholt zu haben, und verspürte Genugtuung. Hier sollte der Trail des Schurken zu Ende sein.
*
Clint Anderson war vom Wiehern des Pferdes erwacht. Er schleuderte die Decke von sich, griff nach der Winchester, die neben ihm am Boden lag, und stand auf. Er war angespannt bis in die letzte Faser seines Körpers. Jeder seiner Sinne war aktiviert. Sein Pferd hatte sich erhoben und stampfte auf der Stelle. Anderson lauschte und witterte. Er huschte zu seinem Pferd hin. Das Tier schnaubte. Der Mann schlich weiter. Seine Hände hatten sich an Kolbenhals und Schaft der Winchester regelrecht festgesaugt. Zweige zerrten an seinem Hemd und peitschten sein Gesicht, unter seinem Stiefel knackte ein dürrer Ast. Das Geräusch mutete ihn überlaut an. Er staute den Atem und blieb stehen.
Schließlich pirschte er weiter. Er trat aus den Büschen, schwenkte den Blick nach links, nach rechts und versuchte mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen.
Plötzlich bohrte sich ihm etwas stahlhart zwischen die Schulterblätter, und eine brechende Stimme sagte: »Lass das Gewehr fallen.«
Der Bandit versteifte. Ein Schwall verbrauchter Atemluft brach über seine zuckenden Lippen. Seine Hände öffneten sich und das Gewehr klatschte auf den Boden.
»Hände in die Höhe!«, kam klirrend der nächste Befehl. »Gut so.« Andersons Revolver wurde aus dem Holster gezogen. Die Stimme warnte: »Versuch nur nichts, Hombre. Deine Sorte fasse ich nicht mit Samthandschuhen an.«
»Wer bist du?«
»U.S. Deputy Marshal Bill Logan.«
Anderson setzte alles auf eine Karte und wirbelte herum. Etwas knallte gegen seinen Kopf, vor seinen Augen schien die Welt in Flammen aufzugehen. Dann schlug absolute Finsternis über ihm zusammen und sein Denken riss.
Als er wieder zu sich kam, waren seine Hände auf den Rücken gefesselt. Ein Feuer brannte. Ein Schatten fiel auf den Banditen, als zwischen ihn und das Feuer eine Gestalt trat. Bei Anderson stellte sich die Erinnerung ein. Der Magen krampfte sich ihm zusammen.
»Wie ist dein Name?«
»Anderson – Clint Anderson.«
»Du bist ein verdammter Mörder, Anderson. Ich werde dich nach Amarillo bringen, und dort wirst du hängen.«
»Ich – ich habe niemand umgebracht.«
»Doch. Du warst auf der Swanson Farm. Leugnen ist zwecklos. In Briscoe hast du Swansons Uhr verhökert.«
»Das – das stimmt nicht«, stammelte der Bandit. »Als ich auf die Farm kam, war alles schon vorbei. Ich – ich habe dem Sterbenden die Uhr weggenommen. Er brauchte sie doch nicht mehr. Ich konnte nichts tun für ihn. Also ritt ich weiter. Es stimmt, ich habe in Briscoe die Uhr verscherbelt. Aber ...«
»Spar dir die Luft fürs Hängen, Bandit.«
Anderson zerrte an seinen Handfesseln. Aber die Stahlspangen hielten stand. Er bäumte sich auf, knirschte mit den Zähnen, keuchte: »Man kann mich nicht für etwas hängen, das ich nicht begangen habe. Ich schwöre es, Marshal ...«
*
Das Gericht verurteilte Clint Anderson zum Tod durch den Strang. Da Richter Humphreys Urteile Endurteile waren, die nicht angefochten werden konnten, wurde Anderson zwei Wochen nach der Urteilsverkündung in Amarillo gehängt.
Ich befand mich an dem Tag, als das Urteil vollstreckt wurde, in Borger. Dort hatte der Deputysheriff einen steckbrieflich gesuchten Banditen festgenommen, der nach Amarillo überführt werden musste. Als Joe Hawk und ich mit dem Gefangenen in Amarillo ankamen, waren die Zimmerleute dabei, den Galgen abzubauen.
Wir übergaben den Gefangenen dem Sheriff, dann begaben wir uns zum Richter. Er forderte uns auf, an dem kleinen Besprechungstisch Platz einzunehmen. Als wir saßen, sagte Humphrey: »Anderson hat bis zuletzt seine Unschuld beteuert. Aber die Beweise gegen ihn waren erdrückend. Ich konnte gar nicht anders, als ein Todesurteil zu sprechen.«
»Die meisten Verbrecher leugnen ihre Tat bis zum Schluss«, sagte Joe. »Sie hoffen bis zuletzt auf eine Begnadigung. Nun, in dem Drama um das Ehepaar Swanson ist der Vorhang gefallen. Der Mörder hat seine gerechte Strafe erhalten.«
*
John Wood zügelte sein Pferd. Er verhielt auf einer Anhöhe, über die der von Wagenrädern zerfurchte und von Hufen aufgewühlte Weg führte. Ein heftiger Wind kam von Süden und brachte den feinen Staub des Llano Estacado mit sich.
Vor dem Kopfgeldjäger lag eine kleine Stadt. Sie mutete an wie ausgestorben. Staubfahnen wurden über die Dächer hinweggeweht. Wood tätschelte den Hals seines Pferdes. »Gleich stehst du in einem Stall und kriegst Hafer zu fressen. Nur noch wenige Minuten.«
Nach dem letzten Wort ruckte Wood im Sattel. Das Tier setzte sich in Bewegung. Die Augen des Kopfgeldjägers waren entzündet, zwischen seinen Zähnen knirschte Staub. Er lenkte das Pferd den Abhang hinunter und ritt bald zwischen die Häuser. Das Winseln des Windes, der sich an den Häusern brach, erfüllte die Luft. Irgendwo bewegte sich knarrend eine Tür. Auf den Fensterbänken standen Blumenkästen mit roten Geranien. Die Bäume in den Gärten bogen sich im Wind.
Immer wieder hüllten Staubwirbel den Reiter ein. Der Staub war unter seine Kleidung gekrochen und scheuerte auf seiner Haut. Er ritt mitten auf der Main Street. Hinter den Fensterscheiben sah er die hellen Kleckse der Gesichter der Menschen, die seinen Einzug in Spearman beobachteten.
Wood fand den Mietstall, ritt durch das hohe Galgentor und saß vor dem Tor, das geschlossen war, ab. Von irgendwo her drang ein durchdringendes Quietschen an sein Gehör. Wood zog das Tor auf. Im Stall war es düster. Durch die Ritzen zwischen den Brettern fiel in schrägen Bahnen das Tageslicht. Zu beiden Seiten des Mittelganges waren Boxen. Einige Futterkisten standen herum.
Wood nahm das Pferd an der Trense und führte es in den Stall. Der Geruch von Heu und Stroh und Pferdeausdünstung stieg ihm in die Nase. Staub wirbelte durch das offene Tor.
Aus einem Verschlag, der ihm als Aufenthaltsraum und Stall Office, diente, trat der Stallmann – ein bärtiger Oldtimer, der auf einem Priem herumkaute. Er schlurfte näher, zog das Tor zu, spuckte aus und sagte krächzend: »Verdammter Staub. Er dringt durch sämtliche Ritzen.«
Staub rieselte von den Schultern des Kopfgeldjägers und von der Krempe seines Hutes. »Ich reite auf der Spur eines Mannes«, sagte er heiser, öffnete eine der Satteltaschen und nahm einen Steckbrief heraus, reichte ihm den Stallmann und fragte: »Die Spur des Burschen führt hierher. Ist der Kerl in die Stadt gekommen?«
Der Stallmann nahm den Steckbrief mit beiden Händen und starrte auf das Konterfrei des Banditen. »Matt Dexter«, murmelte er versonnen. »500 Dollar, tot oder lebendig.« Der Stallbursche nickte. »Vor drei Tagen kam einer hier an. Das könnte er sein. Allerdings nennt sich in der Stadt Hank Sanders. Das dort ist sein Pferd.«
Der Stallmann wandte sich halb um und deutete auf einen Grullahengst, der in einer der Boxen stand.
Wood hing zu dem Pferd. Das Brandzeichen bestand aus zwei Ringen und bedeutete O im Kreis. »Wo finde ich den Burschen?«
»Vielleicht im Hotel, vielleicht auch im Saloon.« Der Stallmann reichte den Steckbrief zurück, Wood faltete ihn zusammen und steckte ihn in die Westentasche. »Sind Sie ein Sheriff oder Marshal?«, fragte der Stallbursche.
»Nein.«
Der Stallmann begriff. »Es geht Ihnen um die Prämie, wie?«
»Der Steckbrief legitimiert mich.« Wood zog die Winchester aus dem Scabbard. »Reiben Sie das Pferd gut ab und geben Sie ihm Hafer zu fressen.« Mit dem letzten Wort setzte er sich in Bewegung. Ein wenig sattelsteif ging er zum Tor, öffnete es einen Spaltbreit und schlüpfte hinaus. Der Wind packte ihn wie mit zornigen Klauen. Eine Ladung Staub prasselte ihm ins Gesicht. Er verließ den Hof des Mietstalles, fand den Saloon, und ging hinein. Es war um die Mitte des Nachmittags. Der Keeper saß an einem Tisch und las in einer vergilbten Zeitung. Ansonsten war der Schankraum leer. Es roch nach kaltem Rauch und verschüttetem Bier. Die Pendeltür schlug hinter dem Kopfgeldjäger aus. Der Keeper hob das Gesicht und starrte den Ankömmling an. Wood ging zu einem der runden Tische und setzte sich. Das Gewehr lehnte er an den nächsten Stuhl. »Geben Sie mir ein Bier«, sagte er. »Der verdammte Staub trocknet einem die Kehle aus.«
Der Keeper erhob sich und ging hinter den Schanktisch, hielt einen Glaskrug unter den Zapfhahn und füllte ihn. Dann trug er den Krug zu Wood hin und sagte: »Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor das Haus.«
Wood zeigte ein kantiges Grinsen. Dann zog er den Steckbrief aus der Westentasche, faltete ihn auseinander und hielt ihn dem Keeper hin. »Ist das Mann, der sich hier Hank Sanders nennt?«
Der Keeper kniff die Augen ein wenig zusammen, starrte kurze Zeit auf das Bild, dann erwiderte er: »Ja, das könnte Sanders sein. Er kam vor drei Tagen in die Stadt. Mir erzählte er, dass er weiterreiten wird, wenn sich das Wetter beruhigt. Ich dachte mir doch gleich, dass mit dem Burschen etwas nicht stimmt. Er vermittelt einen nicht gerade vertrauenerweckenden Eindruck.«
»Er ist ein kaltblütiger Mörder. Wo ist er zu finden?«
»Schätzungsweise im Hotel. Aber er kommt jeden Abend her, um zu essen, trinkt zwei Bier und verschwindet dann wieder.«
Wood faltete den Steckbrief wieder zusammen und steckte ihn ein. Dann trank er einen durstigen Zug von dem Bier, wischte sich den Schaum von den Lippen und lehnte sich zurück. »Ich werde hier auf ihn warten.«
Der Keeper ging zu seinem Tisch zurück und setzte sich. Draußen heulte der Wind. Der Staub prasselte gegen das Frontfenster, an dem Fliegen auf und ab tanzten. Wood drehte sich eine Zigarette und rauchte. Die Zeit verrann nur langsam. Der Kopfgeldjäger hüllte sich in Geduld. Nach und nach kamen einige Männer in den Schankraum. Neugierige Blicke trafen den Fremden. Die Männer setzten sich und tuschelten miteinander.
Wood hatte durch das Fenster einen Ausschnitt der Main Street im Auge. Und über diese kam nun ein großer Mann, der mit einem langen Staubmantel bekleidet war und auf dessen Kopf ein flachkroniger, schwarzer Stetson mit breiter Krempe saß. Ein Staubwirbel hüllte den Burschen sekundenlang ein, gab ihn wieder frei und dann waren die Schritte des Mannes auf dem Vorbau zu hören. Im nächsten Moment betrat er den Saloon. Woods Blick verkrallte sich an ihm.
Es war Dexter. Er schaute sich um, dann ging er zum Schanktisch und verlangte ein Bier. Mit dem Krug in der Hand ging er gleich darauf zu einem freien Tisch. Sein stechender Blick richtete sich auf Wood, taxierte ihn und schien ihn einzuschätzen.
Der Keeper stand hinter dem Schanktisch und zog den Kopf zwischen die Schultern. Seine Augen flackerten unruhig.
Als Dexter einen Stuhl zurückzog, riefen die Stuhlbeine ein scharrendes Geräusch war, das im nächsten Moment in der Stille versank. Der Bandit setzte sich und nahm einen Schluck von dem Bier.
Wood beobachtete ihn unter halb gesenkten Lidern hervor. Das Flüstern und Raunen der anderen Gäste erfüllte den Raum. Tabakrauch schlierte unter der Decke. Dexter schien das Interesse an Wood verloren zu haben. Ein unstetes Leben jenseits von Recht und Ordnung hatte unübersehbare Spuren im Gesicht des Banditen hinterlassen. Tagealte Bartstoppeln bedeckten Kinn und Wangen. Seine Augen waren unablässig in Bewegung. Er besaß den unsteten Blick des ständig Gehetzten.
Der Kopfgeldjäger erhob sich und griff zugleich nach dem Gewehr, richtete es auf Dexter und repetierte. Das metallische Geräusch hing für den Bruchteil einer Sekunde in der Luft. Die Schultern des Banditen strafften sich. Sein Gesicht wurde kantig, seine Kiefer begannen zu mahlen.
Die Atmosphäre war plötzlich angespannt und gefährlich. Die Luft schien vor Spannung zu knistern. Die Unterhaltungen verstummten. Die Stille, die den Schankraum ausfüllte, mutete bleischwer und erdrückend an.
Langsam ging Wood auf den Tisch des Banditen zu. Leise klirrten seine Sporen. Stiefelleder knarrte. Die Absätze der Reitstiefel riefen ein hämmerndes Echo auf den sägemehlbestreuten Dielen wach.
Wie von Schnüren gezogen erhob sich der Bandit. In seinem Gesicht arbeitete es krampfhaft. In seinen Augen zeigte sich ein tückisches Schillern. »Wer bist du?«
»John Wood. Und du bist Matt Dexter. Versuch nur nichts, Dexter. Es wird mir nichts ausmachen, dir ein Stück Blei zu verpassen. Auf deinem Steckbrief steht tot oder lebendig.«
»Mein Name ist Sanders.«
Woods Mund verzog sich spöttisch. »Sicher. Komm um den Tisch herum, Dexter, nimm die Hände in die Höhe und dreh dich um.«
Plötzlich geriet Leben in die Gestalt des Banditen. Er packte den Tisch mit beiden Händen und warf ihn um. Seine Rechte stieß zum Revolver, den er über den Staubmantel geschnallte hatte. Die Hand schloss sich um den Griff – Wood drückte ab.
Dexter, der hinter dem Tisch in Deckung gehen wollte, bäumte sich auf. Sein Mund öffnete sich, der Schrei, der sich in seiner Brust hochkämpfte, erstarb jedoch in der Kehle. Er drehte sich halb um seine Achse und brach zusammen.
Pulverdampf zerflatterte. Die Menschen im Schankraum hielten den Atem an. Die Detonation war verklungen. Woods Gesicht wies nicht die Spur einer Gemütsregung auf. Der kalte Hauch des Todes umgab ihn. Er gab sich einen Ruck und ging zu Dexter hin. Der Atem des Banditen ging rasselnd. Seine Brust hob und senkte sich unter den stoßweisen Atemzügen.
»Du hast mich gut erwischt, Hombre«, keuchte Dexter. »Wer bist du?«
»John Wood. Ich reite seit einem halben Jahr auf deiner Fährte, Dexter. Du hast eine blutige Spur durch Texas gezogen. Deinen letzten Mord hast du am Sweetwater begangen. Ich fand ein frisches Grab und erfuhr in Briscoe, dass ein Marshal den Farmer begraben hat. Die Frau ist im Haus verbrannt. Du bist ein Scheusal, Dexter.«
»Sie – sie war eine hübsche Lady. Ich – ich hatte Freude an ihr. Der Narr hätte nicht versuchen sollen, mich – mich von der Farm zu jagen. Aber – aber ...«
Der Bandit bäumte sich auf. Ein Schwall Blut brach aus seinem Mund, dann fiel er zurück und starb.
*
John Wood führte das Pferd mit dem Toten am Zügel. Vor dem Distriktgericht in Amarillo hielt er an und schwang sich aus dem Sattel. Er band sein Pferd an und ging in das Sheriff's Office, das in einem flachen Anbau untergebracht war. In einem der Büros traf er auf Sheriff Duncan O'Leary. O'Leary saß hinter seinem Schreibtisch. Neben dem Schreibtisch lag Wolf, der große, graue Hund, der seinem Herrn nicht von der Seite wich.
Duncan O'Leary war früher einmal als Marshal für das Distriktgericht geritten. Dann stellte er sich der Wahl zum Countysheriff und gewann. Er musterte den Fremden, der jetzt sein Büro betrat, und machte sich von ihm ein Bild.
Wood murmelte einen Gruß, dann sagte er: »Ich bringe Matt Dexter in die Stadt.« Er legte den Steckbrief vor O'Leary auf den Schreibtisch. »Ich habe ihn oben in Spearman gestellt. Er setzte sich zur Wehr und ich musste ihn erschießen.«
O'Leary nahm den Steckbrief und las. Dann erhob er sich. »Zeigen Sie mir den Toten.«
Sie gingen hinaus. Wood griff in die Haare der schlaffen Gestalt, die quer über dem Pferderücken lag, und hob den Kopf soweit an, dass der Sheriff das Gesicht erkennen konnte. »Er hat seine letzten Morde am Sweetwater begangen. Ein Farmerehepaar fiel ihm zum Opfer. Der Name der Leute war Swanson. Die Frau hat er vergewaltigt und getötet, dann hat er das Haus angezündet.«
Die Brauen des Sheriffs schoben sich zusammen. »Hier in Amarillo wurde vor einigen Tagen ein Mann für die Morde an Bruce Swanson und seiner Frau gehängt. Sein Name war Clint Anderson.«
»Bevor er starb, hat Dexter den Überfall auf die Farm gestanden«, versetzte Wood. »Ein Dutzend Männer oben in Spearman sind Zeugen. Ich denke, Sheriff, es wurde ein Unschuldiger gehängt.«
Sekundenlang presste Duncan O'Leary die Lippen zusammen, dann sagte er: »Ich muss ein Protokoll erstellen. Sie müssen es unterschreiben. Und dann stelle ich Ihnen eine Bankanweisung aus. Die Fangprämie bekommen Sie von jeder Bank ausbezahlt.«
Sie gingen wieder ins Office ...
*
Joe und ich kamen nach Amarillo zurück. Bei uns befanden sich zwei Banditen, die wir am Tierra Blanca Creek verhaftet hatten. Wir saßen vor dem Sheriff's Office ab. Im Keller des Anbaus war das Gefängnis untergebracht. Während Joe mit den beiden Gefangenen draußen wartete, ging ich hinein. Es war um die Mittagszeit. Ich klopfte gegen die Tür von O'Learys Büro, und ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten öffnete ich die Tür.
»Hallo, Duncan. Wir bringen Nachschub.«
O'Leary erhob sich. Er war mittelgroß. Wolf streckte sich, gähnte, kam zu mir und drängte sich gegen mein Bein. Ich kraulte den Hund zwischen den Ohren.
»Hi, Logan. Wen bringt ihr denn dieses Mal?«, fragte der Sheriff.
Ich nannte die Namen der beiden Banditen. Vor mir hielt O'Leary an. »Vor drei Tagen brachte ein Kopfgeldjäger Matt Dexter; tot.« Duncan verzog das Gesicht. »Ich glaube, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Logan.«
»Spann mich nicht auf die Folter.«
»Ehe Dexter starb, gestand er den Mord an Bruce Swanson und dessen Ehefrau.«
»Was?« Ich war wie vor den Kopf gestoßen.
O'Leary nickte. »Du hast richtig gehört. Ich habe nach John Woods Angaben einen Bericht geschrieben und ihn dem Richter vorgelegt. Es sieht so aus, als wäre mit Clint Anderson ein Unschuldiger gehängt worden.«
Einen Moment war ich wie betäubt. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen und griff mir an den Kopf. »Aber Anderson ritt doch den Fuchs, von dem Swanson gesprochen hat, ehe er starb, und er hatte Swansons Uhr.«
»Ich kann dir nicht mehr sagen, Logan. Am besten, du sprichst mit dem Richter.«
Der Gedanke, einen Unschuldigen an den Galgen gebracht zu haben, drohte mich zu erdrücken. Nachdem wir die beiden Gefangenen dem Sheriff übergeben hatten, brachten wir die Pferde in den Stall und versorgten sie. Ich erzählte Joe, was ich von O'Leary erfahren hatte. Joe hörte schweigend zu, und als ich geendet hatte, knurrte er. »Sicher nicht der erste Unschuldige, der gehängt wurde. Dennoch wäre es tragisch.«
Ich begab mich zu Richter Humphrey. Er forderte mich auf, Platz zu nehmen, und ich setzte mich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »O'Leary hat mich schon aufgeklärt«, sagte ich.
Der Richter blickte ernst drein. »Es sieht ganz so aus, als wäre Clint Anderson einem Justizirrtum zum Opfer gefallen.«
Ich senkte den Kopf. Die Worte trafen mich bis in den Kern. Das Herz drohte mir in der Brust zu zerspringen. Es überstieg mein Begriffsvermögen. Eine Bruchteile von Sekunden andauernde Blutleere im Gehirn ließ mich schwindlig werden. Ich biss die Zähne zusammen, dass es schmerzte.
Der Richter erhob wieder die Stimme und sagte: »Anderson beteuerte, dass er auf die Farm kam, als diese schon brannte. Im Hof lag der Farmer und er erkannte, dass dem Mann nicht mehr zu helfen war. Er raubte ihm die Uhr und ein paar Dollar, die Swanson in der Tasche hatte und ritt weiter. So war es wohl auch. Es tut mir leid, Logan.«
»Ich – ich habe einen Unschuldigen dem Henker überantwortet«, presste ich hervor. Eine Welt brach für mich zusammen. Ich versuchte, mich in Andersons Lage zu versetzen, als ihm der Henker den Strick um den Hals legte und dann den schwarzen Sack über den Kopf zog. Wie mochte dem Mann zumute gewesen sein – wusste er doch, dass er unschuldig gehängt wurde.
Heiß stieg es in mir in die Höhe.
»Alles sprach gegen ihn«, antwortete der Richter. »Sie haben sich nichts vorzuwerfen, Logan. Er hatte die Uhr des ermordeten Farmers, und Sie haben ihn wegen des Verdachts verhaftet, das Ehepaar getötet zu haben. Unter den Galgen habe ich ihn geschickt.«
»Aufgrund der Beweise, die ich dem Gericht lieferte«, murmelte ich. Es gelang mir nicht, den Aufruhr in meinem Innern unter Kontrolle zu bringen. Der Gedanke setzte mir zu. Du hast Anderson auf dem Gewissen!, durchrann es mich und ich spürte Gänsehaut.
»Sie kommen sicher darüber hinweg, Logan«, sagte der Richter. »Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ich werde Anderson in einem neuen Prozess rehabilitieren.«
»Was hat er davon?«, murmelte ich. »Er ist tot.« Ich erhob mich und taumelte aus dem Büro des Richters. Ich war erschüttert. Der Gedanke an Anderson ließ mich nicht mehr los. Wie in Trance ging ich in die Unterkunft, legte mich auf das Bett und verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
Joe kam. »Was sagt der Richter?«
»Ich habe einen Unschuldigen an den Galgen gebracht«, sagte ich mit lahmer Stimme. »Es ist definitiv. Clint Anderson hat zwar einen Raub begangen, aber das ist kein todeswürdiges Verbrechen. O verdammt! Das hätte nicht geschehen dürfen.«
»Sicher«, murmelte Joe, »es ist schwer für dich. Aber du musst darüber hinwegkommen. Du hast deinen Job nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Du hast dir nichts vorzuwerfen.«
Ich sah das anders. Nach einer Stunde, in denen mich Selbstvorwürfe quälten, fasste ich einen Entschluss. Mit dieser Schuld auf dem Gewissen konnte und wollte ich nicht länger den Stern tragen. Eine schwere Entscheidung – aber ich hatte sie mir reiflich überlegt.
Ich begab mich in das Büro von Richter Humphrey. Der Richter musterte mich prüfend. Ich nahm den Stern von meiner Weste und legte ihn auf den Schreibtisch. »Es tut mir leid, Sir, aber unter diesen Umständen kann ich nicht länger den Stern tragen. Ich habe versagt. Und darum gebe ich den Stern zurück.«
Humphrey schaute zunächst fassungslos drein. Dann fragte er: »Haben Sie sich das gut überlegt, Logan? Sie sind nicht schuld am Tod von Anderson. Es wären unglückliche Umstände ...«
»Ich fühle mich schuldig, Sir. Und wenn ich in Amarillo bleibe ...« Ich brach ab und zuckte mit den Schultern.
»Ich würde es sehr bedauern, Logan.«
»Ich habe mich entschieden, Sir.«
»Nun, Logan, ich kann Sie nicht zwingen, weiterhin den Stern zu tragen. Was werden Sie tun?«
»Ich weiß es noch nicht, Sir.«
Der Richter erhob sich und reichte mir die Hand. Ich ergriff sie, Humphrey sagte: »Finden Sie wieder zu sich, Logan, und wenn Sie eines Tages zurückkommen sollten, stehen Ihnen sämtliche Türen offen. Ich will nicht versuchen, Sie zu halten. Ein Mann muss den Weg gehen, den er für den richtigen hält. Aber die Zeit heilt Wunden, Logan. Und Sie werden darüber hinwegkommen.«
Ich kehrte in die Unterkunft zurück und packte meine wenigen Habseligkeiten in die Satteltaschen. Eine Weile schaute Joe mir schweigend zu, dann fragte er: »Was soll das werden, Logan-Amigo?«
»Ich verlasse den Panhandle.«
»Ich dachte es mir fast, als ich dich ohne den Stern zurückkommen sah. Lässt dich der Richter einfach so gehen?«
»Mein Entschluss ist unumstößlich.«
»Dann kann ich dich wohl auch nicht bewegen, zu bleiben?«
»Tut mir leid, Joe. Wenn ich hier bleibe, werde ich ständig daran erinnert, dass ich einen Unschuldigen an den Galgen gebracht habe.«
»Dieses Wissen wird dich an jeden Ort begleiten – wohin du dich auch wendest. Du schüttelst es nicht ab, indem du aus der Gegend verschwindest. Es ist unmöglich, seiner Vergangenheit davonzulaufen. Man muss sich ihr stellen.«
»Ich brauche Zeit ...«
Eine halbe Stunde später ritt ich.
»Lass von dir hören«, sagte Joe zum Abschied. »Und – halt die Ohren steif, Amigo. Gebe Gott, dass sich unsere Wege wieder einmal kreuzen.«
Gott hat auch nicht verhindert, dass ich einen Unschuldigen dem Henker überantwortete, durchfuhr es mich. Der Abschied von Joe fiel mir schwer. Wir waren in den Jahren, in denen wir Steigbügel an Steigbügel geritten waren, die besten Freunde geworden.
Ich schaute mich nicht mehr um. Nachdem ich die Stadt verlassen hatte, schlug ich den Weg zum Mulberry Creek ein. Zwei Tage später kam ich auf Horseshoe Ranch Janes Carters an. Es war Nachmittag. Die Sonne schien warm, am Himmel trällerte eine Lerche. In einem Corral tummelten sich an die hundert Pferde. Auf der Bank vor dem Haupthaus saß Lionel Hastings, Janes Vater, und rauchte Pfeife. Lonny, der Sohn von Jane, spielte im Hof.
Ich ritt in den Ranchhof. Lonny sah mich, sprang auf und lief mir entgegen. »Logan!«, schrie er mit heller Kinderstimme. Ich stieg vom Pferd und fing den Kleinen auf, wirbelte ihn ihm Kreis herum und sagte: »Hallo, Großer! Ich hoffe, du hast gut auf deine Mutter aufgepasst, während ich weg war.«
Der Knabe lachte. Ich stellte ihn auf den Boden, nahm den Buben bei der Hand und das Pferd am Zaumzeug und ging langsam weiter. In der Tür des Ranchhauses erschien Jane. Sie war schön und begehrenswert. Aus einem der Schuppen kam ein Cowboy. Es war Dooley, der auf der Ranch so etwas wie die Stellung eines Vormannes einnahm.
Lionel, der Oldtimer, hatte sich erhoben. »Hallo, Logan. Ich kann es dir geradezu von der Nasenspitze ablesen, dass etwas nicht stimmt. Wo ist dein Stern? He, was ist geschehen?«
»Keine schöne Geschichte«, erwiderte ich, dann ließ ich den Jungen und das Pferd los und ging auf Jane zu, die mir entgegenkam. Ich nahm sie in die Arme. Ein Gefühl der Wärme durchrann mich.
Jane sagte: »Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist lange her ...«
»Du brauchst nicht länger auf mich zu warten, Jane«, murmelte ich und spürte, wie sie in meinen Armen versteifte. »Ich bin auf dem Weg aus dem Land. Den Stern habe ich zurückgegeben.«
Ein trockener Laut entrang sich ihr. Ein Beben lief durch ihre Gestalt. »Komm herein, Logan. Ich schätze, du bist mir eine Erklärung schuldig.« Ihre Stimme klang belegt und fremd.
Wir gingen ins Haus. Lionel folgte uns. Lonny war draußen geblieben. Wir setzten uns an den Tisch. Ich formulierte meine nächsten Worte im Kopf, dann sagte ich: »Durch meine Schuld ist ein Mann gestorben. Nach diesem Vorfall kann ich nicht länger den Stern tragen. Ich will auch nicht in diesem Landstrich bleiben, denn hier würde ich ständig daran erinnert. Ich muss versuchen, Abstand zu gewinnen.«
»Erzähl uns deine Geschichte, Logan«, murmelte Lionel und saugte nervös an seiner Pfeife.
Jane starrte mich entsetzt an. Auf dem Grund ihrer Augen las ich Angst.
Ich berichtete. Als ich geendet hatte, sagte der Oldtimer: »Ich kann mir denken, wie es in dir aussieht, Logan. Aber du solltest dich deshalb nicht selbst zerfleischen. Du hast einen Mann vor Gericht gebracht, der verdächtig war, in Farmerehepaar ermordet zu haben. Die Jury sprach ihn schuldig, der Richter verurteilte ihn zum Tode. Sicher, du hast dem Gericht die vermeintlichen Beweise präsentiert. Aber meinst du nicht auch, dass es eine Verkettung unglücklicher Umstände war ...«
»Mit dem Stern an der Brust habe ich Unrecht begangen. Es hat einem Menschen das Leben gekostet. Ich habe alles getan, um Anderson zwei Morde nachzuweisen, die er tatsächlich nicht begangen hat. Mit meiner Arbeit habe ich ihn dem Henker ausgeliefert. Ich kann den Stern nicht länger tragen.«
»Warum bleibst du nicht hier?«, fragte Jane mit gepresster Stimme. »Hier wäre ein Platz für dich, und das weißt du. Du hast mich einmal gefragt, ob ich deine Frau werden will. Ich ...«
»Du musst mir Zeit geben, Jane. Ich muss versuchen, darüber hinwegzukommen. Hier kann ich das nicht.«
»Du willst also wieder ruhelos über die Hügel ziehen und das Leben fortsetzen, das du aufgegeben hast, als du in den Panhandle kamst?«
Ich schwieg.
Ihr Gesicht verschloss sich. Hart sagte sie: »Ich habe viele Jahre auf dich gewartet, Logan. Irgendwann aber hat das Warten ein Ende. Ich denke, du verstehst das.«
»Ich habe volles Verständnis für deine Entscheidung, Jane. Bitte, verzeih mir.«
»O verdammt!«, entfuhr es Lionel Hastings. »Warum ist das Schicksal so unerbittlich?« Er erhob sich und ging nach draußen.
»Es ist dein Entschluss, Logan«, sagte Jane leise. »Ich bedauere es zwar, aber ich werde nicht versuchen, dich umzustimmen.«
Ihre Augen glitzerten feucht.
*
Drei Wochen später erreichte ich Sanderson. Mexiko war nur noch zwanzig Meilen entfernt. Der Mietstall war ein zugiger Bretterverschlag. Das Tor stand offen. Rund um die Stadt war Wildnis. Im Wagen- und Abstellhof stieg ich vom Pferd. Ich fühlte mich ziemlich steif. Innerlich war ich etwas zur Ruhe gekommen. Ich musste mit dem Gedanken leben, dass meinetwegen ein Unschuldiger gehängt worden war.
Es ging auf den Abend zu. Mein Pferd und ich waren verstaubt. Hinter uns lag Felswüste, in der nur Klapperschlangen und Skorpione ihr Unwesen trieben. Die Tage waren heiß, und die Abende brachten kaum Linderung.
Im Tor erschien der Stallmann. Er war noch jung, höchstens zwanzig Jahre. Die Hände hatte er in den Taschen seiner Latzhose vergraben. Ein spärlicher, flaumartiger Bart bedeckte sein Kinn und seine Wangen. Ich nahm das Pferd am Kopfgeschirr und ging ihm entgegen. »Hallo, Fremder«, sagte er.
»Hallo, Stall«, erwiderte ich den Gruß.
»Werden Sie länger in Sanderson bleiben?«
»Das kommt drauf an.«
Der Stallbursche übernahm das Pferd. Ich ging zu einem Tränketrog, kniete davor nieder und wusch mir Staub und Schweiß aus dem Gesicht. Mit dem Halstuch trocknete ich mich ab und ging in den Stall, in den der junge Mann mein Pferd in der Zwischenzeit geführt hatte. Er öffnete gerade den Bauchgurt. »Worauf kommt es an?«, fragte er neugierig.
»Ob ich hier einen Job finde.«
»Ah, Sie suchen Arbeit, Fremder. Welche Art von Arbeit soll es denn sein?« Er schielte auf meinen Revolver, den ich am rechten Oberschenkel trug und der ziemlich tief saß.
»Weidearbeit«, versetzte ich. »Ich habe in meiner Jugend als Cowboy gearbeitet und mit in wenig Übung lerne ich es sicher wieder, den Lasso zu schwingen.«
Das war so. Ich war auf einer Ranch am Nueces River groß geworden und musste frühzeitig mit zupacken.
Der Stallbursche richtete sich auf, maß mich von oben bis unten und sagte dann: »Sie sehen nicht aus wie ein Cowboy, Fremder. Aber versuchen Sie es mal auf der Hells Half Ranch von Big Jack Brewster. Der sucht immer Leute. Die Ranch liegt am San Francisco Creek, zwanzig Meilen südlich von hier.«
»Ist es eine große Ranch?«
»Die größte im weiten Umkreis.«
»Ich werde der Ranch einen Besuch abstatten«, sagte ich, zog die Winchester aus dem Holster, schnallte die Satteltaschen ab, legte sie mir auf die Schulter und verließ den Mietstall. Nachdem ich mir im Hotel für die Nacht ein Zimmer gemietet hatte und meine Satteltaschen dort hinterlegt hatte, machte ich mich auf den Weg zum Saloon. Die Abenddämmerung schlich sich in die Stadt. Ein Stück von mir entfernt zog ein Mann eine zweirädrige Karre, die mit Heu beladen war, die Straße hinunter. Ein Hund strich heran und beobachtete mich mit feuchtglänzenden Augen. Ich strich ihm über den Kopf. Das Tier fiepte leise. Wenig später betrat ich den Saloon. An einem Tisch saßen zwei Männer. Sie starrten mich an. Ich setzte mich, der Keeper kam, ich bestellte mir ein Bier und etwas zu essen. Dann drehte ich mir eine Zigarette und rauchte.
Auf dem Vorbau erklangen Schritte. Über den geschwungenen Rändern der Pendeltür wurden Kopf und Schultern eines Mannes sichtbar. Er kam in den Schankraum. Er war etwa vierzig Jahre, bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd sowie einer braunen Weste, an der ein Stern befestigt war. Den Revolver trug er links.
Der Sheriff schaute zu den beiden anderen Gästen hin, tippte an die Krempe seines Hutes, dann kam er zu meinem Tisch, baute sich hinter einem Stuhl auf und legte beide Hände auf die Lehne. »Ich sah Sie am Office vorbeigehen, Fremder.«
»Ich kam vor einer guten halben Stunde in die Stadt.«
»Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, jedem Fremden einen etwas intensiveren Blick unter den Hutrand zu werfen«, erklärte der Sheriff. »Das kann nie schaden und verhindert vielleicht Ärger. Sie sind auf dem Weg nach Süden?«
»Mein Name ist Bill Logan«, stellte ich mich vor. »Ich reite kreuz und quer durchs Land. Der Stallmann hat mir erzählt, dass ich auf der Hells Half Ranch vielleicht eine Job finde. Ich werde morgen zum San Francisco Creek reiten und nachfragen.«
Das Gesicht des Sheriffs verschloss sich. »Ich dulde in Sanderson keinen Ärger«, warnte er.
»Ich habe nicht vor, Ihnen Ärger zu bereiten.«
Der Sheriff schien sich jeden Zug meines Gesichts einzuprägen. Plötzlich nickte er. »Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in unserer Stadt, Logan.« Dann schwang er herum und entfernte sich, verließ den Saloon und hinter ihm schlugen wild die Flügel der Schwingtür. Seine Schritte verhallten.
Nach zehn Minuten kam mein Essen. Ich aß mit gesundem Appetit, danach rauchte ich noch eine Zigarette, bezahlte meine Zeche und beschloss, das Hotel aufzusuchen. Drei Wochen auf dem Pferderücken steckten mir in den Knochen, und ich wollte nur noch flach liegen und ausruhen.
Als ich mich dem Sheriff's Office näherte, trat der Gesetzeshüter ins Freie. Er stellte sich mir in den Weg. »Ich habe nachgesehen, Logan. Es gibt keinen Steckbrief von Ihnen. Aber das hat nichts zu sagen. Nach dem, was ich von Ihnen weiß, sind Sie ein Satteltramp. Wenn Sie mir Ärger machen, sperre ich Sie ein. Mein Wort drauf.«
»Haben Sie persönlich etwas gegen mich, Sheriff? Gefällt Ihnen mein Gesicht nicht?«
»Ich kann Ihre Sorte einschätzen. Sie nimmt jede Herausforderung an und geht keinem Streit aus dem Weg. Nach Mexiko ist es nicht mehr weit. Im Grenzgebiet treibt sich viel Gesindel herum – Kerle, die schnell über die Grenze verschwinden, wenn es notwendig wird, weil ihnen das Gesetz zu eng auf den Leib rückt.«
»Zu dieser Sorte gehöre ich nicht, Sheriff«, versicherte ich. »Ich suche einen Job. Mexiko reizt mich nicht.«
Der Gesetzeshüter gab den Weg frei ...
*
Als die Sonne aufging und ihr erstes Licht über das Land schickte, ging ich zum Mietstall. Der Stallbursche war schon bei der Arbeit. Er spießte mit einer Forke Pferdemist aus einer Box und lud ihn in eine hölzerne Schubkarre. Jetzt lehnte er die Mistgabel weg, wischte sich die Hände an der Hose ab, dann kam er näher. »Sie sind aber bald auf den Beinen, Mister.«
Ich lächelte. »Frühaufsteher.«
Auch der Bursche grinste. Dann half er mir, das Pferd zu satteln und zu zäumen. »Haben Sie Bekanntschaft mit Jesse Linhardt gemacht?«, fragte er.
»Wenn das der Sheriff ist – ja.«
»Ein scharfer Hund.«
»Sicher ein guter Sheriff.«
»Die Cowboys der Umgebung respektieren ihn. Und das will was heißen. Den Burschen ist sonst nichts heilig.«
»Männer wie Linhardt braucht das Land«, murmelte ich versonnen und verspürte einen Stich in der Brust. Und einen Moment fühlte ich mich wie ein Verräter an Richter Humphrey und meinen Kollegen, die oben im Panhandle einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die Gesetzlosigkeit führten. Mit Wehmut dachte ich daran, dass ich bis vor drei Wochen auch einen Stern trug – das Symbol des Gesetzes, dem ich persönliche Belange unterordnete.
Ich verdrängte diese Gedanken, führte das fertig gesattelte und gezäumte Pferd aus dem Stall und saß auf. Dann verließ ich die Stadt. Der Sheriff lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen an einer Hausecke und beobachtete mich. Sein Gesicht lag im Schatten der Hutkrempe.
Die Hufe meines Pferdes rissen kleine Staubfontänen in die klare Morgenluft. Ich ritt durch den Creek, der südlich der Stadt von Westen nach Süden verlief. Das Wasser reichte dem Pferd gerade mal bis zu den Sprunggelenken. Es gischtete und spritzte. Zwischen dem Geröll auf dem Flussgrund schossen schattenhaft die Forellen hin und her.
Es wurde heiß. Stechmücken, angezogen vom süßlichen Schweißgeruch, piesackten mich und das Pferd. Bald verschwammen die Konturen der Hügel und Felsen in der flirrenden Luft. Es gab keinen Weg. Ich ritt querfeldein. Hüfthohes, dorniges Gestrüpp und verdorrtes Gras bildeten die Vegetation. Dieses Land hier unten im Süden war nicht zu vergleichen mit dem Panhandle, wo es saftige Weiden gab und riesigen Rinderherden ausreichend Nahrung bot. Das karge, zerklüftete Land ringsum war von der unablässig sengenden Sonne verbrannt, tot, und glich mit seinen ruinenähnlichen Felstürmen und -monumenten einem riesigen Trümmerfeld.
Doch je näher ich dem San Francisco Creek kam, umso grüner wurde das Land. Hier wuchsen auch Büsche und Bäume und bald stieß ich auf erste Rudel von Longhorns. Ich ritt zu einem dieser Rudel hin und studierte das Brandzeichen. Es handelte sich um zwei nebeneinander stehende H's. Ich befand mich also auf dem Gebiet der Hells Half Ranch.
Das Pferd trug mich weiter in südliche Richtung. Da trieben drei Reiter ihre Pferde auf eine Hügelkuppe, rissen die Pferde in den Stand und blickten in meine Richtung. Jetzt setzten sie die Tiere wieder in Bewegung, lenkten sie den Abhang hinunter und näherten sich mir. Ich parierte meinen Vierbeiner und erwartete die drei. Es waren Cowboys. Sie zügelten ihre Pferde, der mittlere Reiter legte die Hände übereinander auf das Sattelhorn und sagte: »Du befindest dich auf dem Weideland der Hells Half Ranch.«
»Die Ranch ist mein Ziel«, versetzte ich. »Der Stallmann in Sanderson meinte, dass mir Big Jack vielleicht einen Job gibt.«
»Ah, du suchst eine Arbeit.«
»Ja.«
»Gut. Du musst dich mehr nach Südosten halten.« Der Bursche grinste. »Vielleicht werden wir Kollegen.«
»Drückt mir die Daumen, Jungs«, versetzte ich, dann ritt ich weiter. Nach einer Stunde erreichte ich die Ranch. Das Haupthaus war stöckig und besaß eine große Veranda, die überdacht war. Das Dach wurde als Balkon genutzt und war von einer kunstvoll geschnitzten Balustrade eingerahmt. Eine Außentreppe führte in den Hof. Es gab Ställe, Schuppen und Scheunen, eine Remise, in der einige Fuhrwerke standen, zwei Corrals, in denen sich wohl an die hundert Pferde befanden. Das Windrad beim Brunnen bewegte sich träge und knarrte leise.
Die Ranch verriet den Wohlstand seines Besitzers. Ranchhelfer waren bei der Arbeit. Im Ranchhof pickten Hühner in den Staub auf der Suche nach Fressbarem. Ein Hahn krähte einige Male. Aus seiner Hütte schoss ein Schäferhund und bellte drohend. Die Kette, die ihn hielt, rasselte.
Ich ritt bis zum Haupthaus. Die Rancharbeiter hielten in ihrer Arbeit inne und beobachteten mich. Beim Holm saß ich ab, band mein Pferd an und stieg auf den Vorbau. Da wurde ich angerufen: »Hallo, Fremder! Zu wem wollen Sie denn?«
Ich blieb stehen und drehte den Kopf. Aus einem kleinen Gebäude war ein großer Mann getreten. Er war hemdsärmlig und barhäuptig. Seine Haare waren dunkel. Ich schätzte sein Alter auf Anfang der dreißig.
»Ich suche einen Job«, erwiderte ich. Dann nannte ich meinen Namen. Mit den Worten »in Sanderson sagte man mir, dass Big Jack immer Leute sucht« endete ich.
»Ich bin Vormann Bill Conrad«, stellte sich der Bursche vor. Dann nickte er einige Male. »Es ist richtig. Wir suchen immer gute Leute. Kannst du mit Rindern umgehen?«
»Ich bin auf einer Ranch aufgewachsen.«
»Kannst du auch schießen?«
»Ist das notwendig?«
Der Vormann war nähergekommen. Ohne auf meine Frage einzugehen, sagte er: »Big Jack ist drin.« Er wies mit dem Kinn auf die Haustür und stieg auf die Veranda. Ohne anzuklopfen öffnete er die Tür und ging hinein. »Kommen Sie.«
Ich betrat die Halle der Ranch. Sie war als Wohnraum eingerichtet. Schwere Plüschsessel und ein kunstvoll geschnitzter Tisch nahmen die Raummitte ein. An den Wänden hingen Bilder und alte Waffen. Ein Mann Mitte der vierzig, dessen Haare sich bereits grau zu verfärben begannen, saß an einem kleinen Tisch vor einem Schachbrett. Jetzt hob er das Gesicht. Sein fragender Blick richtete sich auf mich.
»Tragen Sie Ihr Anliegen vor«, forderte mich der Vormann auf, ging zu einem der Sessel und ließ sich hineinfallen.
Ich machte mir ein Bild von dem Rancher, dem man den Beinamen Big verliehen hatte. Eine bemerkenswerte Erscheinung, die ein hohes Maß an natürlicher Autorität verströmte. Das war ein Mann, der seinem Willen Geltung verschaffte.
Ich stellte mich vor, dann sagte ich: »Ich komme von Norden herunter und suche hier im Süden einen Job als Weidereiter.«
»Haben Sie schon als Cowboy gearbeitet?«
»Ich wuchs auf einer Ranch auf.«
»Können Sie mit der Waffe umgehen?«
»Ich denke schon. Es reicht, um Wölfe und anderes Wildzeug von den Rindern fernzuhalten.«
Der Rancher und sein Vormann wechselten einen Blick. Dann sagte Big Jack: »Ich suche Männer, die bereit sind, mit Bill nach Mexiko zu reiten und eine Herde abzuholen, die ich dort unten gekauft habe. Es handelt sich um fünfzehnhundert Tiere. Drei Treiber habe ich bereits angeheuert. Sechs Mann brauchen wir. Haben Sie Interesse?«
»Sicher, es ist ein Weidereiter-Job.«
»Das Gebiet, durch das ihr die Rinder treiben müsst, kontrolliert Ernesto Esteban mit seinen Bandoleros. Darum meine Frage, ob Sie schießen können. Es ist nicht auszuschließen, dass die Bravados versuchen, euch die Herde abzujagen.«
»Meine Schießkunst reicht aus, um sowohl vierbeiniges als auch zweibeiniges Raubzeug zu verscheuchen«, sagte ich.
»Dann sind Sie unser Mann«, sagte Big Jack. »Ich zahle fünfzig Dollar Treiberlohn. Wenn Sie sich gut anstellen, können Sie nach dem Viehtrieb auf der Ranch bleiben. Der Lohn für einen Cowboy beträgt dreißig Dollar im Monat. Kost und Unterkunft sind frei.«
»Das ist in Ordnung«, sagte ich.
*
Man wies mir einen Platz in der Mannschaftsunterkunft zu. Meine Satteltaschen packte ich nicht aus. Sobald die Treibermannschaft vollzählig war, sollten wir aufbrechen. Die drei Männer, die Big Jack bereits angeheuert hatte, waren düstere, wortkarge Typen. Es war Abend. In der Mannschaftsunterkunft brannten zwei Laternen, die an dünnen Ketten von der Decke hingen. Ich lag auf meiner Bunk und hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Am Tisch saßen vier Rancharbeiter und pokerten. Ein Cowboy saß auf der Bettkante und putzte seine Stiefel. Die drei Kerle, die zur Treibermannschaft gehörten, lümmelten herum wie ich.
Draußen wurden Hufschläge laut. Ein Pferd wieherte. Stimmen waren zu hören. Dann verstummten die Hufgeräusche. Etwa eine Viertelstunde verging, dann betraten drei Männer das Bunkhouse. Das düstere Licht legte dunkle Schatten in ihre Gesichter und ließ die Linien und Furchen darin tiefer erscheinen.
Ich richtete mich auf und setzte mich auf die Bettkante. Bei den drei Kerlen handelte es sich um Cowboys. Das erkannte ich an ihrer Kleidung. Einer von ihnen war wohl eins neunzig groß und hager. Der andere war mittelgroß und drahtig. Der dritte war ein Bulle. Die Muskeln an seinen Schultern und Oberarmen drohten das Hemd zu sprengen. Er besaß einen kantigen Schädel, der auf einem kurzen, dicken Hals saß. Dieser Bursche konnte sicher mit einem einzigen Schlag seiner Faust ein Longhorn von den Beinen holen.
Sie gingen zu ihren Bunks, legten die Gewehre und Satteltaschen ab, der Blick des Hageren richtete sich auf mich. »Bist neu hier, wie?«
»Das ist wohl so«, versetzte ich.
»Wofür bist du eingestellt? Um den Lasso oder den Revolver zu schwingen?«
»Den Lasso«, erwiderte ich.
Der Stiernackige kam heran und stemmte beide Arme in die Seiten. »Wie ist dein Name?«
Der Bursche gefiel mir nicht. »Bill Logan«, antwortete ich. »Ich komme aus dem Panhandle.«
»Was hat dich in den Süden verschlagen?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Der Wind des Schicksals vielleicht. Ich weiß es nicht. Als ich oben im Norden losritt, hatte ich kein Ziel vor Augen. Ich überließ es meinem Pferd, eine Richtung einzuschlagen.«
»Dann bist du ein Sattelstrolch, der eine Zickzack-Linie durchs Land zieht.«
»Warum willst du mich beleidigen?«, fragte ich.
Der Hagere sagte: »Das ist so hier. Entweder man frisst Curly Moorcock aus der Hand, oder er zerbricht einen. Wir hier fressen ihm alle aus der Hand. Und wenn Curly sagt, dass du ein Sattelstrolch bist, dann solltest du das schlucken, Logan. Es wäre eine Art falscher Stolz ...«
»Nun«, sagte ich, »mögt ihr Curly Moorcock aus der Hand fressen. Ich werde es nicht tun.« Ich schaute den vierschrötigen Burschen an. »Ob es dir gefällt oder nicht, Curly: Befehle nehme ich nur vom Vormann und vom Boss entgegen, und beleidigen lasse ich mich von niemand.«
Mir war klar, dass ich mich hier durchsetzen musste.
Ein gefährliches Grollen stieg aus der Kehle des Burschen. Es hörte sich an wie das Knurren einer wütenden Dogge. »Ich denke, du bist ein großmäuliger Hurensohn!«, grunzte Curly dann. »Man hat dich wohl noch nicht auf deine richtige Größe zurechtgestutzt, wie?«
»Ich will keinen Streit«, sagte ich laut und deutlich.
»Erst forderst du mich heraus, und dann willst du kneifen?«
Um ein Haar hätte ich aufgelacht. Es klang wie Hohn in meinen Ohren. Curly stierte mich an. Sein Gesicht hatte sich verkniffen. Er war auf Konfrontation aus. Curly gehörte zu der Sorte, die über andere dominieren wollte.
»Ich glaube, du verwechselst hier etwas«, sagte ich.
»Feigling.«
»Du willst es wohl unbedingt wissen?«, fragte ich und unterwarf mich damit den rauen Regeln, die oftmals innerhalb solcher Mannschaften herrschten. Es gab eine Hierarchie. Innerhalb der Crew bestimmte derjenige, den die anderen fürchteten. Der verteidigte und festigte seinen Platz, indem er immer aufs Neue unter Beweis stellte, dass er der Stärkste war.
Auf dieser Ranch war das Curly Moorcock.
»Gehen wir hinaus«, schlug Curly vor. »Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du auf dem Bauch in die Unterkunft zurückkriechen.«
»Was werden Big Jack und der Vormann dazu sagen?«
Jetzt war es der mittelgroße Drahtige, der antwortete: »Denen ist es egal, so lange die Arbeit nicht drunter leidet.«
»Ich wette darauf, dass Curly den Kampf gewinnt!«, rief einer der Rancharbeiter. »Wer hält dagegen?«
Niemand meldete sich. Keiner gab mir eine Chance.
Seufzend setzte ich mich in Bewegung. Mir war klar, worauf ich mich einließ. Wahrscheinlich stand mit der härteste Faustkampf meines Lebens bevor. Aber wenn ich jetzt kniff, dann war ich bei den Männern auf der Ranch unten durch. Auf der Hells Half Ranch würde kein Hund mehr von mir ein Stück Brot annehmen. Die Männer folgten uns. Für sie war es eine willkommene Abwechslung.
Ich ging bis zur Hofmitte und wandte mich dann Curly zu. Der blieb zwei Schritte vor mir stehen. »Ich werde dich jetzt in Stücke schlagen, Logan. Du hast es dir selber zuzuschreiben.«
»Dann komm nur«, versetzte ich grollend. »Bringen wir es hinter uns. Grundsätzlich denke ich zwar, dass wir über das Alter hinaus sind, in dem man sich balgt wie ein paar Schulbuben – aber wahrscheinlich bist du mit fünfzehn in deiner geistigen Entwicklung stehen geblieben. Anders kann ich mir dein Verhalten ...«
Er stürmte los und wollte mich mit diesem Ansturm von den Beinen fegen. Ich glitt behände einen halben Schritt zur Seite und er konnte seinen wütenden Angriff nicht mehr stoppen. Curly lief ins Leere und ich stellte ihm ein Bein. Aufbrüllend stürzte er. Ich wandte mich ihm zu. Er kam auf alle Viere hoch. Ein Schritt brachte mich an ihn heran, und ich knallte ihm erst die linke, dann die rechte Faust gegen den Kopf.
Trotz meiner gewiss sehr harten Schläge kam Curly hoch. Meine Hände schmerzten. Es war, als hätte ich gegen Eichenholz geschlagen. Der Kerl schüttelte sich nur ...
*
Curly stampfte mit schwingenden Armen auf mich zu. Obwohl es dunkel war, konnte ich sehen, dass sich sein Gesicht böse verzerrt hatte. Seine Augen glitzerten.
Ich erwartete ihn. Er schlug nach mir. Ich duckte mich und seine Faust radierte über meinen Schädel hinweg. Seine Linke kam von der Seite. Ich warf mich nach vorn und rammte ihm die Schulter in den Leib. Gleichzeitig landete meine Rechte in seinem Gesicht. Ich hörte Curly stöhnen und sprang zurück. Sein Uppercut ging ins Leere. Er wurde von dem Schlag nach vorne gerissen und ich nahm die Chance, die sich mir bot, wahr. Er lief genau in meine kerzengerade Rechte hinein. Sie stoppte ihn, als wäre er gegen eine unsichtbare Mauer gerannt.
Gegen diesen Burschen konnte ich mich nur mit Schnelligkeit und klarem Kopf behaupten. Er war ein blindwütiger Schläger, brutal, kompromisslos, voll Vernichtungswillen und von einer fast krankhaften Selbstsicherheit. Wo er hinschlug, wuchs kein Gras mehr – wenn er traf. Darum war mein ganzes Sinnen darauf ausgerichtet, seinen Schlägen auszuweichen. Ich war durch eine harte Schule gegangen – und das zahlte sich nun aus.
Ich hatte die Fäuste erhoben und wartete. Meine ganze Konzentration richtete sich auf den Schläger. Er schien benommen zu sein. Mit hängenden Armen stand er da, seine Hände öffneten und schlossen sich. Aus seiner Nase rann Blut. Das war in dem Licht, das aus den Fenstern der Mannschaftsunterkunft und des Haupthauses fiel, deutlich zu sehen.
Plötzlich schien Curly zu explodieren. Mit wirbelnden Armen griff er an. Mit einem einzigen dieser Heumacher hätte er mir wohl den Kopf von den Schultern geschlagen. Ich wich zurück. Curly folgte mir. Unvermittelt stieß er sich ab und warf mich mit ausgebreiteten Armen auf mich. Ich landete zwei Körpertreffer, dann umklammerte er mich. Meine Arme wurden gegen den Leib gepresst. Sein Kopfstoß traf mich gegen die Stirn und die Welt schien vor meinen Augen in einem Flammenmeer unterzugehen. Die Luft wurde mir knapp. Der heiße Atem des Schlägers schlug mir ins Gesicht. Ich überwand meine Not und sah wieder einigermaßen klar. Das verzerrte Gesicht war dicht vor mir.
»Ich zerquetsche dich wie eine Laus!«, keuchte Curly.
Ich entspannte mich. Einen Moment hatte ich das Gefühl, dass die Umklammerung ein wenig nachließ. Dann spannte ich meine Muskeln an und drückte meine Arme auseinander. So gelang es mir, die Umklammerung zu sprengen. Aber Curly schlug sofort nach mir und trat mich an der Schulter. Mein Arm war schlagartig wie taub. Ich trat rasch zwei Schritte zurück und Curlys nächster Schlag verpuffte wirkungslos.
Ich begann den Schläger zu umrunden. So gewann ich Zeit und der Schmerz in meiner Schulter legte sich. Curly drehte sich auf der Stelle, tapsig wie ein Tanzbär. Unvermittelt machte ich einen Ausfallschritt, fintierte mit der Linken, und als er seine Arme zur Deckung hochriss, hämmerte ich ihm die Rechte in den Leib. Er krümmte sich nach vorn. Und jetzt schlug ich ihm die Linke von der Seite gegen das Kinn. Er wurde halb herumgerissen.
»Verdammt, Curly, was ist los mit dir?«, schrie einer der Zuschauer.
»Ich kriege ihn schon!«, brummte Curly und griff seinerseits an. Er trat nach mir. Die Gesetze der Fairness waren ihm fremd. Ich glitt zur Seite und sein Tritt verfehlte mich. Seine Hände, mit denen er mich packen wollte, griffen ins Leere. Ich drosch ihm die Faust auf die Lebergegend. Und dann drehte ich mich in ihn hinein, umfasste ihn mit dem rechten Arm und warf ihn über meine Hüfte. Der Länge nach krachte er in den Staub, der unter seinem Körper auseinanderschlug.
Ich wartete, bis er halb hoch kam. Dann traf ihn mein Schwinger unter dem Kinn, sein Schädel flog in den Nacken, im nächsten Moment lag er auf dem Rücken. Jetzt war er angeschlagen. Seine Brust hob und senkte sich unter stoßweisen Atemzügen. Seine Beine zuckten unkontrolliert. Ich packte ihn mit der Linken an der Hemdbrust, zerrte ihn halb hoch und schmetterte ihm die Rechte gegen die Schläfe; einmal, zweimal, dreimal. Dann ließ ich ihn los. Er fiel zurück. Ich richtete mich auf.
Jemand klatschte. Ich schaute in die Richtung, aus der es erklang, und sah Big Jack auf der Veranda des Haupthauses stehen. Jetzt rief der Rancher: »Bravo, Logan. Sie haben die Legende vom unschlagbaren Curly Moorcock für alle Zeit zerstört. Das macht Ihnen keiner nach.«
Ich streckte Curly die Hand hin. »Komm hoch«, sagte ich. »Ich denke, wir haben es geklärt. Vergessen wir die Sache.«
Curly griff nach meiner Hand und ich zog ihn in die Höhe. In dem Moment, als ich mich abwandte, griff er an. Ich hatte seine Heimtücke unterschätzt. Sein Arm legte sich von hinten um meinen Hals und drückte ihn zusammen. Ich schnappte nach Luft, aber nicht ein Quäntchen drang durch meine zugepresste Kehle. Ich wand mich in dem Griff, meine Lungen begannen zu stechen, alles in mir schrie nach frischem Sauerstoff, Schwindelgefühl befiel mich und die Schatten der Benommenheit schienen auf mich zuzukriechen.
»Was sagst du jetzt?«, flüsterte Curly neben meinem Ohr. »Das Blatt hat sich gewendet. Mich besiegt niemand. Nie-mand!« Das letzte Wort zerlegte er in seine Silben. Wie aus weiter Ferne vernahm ich die Stimme. Schwäche kroch in meinen Körper und schien sich in meinen Muskeln und Sehnen breitzumachen. Ich hatte das Gefühl, dass mir jeden Moment der Schädel platzen müsste.
Verzweifelt rammte ich den Ellbogen nach hinten. Und ich spürte Widerstand. Noch einmal stieß ich ihn mit aller Wucht zurück. Ein Stöhnen entrang sich Curly. Ich trat nach hinten und rammte ihm ein drittes Mal den Ellbogen gegen die Rippen. Und nun lockerte sich sein Griff und ich konnte mich losreißen. Meine Lungen füllten sich mit Vehemenz. Mein Hals schmerzte. Als ich schluckte, hätte ich am liebsten aufgeschrien.
Curly stand zur Seite gekrümmt da und drückte beide Hände auf die Stelle unter seinem Rippenbogen, wo ich ihn empfindlich getroffen hatte. Ich hatte Zeit, neue Energien in mich hineinzusaugen. Dann ergriff ich die Initiative. »Du bist ein hinterhältiger Bastard!«, stieß ich hervor, glitt an ihn heran, trieb ihm die Linke in den Magen, und als er sich verbeugte, donnerte ich ihm die Rechte unter das Kinn. Sein Schädel flog hoch, er wurde aufgerichtet und wankte einen Schritt zurück, ich setzte nach und traf ihn mit einer Doublette am Kopf. Er ging auf das linke Knie nieder, sein Kinn baumelte vor der Brust. Und ich begriff, dass dieser Bursche nicht einstecken konnte. In seinen bisherigen Kämpfen hatte er seine Gegner auf mehr oder weniger unfaire Weise erledigt und er selbst hatte gar nichts oder kaum etwas abbekommen.
Heute war das anders.
Ich beschloss, dem Kampf ein Ende zu bereiten, trat vor Curly hin und holte aus. Mein krachender Schwinger unters Kinn schickte ihn endgültig zu Boden. Verkrümmt lag er da. Ich atmete tief durch. Mein Hals schmerzt immer noch. »Das war's«, knurrte ich.
»O verdammt«, rief einer der Männer im Hof. »Was für ein Kampf. Curly hat seinen Meister gefunden. Ob er das je verwindet?«
»Er wird es schlucken müssen«, sagte Big Jack. »Es war ein fairer Kampf, und er hat ihn verloren. Logan ist der bessere Mann. Curly muss es akzeptieren.«
Zwei der Männer halfen Curly auf die Beine. Sie führten ihn zum Brunnen. Ich ging in die Mannschaftsunterkunft und legte mich auf die Bunk. Die Dummköpfe sterben eben niemals aus, durchfuhr es mich. Es findet sich immer einer, der versucht, einem anderen seinen Willen aufzuzwingen. Ich nahm mir vor, auf der Hut zu sein, denn ich rechnete mit Curlys Heimtücke.
*
Am nächsten Morgen kam Bill Conrad ins Bunkhouse und sagte: »Sattle dein Pferd, Logan. Wir reiten nach Del Rio.«
»Was sollen wir denn dort?«, fragte ich.
»Wir brauchen noch einige Treiber. Unsere Leute können wir dafür nicht hernehmen, denn sie werden hier auf den Weiden gebraucht. In Del Rio hoffe ich die richtigen Leute zu finden.«
Eine halbe Stunde später ritten wir. Wir erreichten den Rio Grande und folgten ihm nach Osten. Conrad sagte: »Du hast Curly Moorcock ziemlich schmählich verprügelt. Das vergisst dir der Bursche niemals.«
»Er wird es akzeptieren müssen«, erwiderte ich. »Jeder findet einmal seinen Meister.«
»Was hast du getrieben, ehe du in den Süden kamst, Logan?«
Ich dachte einen Moment daran, dem Vormann die Wahrheit zu sagen. Aber dann unterließ ich es. Den Grund hierfür kannte ich selbst nicht. »Ich bin durchs Land gezogen und hab mal hier, mal dort einen Job ausgeübt. Dann erzählte ich ihm die Geschichte von meinem Bruder, den ich viele Jahre lang suchte und schließlich in Seminole fand, wo ich ihn auch begrub.
»Ein Leben wie du es geführt hast, formt einen Mann«, murmelte der Vormann. »Du bist sicher auch gut mit dem Revolver und dem Gewehr.«
»Ich treffe mit dem Revolver auf zehn Schritt ein Scheunentor«, lachte ich.
»Wenn wir die Rinder in Mexiko abholen, wird das unter Umständen kein Zuckerschlecken«, erklärte Bill Conrad. »Es kann ziemlich bleihaltig werden.«
Ich schoss Conrad von der Seite einen schnellen Blick zu. Er blickte starr nach vorne. »Du sprichst von Ernesto Esteban, wie?«
»Unter anderem.«
»Wer kann uns noch gefährlich werden?«
Der Vormann zuckte mit den Schultern. »Man steckt nicht drin. Wir gehen gewissermaßen illegal über die Grenze. Mit den Rurales ist nicht zu spaßen. Warst schon mal in Mexiko?«
»Ja. Wir Americanos sind dort drüben nicht so gern gesehen.«
»Das ist richtig.«
Meile um Meile ritten wir. Jenseits des Rio Grande erstreckte sich Felswüste; totes Gestein, Staub und dorniges Strauchwerk. Dieses Land musste der Satan persönlich geschaffen haben. Die Sonne schien heiß. Schimmernd lagen die bizarren Felsgebilde unter einem Hitzeschleier. Einmal sah ich in der Ferne aufgewirbelten Staub – mehr Staub, als dass ihn nur der Wind in die Höhe getrieben haben konnte. Es wurde Abend. Wir schliefen unter freiem Himmel, und am folgenden Mittag erreichten wir Del Rio. Es war eine verhältnismäßig große Stadt mit dem typisch mexikanischen Einschlag. In der Mitte der Ortschaft gab es eine große Plaza mit einem Brunnen, der im Schatten einiger uralter Kastanienbäume lag. Die Menschen hielten Siesta. Die Hitze hielt sie in der Kühle ihrer Behausungen. In den Schatten lagen einige Hunde. Irgendwo schlug eine Tür. Die dunkle Stimme eines Mannes war zu vernehmen.
Wir ritten zum Mietstall. Der Stallmann war ein Mexikaner. »Buenos dias« grüßte er. Wir saßen ab und übergaben ihm die Pferde. Conrad sagte: »Wir kommen vom San Francisco Creek. Ich suche zwei oder drei Männer, die mit uns eine Herde von Mexiko herauftreiben. Kennen Sie einige Männer, die dafür in Frage kämen?«
Der Stallmann kratzte sich hinter dem Ohr. »Versuchen Sie's mal in der Pulqueria. Dort lungern immer ein paar Kerle herum, die jede Chance, sich ein paar Dollar zu verdienen, mit Handkuss ergreifen.«
Wir nahmen unsere Gewehre aus den Scabbards, dann verließen wir den Mietstall. Die Pulqueria war ein Adobebau mit kleinen Fenstern. Vor der Tür hing ein Vorhang aus farbigen Holzperlen. Im Schankraum war es düster, es roch stickig. Einige düstere Gestalten saßen an den Tischen. Stechende Augen musterten uns und schätzten uns ein. Wir setzten uns an einen Tisch und streckten die Beine aus. Der Keeper kam und wir bestellten Bier. Als er es brachte, sagte Bill Conrad: »Ich bin Vormann auf der Hells Half Ranch, die am San Francisco Creek liegt. Wir wollen Rinder von Mexiko herauftreiben, allerdings fehlen uns noch zwei oder drei Leute. Könnten sie mir ein paar Männer empfehlen?«
Der Keeper erhob die Stimme: »Habt ihr gehört, Leute. Die beiden suchen zwei oder drei Treibherdencowboys. Hat jemand Interesse an dem Job?«
»Natürlich müssen die Männer ihr Handwerk verstehen«, fügte Bill Conrad hinzu.
Einer rief: »Ich würde auf der Stelle mit euch reiten. Aber ich habe noch nie Kühe gehütet.«
»Dann kommst du nicht in Frage«, erklärte Bill Conrad. »Hat sonst jemand Interesse?«
Niemand meldete sich. Viehtrieb war eine Knochenarbeit. Man saß täglich sechzehn Stunden im Sattel und schluckte Unmengen von Staub. Die Bezahlung war unverhältnismäßig niedrig. Außerdem wusste jeder, dass sich in der Felswüste Mexikos Banden von Bravados herumtrieben, der Broterwerb Raub und Diebstahl waren und die vor Mord nicht zurückschreckten.
Der Keeper sagte: »Am Johnston Creek hausen die drei Malone-Brüder. Sie bewirtschaften eine kleine Ranch, können sich damit aber kaum über Wasser halten. Man munkelt, dass sie sich auf den Nachbarweiden bedienen. Die drei Kerle sind mit Vorsicht zu genießen. Aber sie kennen sich mit Rindern aus. Versucht es mal bei ihnen.«
Wir tranken unser Bier, zahlten und gingen zum Mietstall. Der Stallmann hatte unsere Pferde abgerieben und gefüttert. »Kein Glück gehabt, wie?«, fragte er.
»Wir reiten zu den Malone-Brüdern«, versetzte Conrad.
Der Stallmann verzog das Gesicht. »Man sagt, dass die drei Banditen sind.«
»Wichtig ist, dass sie Rinder treiben können«, meinte Conrad.
Wir ritten zum Johnston Creek und folgten ihm. Von einer Bodenwelle aus sahen wir dann das Anwesen der drei Brüder. Das Haus und die Schuppen sahen heruntergekommen aus. Alles wirkte grau in grau. In einem Corral standen sechs Pferde. Einige Rinder weideten in der Nähe der Gebäude.
Wir trieben die Pferde an und ritten weiter. Wenig später trugen uns die Pferde in den Ranchhof. Vor dem verwahrlosten Haupthaus saß ein bärtiger Bursche auf einer Bank. Quer über seinen Oberschenkeln lag eine Winchester. Er hielt sie am Kolbenhals fest.
Wir ritten zu ihm hin und zügelten. Sein Gesicht lag im Schatten der Hutkrempe. Seine Augen glitzerten. »Wer seid ihr?«
Conrad stellte uns vor, dann sagte er: »Man hat mich in Del Rio an euch verwiesen. Ich suche zwei oder drei Viehtreiber. Es gilt, eine Herde von Mexiko heraufzuholen. Wir ziehen durch das Gebiet, das Ernesto Esteban kontrolliert. Es müssen also Burschen sein, die Tod und Teufel nicht fürchten.«
Aus einem Schuppen trat ein Mann. Er hielt ein Gewehr mit beiden Händen schräg vor seiner Brust. Seine Ähnlichkeit mit dem Burschen auf der Bank war frappierend. Ein dritter Mann zeigte sich an einem der glaslosen Fenster des Haupthauses. Auch er war bärtig und hielt ein Gewehr.
Die drei gefielen mir nicht. Verkommenheit stand ihnen in die Gesichter geschrieben.
Der Kerl auf der Bank sagte: »Ich bin Wayne Malone. Was zahlt euer Boss denn an Treiberlohn?«
»Fünfzig Dollar.«
»Für fünfzig Dollar sollen wir unsere Haut zu Markte tragen?«
»Für fünfzig Dollar muss ein Cowboys fast zwei Monate arbeiten«, antwortete Conrad. »Der Viehtrieb dauert allenfalls acht Tage.«
»Wenn zwei von uns mitreiten, sind das hundert Dollar«, gab der Bursche zu verstehen, der aus dem Schuppen gekommen war.
»Wann hatten wir zuletzt hundert Dollar in Händen?«, fragte der Kerl am Fenster.
»Wer bleibt auf der Ranch?«, fragte Wayne Malone.
»Ich«, sagte der Bursche vor dem Schuppen. Er richtete den Blick auf Conrad. »Wie sieht's mit 'nem kleinen Vorschuss aus?«
»Reichen zwanzig Dollar?« Bill Conrad holte das Geld aus seiner Brieftasche. Wayne Malone erhob sich und richtete das Gewehr auf Conrad. »Cash, nimm ihm die Brieftasche weg. Und dann verschwindet ihr beiden. Wenn wir euch Beine machen müssen, wird es übel für euch.«
Der Bursche beim Schuppen setzte sich in Bewegung. Ein schiefes Grinsten spielte um seinen Mund.
Ich sagte: »Sieht aus, als wären wir unter die Straßenräuber gefallen.«
Das Gewehr in Wayne Malones Händen schwenkte zu mir herum. »Du hast sicher auch ein paar Dollar einstecken, Hombre. Hol sie vorsichtig aus der Tasche. Solltest du ...«
Ich ließ mich vom Pferd fallen. Wayne Malone feuerte. Die Kugel pfiff über den leeren Sattel hinweg. Und dann brüllte mein Remington auf. Die Wucht der Kugel schleuderte Wayne Malone gegen die Hauswand. Er ließ das Gewehr fallen.
Cash Malone riss das Gewehr an die Hüfte. Wieder bäumte sich der Remington in meiner Faust auf. Die Detonation wurde über den Ranchhof geschleudert und prallte gegen die Wände der Gebäude. Cash Malones Bein wurde vom Boden weggerissen, der Kerl stürzte mit einem Aufschrei.
Jetzt donnerte auch Bill Conrads Revolver. Der Bursche, der am Fenster stand und der von der Entwicklung der Dinge scheinbar völlig überrascht worden war, brach zusammen.
Wayne Malone lehnte an der Hauswand und drückte die linke Hand auf seine zerschossene Schulter. Blut sicherte zwischen seinen Fingern hervor. Cash Malone saß im Staub und umklammerte mit beiden Händen sein Knie. Der Schmerz wühlte in seinen Zügen.
Ich erhob mich. Staub rieselte von meiner Kleidung.
Bill Conrad saß ab und lief ins Haus. Ich ging zu Wayne Malone hin, nahm sein Gewehr und schlug den Kolben der Waffe ab. Einen Revolver trug der Bursche nicht. Genauso verfuhr ich mit Cash Malones Gewehr. Auch er hatte keinen Revolver umgeschnallt. Der Vormann kam aus dem Haus. »Der Kerl drin hat die Kugel in die Brust bekommen. Er wird den Abend wohl nicht mehr erleben.«
»Reiten wir nach Del Rio zurück«, sagte ich, »und sagen wir dem Arzt Bescheid, dass es hier Arbeit für ihn gibt. Und vielleicht finden wir in der Stadt doch noch die zwei oder drei Männer, die wir für den Viehtrieb benötigen.«
»Die Hölle verschlinge euch!«, presste Wayne Malone hervor.
Ich schwang mich aufs Pferd. »Ihr seid in der Lage, euch selbst zu verbinden«, sagte ich. »In zwei Stunden wird der Doc hier sein.«
»Das werdet ihr büßen!«, prophezeite Wayne Malone.
Unbeeindruckt zogen wir die Pferde herum und ritten an. Nachdem wir ein Stück zurückgelegt hatten, sagte Conrad: »Du triffst also auf zehn Schritt ein Scheunentor?«
»Nun ja ...«
»Du bist der schnellste Mann, den ich je erlebt habe, Logan. O verdammt, wer bist du wirklich? Du stehst sicher auf einer Stufe mit Wes Hardin und Clay Allison.«
*
Wir kehrten nach Del Rio zurück. Ich sagte dem Mann im Mietstall Bescheid, dass er den Doc zur Malone Ranch schicken sollte. Conrad und ich beschlossen, über Nacht in der Stadt zu bleiben und es am Abend noch einmal in der Pulqueria zu versuchen. Es gab ein Hotel, in dem wir uns zwei Zimmer mieteten. Als es dunkel war, gingen wir in die Pulqueria. Auf den Tischen standen Näpfe mit Talglichtern, die vages Licht spendeten. Murmeln, Raunen und Lachen erfüllte den Raum. Wir gingen zum Tresen. »Ich hörte, dass ihr kein Glück bei den Malones gehabt habt«, sagte der Keeper.
»Nein«, erwiderte Conrad, »die drei Brüder waren nicht die richtigen Leute für uns. Gibt es tatsächlich keine zwei oder drei Burschen in dieser Stadt, die sich fünfzig Dollar verdienen möchten?«
»Ich höre mich mal um«, versprach der Keeper.
Wir bekamen jeder ein Bier, trugen es zu einem freien Tisch und setzten uns. Der Keeper ging von Tisch zu Tisch. Es dauerte nicht lange, dann kamen zwei Burschen zu unserem Tisch. Sie waren jung, allenfalls fünfundzwanzig, und sie trugen Weidereitertracht. Einer sagte an Conrad gewandt: »Sie haben einen Job zu vergeben?«
Bill Conrad nickte. Dann erklärte er, worum es ging. Die beiden erklärten sich bereit, mit uns zu reiten. Am folgenden Morgen brachen wir auf. Am übernächsten Tag erreichten wir die Hells Half Ranch. Und tags darauf machten wir uns auf den Weg nach Mexiko. Wir waren sieben Reiter. Bill Conrad führte uns. Wir überschritten den Rio Grande und befanden uns in Mexiko. Von nun an war Vorsicht geboten. Die Gefahr konnte in dieser Felswüste überall lauern. Der Tod war allgegenwärtig. Wir ritten durch Schluchten. Aus Seitenschluchten strömte uns kühle Luft entgegen. Es ging über windige Plateaus, vorbei an ruinenähnlichen Felsgebilden, durch staubige Senken und über Geröll. Die Hitze füllte die Lungen beim Atmen wie mit Feuer. Staub und Schweiß verklebten unsere Poren. Wir ritten jetzt nach Westen. Unsere Mahlzeiten bestanden aus Pemmican und getrocknetem Brot, dazu tranken wir das brackige Wasser aus unseren Feldflaschen. Nach vier Tagen kamen wir in ein kleines Dorf. Es trug den Namen Paso de San Antonio. Flache Adobehütten, windschiefe Schuppen, enge Gassen, eine Plaza – das war Paso de San Antonio. Es war später Nachmittag. Einige Männer und Frauen befanden sich im Freien und beobachteten uns. Die Männer trugen Strohhüte mit breiten Krempen, die Frauen Kopftücher. Einige Kinder rannten lärmend über die Plaza.
Wir ritten zum Brunnen und saßen ab. Einer warf den Ledereimer in die Tiefe und hievte ihn dann in die Höhe. Die Winde quietschte und knarrte. Wir wuschen uns die Gesichter, dann holten wir frisches Wasser nach oben und tranken. Danach bekamen die Pferde zu saufen.
Bill Conrad trat an mich heran. »Wir sind am Ziel. Die Herde steht an einem Nebenfluss des Rio San Antonio. Wir übernehmen sie morgen früh und machen uns sofort auf die Socken.«
Wir campierten am Dorfrand. Am Abend aßen wir in der Pulqueria. Am Morgen ritten wir nach Norden. Die Herde stand in einer weitläufigen Senke, in der spärliches Gras wuchs. Es waren Longhorns; schwarze, knochige Biester mit ausladenden Hörnern. Muhen der Kühe und Brüllen der Stiere erfüllte die Senke. Einige Vaqueros ritten um die Herde herum. Zwei Reiter lösten sich von der Herde und ritten uns entgegen. Sie trugen wagenradgroße Sombreros. Die gebräunten Gesichter waren bärtig und wurden von dunklen Augenpaaren beherrscht. »Buenas tardes, Conrad!«, rief einer der Männer. »Es ist immer wieder schön, mit deinem Boss Geschäfte zu machen.«
»Sicher, Pepe«, erwiderte Bill Conrad. »Euer Gewinn beträgt hundert Prozent.«
Diese Äußerung gab mir zu denken.
Die beiden Männer begrüßten sich per Handschlag. Dann saßen wir ab. Conrad holte Geld aus seinen Satteltaschen und zahlte den Mexikaner aus. Dann übernahmen wir die Herde. Die Mexikaner ritten davon.
»Bekommst du keine Kaufpapiere?«, fragte ich den Vormann.
Er lachte. »Die brauchen wir nicht. Wenn die gehörnten Teufel erst mal auf der anderen Seite des Rio Grande sind, fragt kein Schwein danach, woher sie kommen.«
Ich legte meine Hände übereinander auf den Sattelknauf und verlagerte das Gewicht meines Oberkörpers auf meine durchgedrückten Arme. »Sag mal, Conrad«, knurrte ich. »Sind diese Rinder etwa gestohlen?«
»Du hast doch gesehen, dass ich sie ordnungsgemäß bezahlt habe.«
»Fünf Dollar für das Rind«, versetzte ich. »In den Staaten bekommst du fünfzehn.«
»Das nennt man Geschäft«, knurrte Conrad. »Glaubst du, wir würden den tagelangen Trail durch die Felswüste auf uns nehmen, wenn es sich nicht rentieren würde?«
Ich blieb skeptisch.
Wir setzten die Herde in Bewegung. Bill Conrad übernahm mit einem Leitstier die Spitze. Er führte das Tier an der Longe. Ich ritt mit einem Gefährten an der rechten Flanke. Zwei Reiter befanden sich auf der linken, zwei folgten der Herde als Dragrider. Sie mussten den meisten Staub schlucken. Sechstausend Hufe wühlten den Boden auf. Horn klapperte. Buschige Schwanzenden peitschten über knochige Rücken. Wenn eine solche Herde verrückt spielte, walzte sie alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte.
Die Herde marschierte. Wir legten an diesem Tag wohl zwanzig Meilen zurück. Wir peitschten die Rinder regelrecht nach Nordosten. Vier Tage trieben wir. Es war härteste Sattelarbeit. Nachts sanken wir todmüde auf unsere Decken und schliefen sofort ein. Ungeschoren erreichten wir den Rio Grande. In einer Senke führte Bill Conrad die Herde solange im Kreis herum, bis sie stand. Es war Mittagszeit. Die Sonne stand hoch im Zenit und verwandelte das Land in einen Backofen.
Ich ritt zu Conrad hin. »Warum halten wir? In zwei Stunden könnten wir über den Rio Grande sein. Was bezweckst du mit diesem Manöver?«
»Wir gehen nachts hinüber«, versetzte der Vormann.
Ich wurde erneut stutzig. »Verdammt!«, stieß ich hervor. »Nun rück endlich raus mit der Sprache. Diese Rinder sind gestohlen. Die Hells Half Ranch betätigt sich als Hehler und kauft die gestohlenen Tiere für einen Spottpreis auf. Und du wagst dich nicht bei Tag über die Grenze, weil du die Texas Ranger fürchten musst.«
»Du redest Unsinn, Logan!«, kanzelte mich der Vormann ab und zerrte sein Pferd herum. Es war offensichtlich: Er wollte jedweder Debatte ausweichen.
»Halt, Conrad!«, sagte ich klirrend. »So einfach lasse ich mich nicht abspeisen. Sag mir die Wahrheit. Gib zu, dass es sich um gestohlene Rinder handelt.«
»Na schön. Sie sind gestohlen. Was kümmert's uns? Wir kaufen sie und machen ein Riesengeschäft mit ihnen. Das verursacht dir doch keine Gewissenbisse?«
Ich stieß die Luft durch die Nase aus. »Ihr habt mich hereingelegt. Hölle, wenn ich das geahnt hätte ...«
Plötzlich stob einer der Reiter heran. Bei uns riss er sein Pferd in den Stand und rief: »Ich bin auf unserer Fährte ein Stück zurückgeritten. Von einem Hügel aus sah ich ein Rudel Reiter.«
Im Gesicht des Vormannes arbeitete es. Sekundenlang starrte er versonnen vor sich hin. Dann sagte er: »Wer auch immer auf unserer Fährte reitet – wir haben von ihnen nichts Gutes zu erwarten. Darum treiben wir weiter.«
Er hatte es plötzlich verdammt eilig. Mir gefiel die Sache ganz und gar nicht. Aber ein Zurück gab es jetzt nicht. Ich musste bei der Treibermannschaft bleiben. Trennen konnte ich mich von ihr auf der anderen Seite des Flusses immer noch.
Wir brachten die Herde wieder in Marschordnung. Nach einer halben Stunde lag der Rio Grande vor uns. Bill Conrad ritt mit dem Leitstier in den Fluss hinein. Die ersten Tiere folgten. Plötzlich trieben drüben Reiter ihre Pferde aus einem Hügeleinschnitt, fächerten auseinander und stoben heran. Es waren über ein Dutzend. An ihren Westen und Jacken glitzerten Sterne. Texas Ranger! Erste Schüsse krachten.
Bill Conrad ließ die Longe des Leitstiers sausen, zerrte sein Pferd herum und jagte zurück auf die mexikanische Seite des Rio Grande. Die Herde marschierte weiter. »Texas Ranger!«, brüllte der Vormann, als er an mir vorbei jagte. Ich folgte ihm. Die Staubwolke, die die Herde aufwirbelte, gab mich irgendwann frei. O verdammt! Wo war ich da hineingeraten? Hinter mir krachten Schüsse. Und plötzlich sah ich vor mir über eine Bodenwelle die Reiter kommen, die uns gefolgt waren. Die Hufe ihrer Pferde wirbelten und schienen kaum den Boden zu berühren.
Ich wandte mich nach Westen. Aus dem Pulk, der sich von Süden näherte, brachen drei Reiter aus und versuchten mir in einem spitzen Winkel den Weg abzuschneiden. Ich wandte mich nach Norden, erreichte wieder den Rio Grande und sah auf der amerikanischen Seite die drei Reiter. Schüsse peitschten. Mein Pferd brach zusammen. Im letzten Moment konnte ich die Steigbügel abschütteln und abspringen. Das Tier keilte aus und wieherte. Ich warf mich in die Deckung des Pferdekörpers. Die Rinder liefen kreuz und quer durcheinander. Aus der Staubwolke lösten sich drei Reiter in dunklen Anzügen.
Ich hatte keine Chance. »Nicht schießen!«, rief ich und erhob mich, hob die Arme und blickte den Reitern entgegen. Es waren Rurales – Angehörige der berühmt-berüchtigten Grenzreitertruppe Mexikos. Einer winkte über den Fluss. Ich drehte den Kopf und sah einen der Texas Ranger den Gruß erwidern.
Die drei Polizisten zügelten vor mir die Pferde. Einer gab einen Befehl auf Spanisch, zwei schwangen sich von den Pferden, ich wurde entwaffnet, dann wurden mir die Hände auf den Rücken gefesselt.
Bei der Herde wurde noch gekämpft. Der Bursche, der auf dem Pferd sitzen geblieben war, sagte: »Ich bin Sargento Pablo Santoz. Und du bist ein verdammter Viehdieb. Wir werden dich ins Gefängnis von La Morita bringen. Dort wirst du auch vor den Richter gestellt.«
Sie legten mir eine Lassoschlinge um den Hals, die beiden Rurales, die mich gefesselt hatten, saßen auf, dann ritten sie zurück. Ich musste hinter ihren Pferden herlaufen.
Südlich der Herde sammelten sich die Rurales. Ein Capitán ritt vor mich hin. »Du hattest Glück«, sagte er. »Vier deiner Companeros sind tot, zwei sind über den Fluss geflüchtet und wurden von den Lone Star-Reitern in Empfang genommen. Endlich haben wir euch elende Gringos erwischt. Bei den Viehdiebstählen hat es Tote gegeben. Du wirst dein Land wohl nicht mehr sehen.«
»Ich bin erst vor einigen Tagen zu der Mannschaft gestoßen«, sagte ich. »Wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass die Rinder, die wir abholen sollten, gestohlen sind, wäre ich niemals mit der Crew geritten.«
»Schweig, Gringo!«, fuhr mich der Capitán an.
Meine Zukunft gestaltete sich alles andere als rosig.
*
Ich musste etwas fünf Meilen laufen. Das Lasso, das um meinen Hals lag, hatten sie mir nicht abgenommen. Meine Füße brannten in den engen Reitstiefeln. Der Schweiß rann mir in die Augen und entzündete sie. Meine Beine wollten mich kaum noch tragen. Ich war fix und fertig. Zwischen meinen Zähnen knirschte Staub.
In einem Felsenkessel stand ein Fuhrwerk, vor das zwei schwerere Pferde gespannt waren. Ein halbes Dutzend Männer saßen auf der Ladefläche. Vier Rurales bewachten sie. Ich wurde auf den Wagen gehoben und setzte mich zwischen zwei der Männer, die wie ich gefesselt waren. Der Sargento trieb sein Pferd heran. »Das sind Bravados. Wir haben sie auf unserem Streifzug durch die Llanos und Sierras eingesammelt. Auf die meisten von ihnen wartet der Strick. Du befindest dich in guter Gesellschaft, Gringo.«
Eine Viertelstunde später brachen wir auf. Wir zogen nach Osten. Es ging über Stock und Stein und wir wurden auf dem Fuhrwerk durch und durch geschüttelt. Bald spürte ich jeden Knochen. Dann wurde es dunkel und wir lagerten. Wir Gefangenen mussten uns vor dem Fuhrwerk auf den Boden setzen. Zwei Polizisten wurden zu unserer Bewachung abgestellt. Ein großes Feuer wurde angezündet, die Pferde wurden versorgt, man nahm den Tieren die Sättel ab. Dann wurde ein Seilcorral errichtet, in den die Pferde getrieben wurden.
Ich zerrte an meinen Handfesseln. Die Lederschnüre schnitten mir tief in die Handgelenke. Der Blutfluss in meine Hände wurde behindert und meine Finger waren pelzig. Die Fesselung hielt. Ich knirschte mit den Zähnen. Meiner Ohnmacht, meiner Hilflosigkeit war ich mir voll und ganz bewusst. Mein Schicksal schien sich in einer Sackgasse verfahren zu haben. Die Zukunft lag so dunkel vor mir wie die Nacht, die das Land einhüllte.
Der Bursche neben mir sagte: »Warum haben Sie dich verhaftet, Americano? Bist du ein Pistolero von drüben? Hast du jemand erschossen?«
Einer der Rurales trat schnell heran und versetzte dem Burschen eine Ohrfeige. »Schweig, Hund!«
Die Mexikaner aßen. Wir bekamen nichts. Das Feuer warf flackernde Lichtreflexe über das Szenarium. Am Boden wechselten Licht und Schatten. In der Nacht fand ich kaum Schlaf. Coyoten bellten in der Ferne. Die Kerle, die mit mir in einer Reihe lagen, schnarchten. Einer sprach im Schlaf. Die beiden Wachposten gingen ständig hin und her. Ihre Sporen klirrten leise. Manchmal unterhielten sie sich flüsternd. Nach jeweils zwei Stunden wurden sie abgelöst. Die Nacht war kühl. Die Kälte schien aus dem Boden durch meine Kleidung zu kriechen. Und die Kälte war nicht nur äußerlich ...
Die Nacht lichtete sich, die Sterne begannen zu verblassen. Ein Befehl ging durch das Lager. Die Rurales erhoben sich. Wir wurden hochgetrieben. Ich erhielt einen derben Tritt. Die Polizeireiter gingen nicht zimperlich mit uns um.
Der Tag brach an. Mit dem Sonnenaufgang kroch die erste Helligkeit ins Land. Wir wurden auf das Fuhrwerk verfrachtet. Dann ging es weiter. Die Tortur auf dem Wagen begann von neuem. Am Abend tauchte eine Stadt vor uns auf. Es gab einige große Gebäude. Vor einem solchen Gebäude hielten wir an. Wir wurden vom Fuhrwerk gezerrt und in das Gebäude getrieben. Es ging eine Treppe hinunter, und unten, zu beiden Seiten eines Ganges, waren die Gefängniszellen. Es stank erbärmlich. Fauliges Stroh lag auf dem Fußboden. Kleine, vergitterte Fenster ließen kaum Licht und noch weniger frische Luft herein. Unwillkürlich fragte ich mich, ob ein Mann durch diese Öffnungen passte.
Einige Gefangene bevölkerten die Zellen. Mit fiebrigen Augen musterten sie uns. Uns wurden die Fesseln abgenommen, dann wurden wir auf die Zellen aufgeteilt. Ich fand mich mit zwei bärtigen, verwegen aussehenden Burschen in einem der Käfige wieder. Außer dem Latrineneimer gab es kein Mobiliar in den Zellen. Ich kauerte an der Wand nieder und lehnte mich mit dem Rücken dagegen. Es schepperte und klirrte, als die Zellentüren geschlossen wurden. Die Rurales entfernten sich.
Einer der Kerle, die sich mit mir in der Zelle befanden, sagte: »Mein Name ist Juan. Die Rurales nahmen mich fest, als ich auf dem Weg nach El Chapo war. Warum bist du hier, Americano?«
»Ich ritt mit einer Mannschaft, die gestohlenes Vieh in die Staaten bringen wollte.«
Der andere Kerl meldete sich: »Ich bin José. Die Polizeireiter hatten keinen Grund, mich festzunehmen. Aber sie denken, dass jeder, der durch die Wildnis reitet, zu Ernesto Esteban gehört.«
Ich zerbrach mir den Kopf nach einem Ausweg. Obwohl ich mich mit zwei Männern in der Zelle befand, war ich mir meiner Einsamkeit und Verlorenheit voll bewusst. Ich hatte nichts zu meiner Entschuldigung vorzubringen. Die Geschichte, dass ich nichts von Big Jack Brewsters ungesetzlichen Machenschaften wusste, würden sie mir nicht abkaufen.
Ich war kurz davor, zu resignieren.
Ich schlief am Boden. Am Morgen fühlte ich mich wie gerädert, erhob mich und machte einige Freiübungen, um die Durchblutung meiner Muskulatur anzuregen. Die Schmerzen wurden etwas erträglicher.
Einige Wachposten in hellen Anzügen kamen und brachten trockenes Fladenbrot sowie Wasser. Jeder bekam ein halbes Brot, in jede Zelle wurde ein Krug Wasser gestellt. Hungrig aß ich. Das Wasser teilten wir uns. Dann kamen zwei Rurales. Meine Zelle wurde aufgesperrt, einer sagte mit hartem Akzent: »Folge uns, Gringo. Der Capitán will dich verhören.«
Ich erhob mich und wurde von den beiden in die Mitte genommen. Sie führten mich die Treppe hinauf, es ging über einen Hof, dann betraten wir ein zweistöckiges Gebäude. Ich wurde in ein Büro geführt. In der Raummitte stand ein zerkratzter Tisch, um den vier Stühle gruppiert waren. Der Capitán saß mit vor der Brust verschränkten Armen auf der Tischkante und ließ ein Bein baumeln. Ohne die Spur von Milde schaute er mich an. »Setz dich, Gringo.«
Ich ließ mich nieder. Die beiden Rurales bauten sich hinter mir auf. Die Brauen des Capitáns waren über der Nasenwurzel zusammengewachsen und bildeten einen schwarzen, durchgehenden Strich. Er sagte: »Ich bin Capitán Sergio Montuerra.«
»Mein Name ist William Wayne Logan«, antwortete ich. »Bis vor wenigen Wochen trug ich selbst den Stern drüben in Texas. Ich war U.S. Deputy Marshal.«
Die linke Braue des Capitán hob sich. »Wie kommt es, dass wir dich bei einer Bande von Viehdieben aufgriffen?«
Ich erzählte meine Geschichte. Als ich fertig war, knurrte der Offizier: »Und das soll ich dir glauben, Hombre. Um euren Hals aus der Schlinge zu ziehen, lügt ihr verdammten Bravados doch, dass sich die Balken biegen. Sag mir den Namen des Ranchers, für den du geritten bist.«
»Jack Brewster. Man nennt ihn Big Jack. Ihm gehört die Hells Half Ranch am San Francisco Creek.«
»Und du willst nichts gewusst haben von seinen Machenschaften?«
»Ich beschwöre es.«
Eine Hand verkrallte sich in meinen Haaren, mir wurde der Kopf in den Nacken gebogen, eine zischende Stimme sagte: »So leichtfertig gehst du mit einem Schwur um?«
Ich hatte das Gefühl, skalpiert zu werden, und stöhnte. Dann ächzte ich: »Es ist die Wahrheit. Ich ging von einem legalen Geschäft aus.«
»Und bist mit den anderen illegal über die Grenze gegangen.«
»Diesen Verstoß sah ich nicht als gravierend an«, antwortete ich.
Der Capitán gab dem Burschen einen Wink und er ließ meine Haare los. »Jack Brewster also«, murmelte der Capitán. »Um ihn werden sich die Rangers kümmern.« Die Stimme hob sich ein wenig. »Du wirst wegen Viehdiebstahls angeklagt, Logan. Da einige Vaqueros ihr Leben lassen mussten, kann es sein, dass dich der Richter an den Galgen oder vor ein Erschießungskommando schickt. Führt ihn ab.«
Ich wurde gepackt und in die Höhe gezerrt. Die beiden Männer brachten mich wieder ins Gefängnis. Hinter mir fiel die Gittertür ins Schloss. Die beiden Kerle, die mit mir das Verlies teilten, starrten mich an.
*
Drei Tage vergingen. Ich wurde nicht mehr aus der Zelle geholt. Mein Schicksal war ungewiss. Keiner der Polizisten sprach mit mir. Ich war total verdreckt und stank erbärmlich. Es war Nacht. Das Schnarchen der Gefangenen in den Ohren, wälzte ich mich unruhig am Boden hin und her. Mondlicht fiel in einer schrägen Bahn durch das vergitterte Fenster und zeichnet ein helles Viereck auf den Boden, in dem die Schatten der Gitterstäbe abgebildet waren.
Ich glaubte zu träumen, als ich eine leise Stimme vernahm. »Logan!«
Narrten mich meine Sinne, spielten sie mir einen Streich. Das war Joe Hawks Stimme gewesen.
Und dann ertönte es erneut: »Logan, he, hörst du mich?« Der helle Fleck am Boden verschwand, als eine Gestalt das Fenster verdunkelte, absolute Finsternis senkte sich in die Zelle.
Ich erhob mich und ging zum Fenster. »Bist du es wirklich?«
»Ja. Ich werde dich hier rausholen, Logan-Amigo. Keine Fragen jetzt.
Die beiden Männer, die mit mir die Zelle teilten, erwachten. »Was ist das?«, fragte einer.
Joe machte sich am Gitter zu schaffen. Dann hörte ich Hufschläge, und dann gab es einen knirschenden Laut, als das Gitter aus der Verankerung in der Mauer gerissen wurde. Ein helles Scheppern war zu hören. Das Gitter vor dem Fenster war verschwunden. »Du musst dich durch die Öffnung zwängen, Logan-Amigo«, sagte Joe. »Mach dich dünn.«
»Nehmt uns mit«, flüsterte einer meiner Mitgefangenen. In den Nachbarzellen war Gemurmel und Geflüster entstanden. »Caramba, was ist da los? Was war das?«
Ich streckte die Arme durch das Fenster und machte die Schultern schmal. Der Kopf folgte. Joe packte mich bei den Handgelenken und zog. Es ging nicht ganz schmerzfrei ab, aber ich schaffte es. Frische Nachtluft füllte meine Lungen.
Hinter mir kam einer der Mexikaner. Ich half ihm, ebenso dem anderen. »Ich verziehe mich«, sagte Letzterer. »Muchos gracias, Gringo.« Er lief davon und verschwand zwischen den Gebäuden. Die Finsternis schien ihn zu verschlucken. Der andere sagte: »Nehmt mich mit. Ich kenne das Land wie meine Westentasche und kann euch führen. Ich garantiere euch, dass euch die Rurales nicht erwischen.«
Ich sah zwei Pferde. Joe knüpfte die Lassos von den Sätteln. Dann saßen wir auf. Juan stieg bei mir auf Pferd. Wir ritten davon. Bald nahm uns die Wildnis auf. Schon eine halbe Stunde später vernahmen wir brandende Hufschläge. Sie schlugen heran wie ein Gruß aus der Hölle. Wir trieben die Pferde zwischen die Felsen. In einer Entfernung von hundert Yards stob der Pulk an uns vorüber. Das Hufgetrappel wurde leiser und leiser und versank schließlich in der Stille.
Da wir vermuteten, dass die Rurales den direkten Weg nach Norden zum Rio Grande abriegeln würden, zogen wir nach Osten. Wir ritten nebeneinander. »Nun spann mich nicht länger auf die Folter, Joe«, forderte ich meinen Freund auf, zu erzählen.
»Der Richter hat mich hinter dir hergeschickt. Drei Tage, nachdem du Amarillo verlassen hattest, erschien ein Marshal aus New Mexico, der auf der Spur von Clint Anderson ritt. Anderson hat in New Mex drei Männer ermordet und einen vierten lahm geschossen. Den Behörden in New Mexico war er tausend Dollar wert. Auf seinem Weg durch Texas hat er eine blutige Spur gezogen. Unter anderem hat er in Andrews die Bank ausgeraubt und den Kassier erschossen. Das wurde alles erst bekannt, als Jim Younger, der Marshal, nach Amarillo kam.«
Joe machte eine kleine Pause.
»Dass Anderson Swansons Uhr mit sich trug, war sicher auch kein Zufall«, fuhr er dann fort. »John Wood hat uns von den letzten Worten Matt Dexters berichtet. Sie lauteten: Sie war eine hübsche Lady. Ich hatte Freude an ihr. Der Narr hätte nicht versuchen sollen, mich von der Farm zu jagen. Aber ... Mit diesem aber wollte Dexter sein Geständnis einschränken. Er hat die Frau vergewaltigt, aber er hat sie vielleicht gar nicht ermordet. Dann hat er auch nicht die Farm angezündet. Wenig später kam Anderson auf die Farm, fand den sterbenden Farmer und die missbrauchte Frau, nahm sich, was er brauchen konnte, und zündete schließlich das Farmhaus an.«
»Das hieße ...«
»Das hieße, dass kein Unschuldiger gehängt wurde. Dass er auf der Farm war, ist definitiv. Dass er ein eiskalter Mörder war, auch. Der Richter bittet dich, zurückzukommen und dir den Stern wieder anzustecken.«
»Das tue ich mit Freuden«, versetzte ich. »Vorher aber gilt es, auf die andere Seite des Rio Grande zu kommen. Wie hast du mich im Gefängnis von La Morita gefunden?«
»Ich folgte deiner Spur und gelangte nach Sanderson. In der Stadt sprach ich mit dem Stallmann und der schickte mich auf die Hells Half Ranch. Dort erfuhr ich, dass du mit einer Mannschaft nach Mexiko geritten bist, um eine Rinderherde abzuholen. Da hörte ich, dass am Rio Grande eine Rustlermannschaft den Texas Rangers und den Rurales ins Netz ging. Zwei der Rustler waren nach Del Rio gebracht worden. Also ritt ich nach Del Rio und sprach mit den beiden. Ich erfuhr, was sich am Rio Grande zugetragen hatte. Ich ritt in ein kleines Dorf in der Nähe. Die Bewohner hatten die toten Rustler begraben. Ein Mann mit deiner Beschreibung war nicht darunter. Also musste ich annehmen, dass du festgenommen worden bist. Die einzige Rurales-Garnison im weiten Umkreis ist in La Morita. Ich ritt hin und zog Erkundigungen ein ...«
»Ich weiß nicht, was ohne dich aus mir geworden wäre«, murmelte ich. »Es war ein Spiel mit dem Feuer. Wenn dich die Rurales erwischt hätten, wärst du auch im Gefängnis gelandet.«
»Nun, ich besorgte mir einen zerschlissenen Poncho und einen alten Strohhut. Mit meinem tagealten Bart war ich von einem echten Mexikaner nicht zu unterscheiden.«
»Woher hast du das zweite Pferd?«
»Das habe ich auf einer Hazienda in der Nähe erworben.«
Durch die Nacht prallten Hufschläge heran. Wir parierten die Pferde und warteten, bis sie verklungen waren. Dann ritten wir weiter.
Als der Morgen graute, erreichten wir einen schmalen Fluss. An seinem Ufer wuchsen vereinzelte Büsche. Wir saßen ab, tränkten die Pferde, dann aßen wir etwas Dörrfleisch, das Joe in der Satteltasche hatte. Die Sonne ging auf.
»Bis zur Grenze sind es von hier aus etwa fünfzig Meilen«, erklärte Joe. »Und es sind nicht nur die Rurales, die wir fürchten müssen. In diesem Landstrich treibt Ernesto Esteban mit seinen Halsabschneidern sein Unwesen, hab ich mir sagen lassen.«
Plötzlich ergriff Juan das Wort und sagte: »Ernesto Esteban ist kein schlechter Mann. Man hat ihm übel mitgespielt. Er besaß einmal eine Hazienda und war ein geachteter Hidalgo. Manuel Ortega vertrieb ihn mit Hilfe der Behörden von seinem Land. Seitdem bekämpft Ernesto die staatliche Gewalt.«
»Du kennst ihn?«, fragte ich. Juan wich meinem Blick aus. Ich zog die richtigen Schlüsse. »Du reitest in seiner Bande, nicht wahr?«
»Auch mir hat man übel mitgespielt. Auch ich hatte Grundbesitz. Aber ich war einem Großen ein Dorn im Auge. Meine Frau wurde bei einem Überfall getötet. Mir schlugen sie mit der Peitsche fast das Fleisch von den Knochen. Mein Haus wurde verbrannt und ich stand vor dem Nichts.«
»Und du hast dich Esteban angeschlossen.«
Juan nickte. »Ich kann euch zu ihm bringen. Er haust in den Bergen. Dort wärt ihr einige Zeit sicher. In wenigen Tagen werden die Rurales aufgeben, nach euch zu suchen. Und dann könnt ihr euch auf den Weg nach Norden machen.«
»Esteban ist ein Bandit«, murmelte ich. »Und weil das so ist, verzichten wir auf seine Hilfe. Wir kommen auch ohne ihn zurecht. Was meinst du, Joe?«
»Ich bin ganz deiner Meinung. Du kannst ein Lied davon singen, was dabei herauskommt, wenn man sich mit Banditen verbündet. – Versteh mich nicht falsch, Logan-Amigo. Es sollte keinen Vorwurf darstellen. Du konntest es nicht wissen. Es sollte nur eine Feststellung sein.«
»Du hast recht, Joe«, knurrte ich.
*
Nach einer Stunde etwa brachen wir wieder auf. Es war jetzt hell. Die Hitze nahm schnell zu. Wir zogen weiter nach Osten. Stunde um Stunde, Meile um Meile legten wir zurück. Die Sonne wanderte nach Süden und stieg höher und höher. Ödnis umgab uns. Das Pochen der Hufe waren die einzigen Geräusche. Im Staub glitzerten winzige Kristalle. Es gab keinen Schatten. Die Sonne stand fast senkrecht über uns. Die Schatten, die wir warfen, waren kurz.
Plötzlich trieben drei Reiter ihre Pferde um einen Felsen herum. Sie trugen helle Leinenanzüge und Strohhüte, und sie kamen direkt auf uns zu. Es handelte sich um bärtige Kerle. Einer trug einen Patronengurt schräg über der Brust. Ihre Gewehre hielten sie in den Händen.
Wir hielten an. Ich verspürte ein mulmiges Gefühl. Der einzige von uns, der bewaffnet war, war Joe. Aber gegen die drei verwegenen Kerle hatte er sicher keine Chance.
Juan, der hinter mir auf dem Pferd saß, sprang ab und ging den drei Reitern entgegen. Joe zog das Gewehr aus dem Scabbard und warf es mir zu. Seine Rechte legte sich auf den Knauf des Revolvers. Juan und die drei Reiter trafen aufeinander, sie zerrten die Pferde in den Stand. Ich hörte Stimmen, konnte aber nicht hören, was gesprochen wurde. Plötzlich schwang Juan herum und näherte sich uns. Die drei Reiter setzten ihre Pferde in Bewegung. Sie musterten uns durchdringend. Als Juan heran war, sagte er: »Sie gehören zu Ernesto und bestehen darauf, euch zu ihm zu bringen. Ihr solltet euch beugen.«
Ich nagte an meiner Unterlippe. Dann sagte ich: »Wir haben es eilig und möchten so schnell wie möglich die Grenze erreichen. Darum ...«
Einer der Kerle unterbrach mich schroff: »Ihr habt keine Wahl. Entweder ihr kommt freiwillig mit, oder wir zwingen euch. Wollt ihr hier sterben? Wollt ihr, dass eure Gebeine hier in der Sonne bleichen? Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es natürlich haben.«
Mit seinem letzten Wort richtete der Bursche das Gewehr auf mich und repetierte. Die beiden anderen schlugen die Waffen auf Joe an. Wir hätten es natürlich auf eine Schießerei ankommen lassen können – aber wahrscheinlich hätten wir auch Federn gelassen. Schüsse hätten außerdem Rurales auf uns aufmerksam machen können.
Es gab also mehrere Gründe, auf einen Kampf zu verzichten.
Juan stieg wieder zu mir aufs Pferd. Einer der Bravados ritt voraus, die beiden anderen kamen hinter uns. Die Hufschläge krachten auf dem steinigen Untergrund, manchmal klirrte es. Wir ritten zwischen den Hügeln, über denen die Luft waberte. Nach ungefähr zwei Stunden zogen wir in eine Schlucht. Stellenweise war sie mehr als hundert Yards breit, dann rückten die Felsen wieder eng zusammen, sodass zwei Reiter nebeneinander kaum Platz hatten. Die Felswände zu beiden Seiten stiegen senkrecht in die Höhe. Staub rieselte über die Kanten in die Tiefe. Der Boden war geröllübersät. Nach einiger Zeit ritten wir in eine Seitenschlucht hinein. Das Gelände stieg an. Die Felsen zu beiden Seiten wurden niedriger, und dann befanden wir uns auf einem Plateau, das von Felsmonumenten und Hügeln begrenzt wurde. Über dieses Plateau zogen wir hinweg, es ging wieder zwischen die Felsen, wir erreichten einen natürlich Pfad, der sich nach oben schlängelte und folgten ihm. Schließlich ritten wir in eine Senke, die von einem Bach zerschnitten wurde, der einen kleinen See speiste. Hütten aus Stein und Zelte waren rundherum errichtet. In einigen kleinen Corrals standen wohl an die zwanzig Pferde. Einige Frauen wuschen am Bach Wäsche. Kinder lärmten. Ein Hund begann zu bellen. Außerhalb des Dorfes weideten in Pferchen einige Schafe und Ziegen, in einem Koben befanden sich drei Schweine.
Aus den Hütten und Zelten kamen Männer. Finster betrachteten sie uns. Frauen und Kinder kamen heran. Wir ritten bis in die Mitte des Dorfes, wo uns drei Männer erwarteten, von denen einer einen dunklen Anzug trug. Er war bärtig. Seine Haare waren nackenlang. Sein Alter schätzte ich auf vierzig Jahre. Ich war davon überzeugt, Ernesto Esteban vor mir zu haben.
Wir hielten an. Einer der Kerle, die uns begleiteten, sagte etwas auf Spanisch. Estebans Blick verkrallte sich an Juan. Der Bursche begann zu sprechen – ebenfalls in seiner Muttersprache. Nachdem er geendet hatte, sagte Esteban: »Es war dumm von meinen Leuten, euch hierher zu bringen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Polizeireiter auf eurer Fährte kommen.«
»Es war nicht unser Wunsch, in dein Lager gebracht zu werden«, erklärte ich. »Wenn du es willst, verlassen wir es auf der Stelle wieder. Den Weg zurück finden wir sicherlich.«
»Ich kann euch nicht fortlassen«, versetzte Esteban. »Wenn euch die Rurales erwischen, werdet ihr unser Lager verraten. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen.«
»Wie lange willst du uns hier festhalten?«, fragte ich.
»Vielleicht lasse ich euch töten. Ich weiß es noch nicht.« Die Stimme des Mexikaners hob sich. »Fesselt sie an den Schweinekoben. Ich lasse mir was einfallen.«
Ich richtete das Gewehr auf den Bravado. Sofort zogen die Kerle, die uns umstanden, ihre Revolver und schlugen sie auf uns an. »Die Zeit, um dich zu erschießen, finde ich selbst noch mit einer Kugel im Kopf, Esteban«, stieß ich hervor.
Es knackte in der Runde, als die Bravados ihre Revolver spannten. Eine nervliche Zerreißprobe begann. In Estebans Mundwinkeln hatte sich ein brutaler Zug eingekerbt. »Runter mit dem Gewehr, Gringo! Ich zählte bis drei, und dann werden meine Männer abdrücken. Eins ...«
Den Tod vor Augen senkte ich das Gewehr. Ein Selbstmörder war ich nicht. Wir wurden von den Pferden gezerrt, zum Schweinekoben bugsiert und an den Stangen festgebunden. Ernesto Esteban trat heran. »Ich weiß noch nicht, was ich mit euch anfange. Vielleicht töte ich euch, vielleicht lasse ich euch in ein paar Tagen laufen. Ich mag euch Gringos nicht. Ihr seid überheblich. Nach euch beiden wird kein Hahn krähen.«
Er machte kehrt und schritt davon. Zwei Männer blieben zu unserer Bewachung zurück. Sie setzten sich in unserer Nähe auf den Boden. Nach einer halben Stunde etwa sattelten ein Dutzend Männer ihre Pferde, saßen auf und ritten davon. Sie verschwanden zwischen den Felsen.
Die Stunden verrannen. Die Wachen wurden abgewechselt. Stechmücken setzten uns zu. Der Tag neigte sich seinem Ende entgegen. Als es dunkel wurde, wurden im Dorf einige Feuer angezündet. Meine Arme waren taub. Wie gekreuzigt hingen wir an der oberen Querstange des Kobens. Die Fesseln hielten. Männer und Frauen fanden sich an den Feuern ein, Stimmendurcheinander und Gelächter schallten zu uns her. Die Männer ließen Flaschen kreisen. Wahrscheinlich Tequila oder Pulque.
Dann kehrte Ruhe ein im Dorf. Die Feuer gingen aus. Es war eine finstere Nacht. Wolken zogen über den Himmel, immer wieder verdunkelten sie das Mondlicht, Wolkenschatten glitten über das Land. Plötzlich hörte ich hinter mir ein leises Schaben, dann machte sich jemand an den Stricken zu schaffen, mit denen meine Arme an die Querstange gefesselt waren. Die Fesseln lockerten sich. Meine Arme waren frei. Ich drehte den Kopf und sah ein Schemen zu Joe hinhuschen. Kaum wahrnehmbare Geräusche verrieten, dass auch Joes Fesseln zertrennt wurden. Die schattenhafte Gestalt zog sich zurück, lief geduckt durch den Koben und wurde eins mit der Nacht.
Ich vermutete, dass es Juan war, der unsere Fesseln zerschnitten hatte. Jetzt lag es an uns, das Beste daraus zu machen. Es galt, die beiden Wachposten zu überwältigen und sich Pferde zu beschaffen. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.
»He, Muchacho«, rief ich halblaut.
Sofort erhob sich einer der Posten und kam heran. »Was willst du, Gringohund?«, radebrechte er.
»Gib mir zu trinken.«
Er trat vor mich hin. »Was möchtest du denn gerne? Pulque, vielleicht Bier oder Wein?« Er lachte. »Ich glaube, du wirst durstig in die Hölle fahren, Stinktier. Und da unten gibt es ...«
Ich rammte ihm die linke Faust in den Magen und hämmerte ihm die Rechte mit aller Wucht gegen den Kopf. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass sich Joe in Bewegung setzte. Der andere Wachposten begriff nicht sogleich. Der Kerl, dem ich einen Schlag versetzt hatte, brach zusammen.
Von dort, wo Joe den anderen Wachposten niedergerungen hatte, kam ein erstickter Laut. Ich bückte mich, nahm das Gewehr des Wachpostens an mich und zog ihm den Revolver aus dem Holster. Dann lief ich zu Joe hin. Er hatte seinen Arm von hinten um den Hals des Wachpostens gelegt und würgte ihn. Trotz der Dunkelheit konnte ich sehen, dass der Mund des Mexikaners weit aufgerissen war. Ich schlug ihm den Gewehrlauf gegen den Kopf, und als Joe ihn losließ, sank er zu Boden.
Joe nahm ihm die Waffen weg. Dann verloren wir keine Zeit. Wir rannten zu den Corrals. Auf Sättel mussten wir verzichten. Wir holten zwei Pferde heraus und warfen sich auf ihre Rücken. Dann trieben wir die Tiere an. Ich hielt mich mit einer Hand an der Mähne fest und lenkte das Pferd mit den Schenkeln. Wie von Furien gehetzt stoben wir in die Wildnis hinein.
*
Wir ritten viele Meilen durch die Nacht. Von Verfolgern war nichts zu hören. In einem Talkessel verbrachten wir den Rest der Nacht. Von nun an wurden wir auch von Estebans Bravados gejagt. Jede Meile, die wir bis zur Grenze zurückzulegen hatten, konnte die letzte sein. Wir waren nicht ausgerüstet für einen Ritt durch die Wildnis, hatten weder Proviant noch Wasser. Unsere Chancen waren die eines Schneeballs in der Hölle. Wir gaben uns keinen Illusionen hin.
Der Tag brach an. Joes Augen blickten müde drein. Sie waren gerötet. Sein Gesicht schien hohlwangiger geworden zu sein, die Augen lagen in tiefen Höhlen. Ich sah gewiss mindestens ebenso mitgenommen aus. Mein Horrortrip dauerte schließlich schon ein paar Tage länger. Ich verspürte Hunger und Durst. Wir mussten versuchen, ein Stück Wild zu schießen und Wasser zu finden. Die Pferde prusteten und peitschten mit den Schweifen.
Wir ritten weiter. Im Laufe des Vormittags erreichten wir ein Dorf. Ich sah einige Frauen und Kinder. Ein alter Mann hackte Holz. Auf der Plaza badeten die Hühner im Staub. Der Geruch von Urin, der von den Corrals am Dorfrand herwehte, erfüllte die Luft. Wir ritten zur Pulqueria und saßen davor ab. Da stand ein Tränketrog. Ein Staubfilm schwamm auf der Wasseroberfläche. Durstig tauchten die Pferde ihre Nasen hinein und soffen.
Wir wurden beobachtet. Jetzt waren auch einige Männer zu sehen. Als die Pferde ihren Durst gelöscht hatten, ging ich in das Wirtshaus. Es war ein niedriger Raum. Kein Mensch befand sich darin. Fliegen schwirrten durch die Luft und tanzten an den beiden kleinen Fenstern auf und ab. »Hallo!«, rief ich.
Hinter der Theke ging eine Tür auf und eine junge Frau kam in den Schankraum. »Hola, Americano. Was kann ich für dich tun?«
»Besitzt die Pulqueria einen Stall, in dem wir unsere Pferde unterstellen können?«
»Ich sage Felipe Bescheid. Er wird sich um eure Pferde kümmern.«
»Danke. Wir haben Hunger und Durst. Kannst du uns etwas zu essen machen?«
»Wie viele Männer seid ihr denn?«
»Zwei.«
Die Señorita verschwand wieder durch die Tür. Ich ging nach draußen. Joe stand zwischen den beiden Pferden und hielt sie an den Mähnen fest. Sein Gewehr lehnte am Tränketrog. Es dauerte nicht lange, dann erschien ein Halbwüchsiger. »Ich soll mich um eure Pferde kümmern. He, die Tiere sind weder gesattelt noch gezäumt.«
»Sie stammen aus Ernesto Estebans Lager«, sagte ich. »Wir hatten es ziemlich eilig, fortzukommen und hatten nicht die Zeit, uns Sättel und Zaumzeuge zu beschaffen.«
Ungläubig starrte mich der Bursche an. »Ihr wart in Estebans Dorf?«
»Ja«, bestätigte Joe. »Ein nicht gerade freundlicher Zeitgenosse.«
Der Junge nahm die Pferde an den Mähnen und führte sie in den Hof der Pulqueria. Wir gingen in den Schankraum und setzten uns. Die Señorita erschien und lächelte. »Ich bin Juanita. Euer Essen steht auf dem Ofen. Felipe versorgt eure Pferde.«
»Du bist sehr freundlich«, sagte ich. »Wir sind sehr müde. Kann man hier ein paar Stunden ungestört ausruhen?«
»Wir haben keine Zimmer«, erklärte Juanita. »Aber ihr könnt im Stall schlafen. Niemand wird euch stören. Im Heu ist es bequem.«
»Sicher«, versetzte ich. »Wir werden dein Angebot in Anspruch nehmen. Gib uns zwei Bier.«
Gleich darauf brachte sie die zwei Krüge. Wir tranken durstig. Joe holte sein Rauchzeug aus der Tasche und wir drehten uns Zigaretten. Dann rauchten wir. Schließlich kam das Essen. Juanita stellte zwei Teller vor uns hin, die mit einem Pampf aus roten Bohnen und Fleischbrocken gefüllt waren. Würziger Duft stieg mir in die Nase. Heißhungrig schaufelten wir das Essen in uns hinein. Es schmeckte vorzüglich. Nachdem wir gegessen und getrunken hatten, begaben wir uns in den Stall. Unsere Pferde standen in Boxen. Wir stiegen auf den Zwischenboden, auf dem Heu gelagert wurde, zogen die Leiter nach oben und legten uns ins Heu. Ich schloss die Augen und schlief sofort ein ...
*
Ich wachte auf. Durch die Ritzen in den Bretterwänden sickerte grelles Tageslicht. Es dauerte kurze Zeit, bis ich mich zurechtfand. Neben mir lag Joe und atmete tief. Die Geräusche des Dorfes sickerten an mein Gehör. Ich erhob mich. Heureste fielen von meiner Kleidung. Joe weckte ich nicht. Ich ließ die Leiter nach unten, nahm mein Gewehr und stieg hinunter. Das Stalltor stand offen. Ich schritt über die Schattengrenze und wurde einen Moment vom gleißenden Licht geblendet. Wenig später betrat ich die Pulqueria. Einige Männer saßen an den Tischen. Sie starrten mich an. Hinter der Theke stand nicht Juanita, sondern ein Mann mit ölig glänzenden, straff zurückgekämmten Haaren, der sich eine ehemals weiße Schürze umgebunden hatte.
Ich verließ den Schankraum wieder. Dem Stand der Sonne nach mochte es um die Mitte des Nachmittags sein. Mein Instinkt meldete mir Gefahr. Ich wusste nicht, woher dieses Gefühl kam. Es war einfach da und ließ sich nicht verdrängen. Ich ging zum westlichen Ende des Dorfes und ließ meinen Blick in die Runde schweifen. Die Gipfel der Felsen erhoben sich wie riesige Mahnmale – wie überdimensionale Grabsteine in einem Land, in dem man seine Lektionen entweder schnell lernte oder kläglich unterging.
Und vor der Kulisse eines dieser Felsen sah ich die Staubfahne, und im nächsten Moment nahm ich die winzigen, schwarzen Punkt wahr, die sich vor dieser Staubfahne bewegten. Es durchrann mich wie ein Fieberschauer. Die Reiter näherten sich dem Dorf. Ich presste sekundenlang die Lippen zusammen und verspürte Bitternis. Da wir in diesem Land keine Freunde hatten, konnte es sich nur um Gegner handeln.
Schnell lief ich zurück, betrat den Stall und rief: »Joe, he Joe! Hoch mit dir! Dem Dorf nähern sich ein Dutzend Reiter. Wir müssen verschwinden.«
Joe kam schnell nach unten. Wir holten unsere Pferde aus den Boxen. An der Stallwand hingen einige Zaumzeuge. Ich holte zwei, wir legten sie den Pferden an. So ließen sie sich viel leichter lenken. Joe legte für die beiden Zaumzeuge zehn Dollar auf eine Futterkiste. Dann zogen wir die Pferde ins Freie und schwangen uns auf ihre Rücken, trieben sie an, lenkten sie hinaus auf die Plaza und ließen sie laufen. Im gestreckten Galopp sprengten wir nach Osten davon.
Nach einer Stunde ziemlich scharfen Ritts zügelten wir die Pferde. Von den Nüstern der Tiere troff Schaum. Sie waren schweißnass. Die Pferde röchelten und röhrten. Wir hatten die Tiere ziemlich verausgabt. Wir befanden uns zwischen hohen Felsen. Je höher wir gekommen waren, umso heißer schien die Sonne herabzubrennen. Es war, als berührten Flammen mein Gesicht.
Wir saßen ab. Joe sagte: »Was waren das wohl für Kerle? Rurales oder Banditen? Mich würde auch interessieren, ob die Dorfbewohner sie verständigt haben.«
»Ob Rurales oder Bravados«, versetzte ich. »Für uns ist das eine ebenso schlimm wie das andere. Wenn wir ...«
»Horch!«
Ich lauschte angespannt. Fernes Pochen drang an mein Gehör. Reiter! Es war uns also nicht gelungen, das Rudel abzuhängen. Betroffen schauten wir uns an.
»Die sind schlimmer als Bluthunde«, murmelte Joe. Und nach einem Blick auf die Pferde sprach er weiter: »Die Tiere sind ziemlich abgetrieben. Wenn wir sie weiterhin so treiben, reiten wir sie zuschanden.«
»Du hast recht«, sagte ich. »Wir müssen den Pferden Ruhe gönnen. Wenn sie schlapp machen, sind wir verloren. Komm!«
Wir führten die Pferde. Es ging immer höher hinauf. Stellenweise war der Anstieg steil und kaum zu bewältigen. Wie Säulen stemmten die Pferde die Hinterbeine gegen das Zurückgleiten. Schließlich wurde das Gelände flacher und wir kamen auf eine Hochfläche. Im Osten erhoben sich unüberwindlich anmuteten Felsbastionen. Die Gipfel der Felsen ragten in ein Meer aus weißen Wolken hinein. Nach Süden wollten wir nicht. Auch dort zogen sich Felswände. Die schwarzen Einschnitte waren Schluchten, Klüfte und Spalten. Im Norden schien das Plateau an einer Schlucht zu enden. Und obwohl es dort kein Weiterkommen zu geben schien, wandten wir uns in diese Richtung. Wir beschlossen, einfach der Schlucht nach Osten zu folgen, bis wir einen Abstieg fanden.
Die Berge im Osten rückten näher. Die Wände des Canyons, an dem wir entlangritten, wurden weniger steil, und ein natürlicher Pfad, der zwischen oftmals haushohen Felsen verlief, führte in die Tiefe. Wir traten Steinbrocken los, die auf dem Grund der Schlucht zerschellten. Der Abstieg war nicht ungefährlich. Die Pferde schnaubten erregt. Wir verbanden ihnen mit unseren Halstüchern die Augen und führten sie. Und dann erreichten wir den Grund des Canyons. Die Flanken der Tiere zitterten. Hufschläge wurden laut. Wir saßen auf und ritten zwischen den Felsen nach Osten. Irgendwo musste die Schlucht enden, sodass wir uns wieder in nördliche Richtung wenden konnten.
Als uns der Knall eines Schusses einholte, zügelte ich das Pferd und wandte mich um. Oben, am Rand der Schlucht, verhielten über ein halbes Dutzend Reiter. Wieder peitschte ein Gewehr. Ein Querschläger quarrte durchdringend. Und dann dröhnte eine ganze Salve. Aber die Entfernung war zu weit für eine Kugel. Und wir trieben die Pferde an. Im stiebenden Galopp fegten wir zwischen den Felsen dahin. Als ich mich einmal umschaute, sah ich, dass sich drei der Reiter an den Abstieg machten. Die anderen ritten wahrscheinlich oben am Rand der Schlucht entlang, um uns dort, wo sie endete, den Weg zu verlegen. Wenn es ihnen gelang, uns in dem Canyon festzunageln, würden wir in der Falle sitzen.
»Das waren keine Rurales!«, schrie mir Joe zu. Der Reitwind riss ihm die Worte von den Lippen. Mit einem Handzeichen bedeutete ich meinem Gefährten, dass ich verstanden hatte.
Die Felsen traten zusammen. Ich hatte das Gefühl, mich in einem riesigen, steinernen Grab zu bewegen. Die Geräusche hörten sich melodiös an und wurden von den Echos verstärkt. Über uns färbte sich der Himmel grau. Wir zügelten die Pferde und lauschten. Wie eine Botschaft von Untergang und Tod wehten ferne Hufschläge an unser Gehör.
»Ob uns die Rurales auch noch verfolgen?«, fragte Joe.
»Ich denke nicht. Das schließt aber nicht aus, dass wir einer Patrouille der Polizeireiter vor die Mündungen reiten können.«
Wir ritten weiter. Die Schleier der Abenddämmerung senkten sich zwischen die Felsen. Und dann erreichten wir einen Seitencanyon, der nach Norden abzweigte. Wir folgten ihm, in der Hoffnung, dass wir in keinen Sackcanyon ritten und irgendwann vor einer Felswand standen, die ein Weiterkommen unmöglich machte.
Dann wurde es finster. Der Mond befand sich irgendwo hinter den Felsen. Am Himmel blinkten vereinzelte Sterne. Ihr Licht reichte nicht aus, um auf den Grund der Schlucht zu dringen. Es war finster wie im Schlund der Hölle. Wenn wir nicht wollten, dass sich unsere Pferde die Beine brachen, mussten wir anhalten.
Wir lagerten am Rand einer der Felswände. Ich verspürte Durst. Wie ein trockenes Blatt klebte meine Zunge am Gaumen. Und Joe ging es sicher nicht besser als mir. Die Hufschläge, die wir vernommen hatten, waren nicht mehr zu hören. Ich glaubte aber nicht daran, dass wir unsere Verfolger abgehängt hatten.
»Ich übernehme die erste Wache«, gab ich zu verstehen. Die Pferde hatten wir an einen dornigen Strauch gebunden. Joe legte sich neben der Felswand auf den Boden. Ich entfernte mich ein Stück und setzte mich auf einen Felsbrocken. Das Säuseln des Windes, der sich an den Kanten und Vorsprüngen brach, umgab mich. Die Finsternis mutete geradezu stofflich und greifbar an. Es war kühl.
Irgendwann erreichte ein Klirren mein Gehör. Es hörte sich an, wie wenn Stahl gegen Stein stößt. Augenblicklich waren meine Nerven zum Zerreißen angespannt. Ich erhob mich und lauschte dem Geräusch hinterher. In mir begannen die Alarmglocken zu läuten. Mechanisch repetierte ich das Gewehr. Das trockene Knacken verwehte.
Leises Mahlen war zu hören, ein Schaben, wie wenn rauer Leinenstoff übereinander reibt. Ich glitt zu Joe hin. Mein Partner hatte sich aufgesetzt. »Ich glaube, wir sind nicht mehr allein«, flüsterte ich.
»Ich habe es auch gehört.« Joe erhob sich.
Plötzlich blitzte es ein Stück von uns entfernt auf. Der Knall des Schusses zerriss die Stille, aufbrüllend antworteten die Echos. Schritte trampelten. Der Schuss war das Signal gewesen. Die Nacht wurde lebendig. Ich sah schattenhafte Gestalten, die die Dunkelheit auszuspucken schien. Ich schoss aus der Hüfte. Ein Mündungsblitz stieß aus dem Lauf. Der Knall wurde den Angreifern entgegengeschleudert. Und nun begann auch Joes Gewehr zu sprechen. Geschrei mischte sich in den Lärm. Ein dumpfer Fall war zu hören. Ich veränderte nach jedem Schuss meine Stellung. Mündungslichter ließen die Schützen für Bruchteile von Sekunden aus der Finsternis.
Es gelang uns, die Angreifer zurückzuschlagen. Sie verschwanden, als hätte sie die Erde geschluckt. Die letzten Echos verklangen mit geisterhaftem Geraune. Die Stille, die sich zwischen die Felsen senkte, mutete erdrückend an.
Joe saß am Boden. »Verdammt«, ächzte er, »es hat mich erwischt. Die Schulter ...«
Ich murmelte eine Verwünschung. »Ist es schlimm?«
»Die Kugel steckt drin. Zur Hölle damit!«
»Wir müssen von hier verschwinden. Schaffst du das?«
»Natürlich.«
Wir banden die Pferde los und führten sie in die Finsternis hinein. Das ging nicht geräuschlos vonstatten. Die Hufe krachten und klirrten. Manchmal stöhnte Joe. Wahrscheinlich quälten ihn unerträgliche Schmerzen. Außerdem verlor er Blut. Und der Blutverlust würde ihn schwächen.
Manchmal hielten wir an, um zu lauschen. Unsere Gegner folgten uns. Sorge befiel mich. Wir mussten damit rechnen, dass irgendwo die andere Hälfte des Rudels im Hinterhalt lag. Eine Ausweichmöglichkeit hatten wir nicht. Der Rückweg war uns verlegt.
»Wie geht es dir?«, fragte ich Joe.
»Die Schmerzen sind kaum zu ertragen«, erwiderte mein Partner. »Ich verliere Blut ...«
Ich hatte keine Ahnung, wie weit wir gekommen waren, als vor uns ein Pferd wieherte. Mir war klar, dass uns die Banditen zwischen sich hatten. »Wir bleiben hier«, murmelte ich. Wir lagerten. Die Geräusche hinter uns brachen ab. Plötzlich ertönte es vor uns: »Ihr kommt hier nicht durch, Gringos. Warum ergebt ihr euch nicht?«
»Gehört ihr zu Esteban?«, rief ich.
»Si, si. Esteban wird Juan die Ohren abschneiden, weil er euch befreit hat. Was ist nun? Ergebt ihr euch?«
»Nein.«
Der Kerl lachte abfällig. »Dann werdet ihr hier in der Schlucht euer Grab finden.«
Darauf gab ich keine Antwort.
»Gib mir dein Halstuch, Logan«, murmelte Joe. »Meins ist schon vom Blut durchnässt.« Ich knüpfte es ab und gab es ihm. Joe murmelte: »Ich werde dir nur noch ein Klotz am Bein sein, Logan-Amigo. Versuch, alleine durchzubrechen. Ich werde dir die Kerle, die hinter uns kommen, vom Leib halten. So kommt vielleicht wenigstens einer von uns durch.«
»Vergiss es«, knurrte ich.
»Aber ...«
»Kommt nicht in Frage, Partner. Ich lass dich hier nicht zurück.«
*
Die Finsternis lichtete sich. Der Himmel über der Schlucht nahm eine bleigraue Farbe an. Morgendunst hing zwischen den Felsen. »Okay«, murmelte ich. »Sichere du nach hinten, Joe. Ich werde den Weg für uns freimachen.«
»Ein Himmelfahrtskommando«, gab Joe zu bedenken.
»Unsere einzige Chance«, versetzte ich. »Gib mir deinen Revolver.«
Joe gab mir die Waffe, ich überließ ihm mein Gewehr. Im Nahkampf war der Revolver handlicher als die Winchester. Ich schob Joes Sechsschüsser in den Hosenbund und war jetzt mit zwei Revolvern bewaffnet. Dann schnallte ich die Sporen ab, damit mich ihr leises Klingeln nicht verriet.
»Hals- und Beinbruch, Logan-Amigo.«
»Wird schon schiefgehen«, versetzte ich, dann huschte ich davon. Ich pirschte geduckt an der Felswand entlang. Noch war es finster genug, sodass mit den Augen nur die allernächste Umgebung wahrzunehmen war. Ich bewegte mich leise wie eine Katze.
Dann hörte ich Schnauben und Stampfen. Ich befand mich in der Nähe der Bravados. Mit angehaltenem Atem lauschte ich. Dann schlich ich weiter und schließlich sah ich einen der Kerle. Er saß auf einem Felsbrocken. Ich zog den Revolver. Der Kerl rührte sich nicht. Ich vermutete, dass seine Gefährten auch nicht weit entfernt waren.
Ich glitt weiter. Die Gestalt wurde deutlicher. Sie wandte mir das Gesicht zu. Ich schob mich an der Felswand weiter, kam auf eine Höhe mit dem Burschen, schlich weiter und sah nach etwa dreißig Yards an der Felswand drei längliche Bündel liegen.
Wir hatten es also mit vier Gegnern zu tun. Ich kehrte um und näherte mich dem Wachposten von hinten. Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen. Hinter dem Burschen richtete ich mich auf. In dem Moment schien er die Gefahr zu wittern. Vielleicht warnte ihn sein Instinkt. Er zuckte herum. In dem Moment schlug ich zu. Er stieß einen Schrei aus. Mein zweiter Schlag fällte ihn. Er fiel mir vor die Füße.
»Ramon!«, erklang es vom Lagerplatz her.
Ich schlug dem Gewehr des Banditen den Kolben ab, zog ihm den Revolver aus dem Holster und warf ihn in die Schlucht hinein. Dann war es still. Ich glitt zur Felswand und wartete. Ein Schemen schälte sich aus der Nacht. Geduckt kam die Gestalt näher. Ein Stück entfernt löste sich ein zweiter Schemen aus der Dunkelheit. Ich zielte auf die Beine eines der Kerle und feuerte. Aufbrüllend ging er zu Boden. Der andere warf sich flach auf den Boden und schoss. Aber ich war schon ein Stück zur Seite gehuscht. Die Kugel klatschte gegen den Felsen und jaulte in die Schlucht hinein. Ich feuerte auf das Mündungslicht und lief weiter an der Felswand entlang. Und jetzt sah ich den dritten der Kerle. Er stand bei einem hüfthohen Felsbrocken und schien die Pferde zu sichern.
In der Schlucht begann es fürchterlich zu krachen. Die Kerle, die uns gefolgt waren, stürmten gegen Joe an. Ich konnte nur hoffen, dass mein Partner standhielt. Die Schluchtwände warfen die Detonationen zurück, sie stauten sich und verschmolzen mit dem Krachen weiterer Schüsse.
Ich umging den Burschen bei dem Felsbrocken und gelangte hinter ihn, dann rannte ich auf ihn zu. Er schien mich zu hören, denn er wirbelte herum und feuerte. Ich sprang zur Seite und schoss zurück. Die Gestalt ging zu Boden, feuerte aber noch einmal. Die Kugel strich mir heiß über den linken Oberarm. Es war wie ein Peitschenhieb. Der Revolver in meiner Faust bäumte sich auf. In den Knall hinein war ein Gurgeln zu hören. Ich lief zu dem Burschen hin und riss ihm das Gewehr aus den Händen, schleuderte es davon und tastete nach dem Revolver des Bravados. Ich ließ den Sechsschüsser dem Gewehr folgen. Der Kerl rührte sich nicht mehr. Ich glitt weiter. Ich hatte es noch mit zwei Gegnern zu tun, wovon einer meine Kugel im Bein hatte. Aber das machte ihn sicher nicht kampfunfähig.
In der Schlucht wurde nach wie vor geschossen. Wenn auch die Schüsse nicht mehr so rasend fielen wie zu Beginn des Kampfes. Solange es krachte, wusste ich, dass Joe den Bravados Paroli bot, und ich konnte mich auf meine Aufgabe konzentrieren.
Plötzlich sah ich den Schemen neben der Felswand. Er schien mich im selben Augenblick wahrzunehmen, denn bei ihm glühte es auf. Auch ich schoss und spürte den sengenden Hauch der Banditenkugel. Die Gestalt rutschte an der Felswand zu Boden. Und da glühte es auch schon rechter Hand von mir auf. Aber im selben Moment bewegte ich mich. Und dann schoss ich auf das Mündungsfeuer. Zwei Schüsse jagte ich aus dem Lauf, dann schlug der Hammer auf eine leere Patrone. Ich stieß den Revolver ins Holster, das mir die Rurales nicht abgenommen hatten, und zog die Waffe, die ich von Joe bekommen hatte. Mit meinem letzten Schuss war ich auf das linke Knie niedergegangen.
Dort, wo ich den Banditen zuletzt gesehen hatte, rührte sich nichts. Hatte ich ihn getroffen? Ich setzte alles auf eine Karte und richtete mich auf. Mit dem Aufblitzen des Banditencolts warf ich mir zur Seite. Und ich schickte dem Kerl noch einmal zwei Kugeln. Jetzt vernahm ich einen dumpfen Aufprall. Ich huschte zu dem Kerl hin und entwaffnete ihn. Reglos lag er da. Ich nahm mir nicht die Zeit, zu prüfen, ob er tot war, sondern setzte mich in Bewegung, um Joe beizustehen. Ich kam keine zwanzig Schritte weit, als ich rechter Hand die huschende Bewegung wahrnahm. Und dann warf sich eine Gestalt auf mich. Es war der Wachposten, den ich niedergeschlagen hatte und der wieder zu sich gekommen war. Er kaum auf mich zu liegen, seine rechte Faust zuckte in die Höhe, ich sah das matte Funkeln und begriff, dass er einen Dolch in der Hand hielt. Als seine Faust nach unten zuckte, bäumte ich mich auf und warf mich herum. Er kippte zur Seite. Das Messer verfehlte mich. Ich schlug dem Kerl den Revolver gegen den Kopf und er fiel um. Schnell erhob ich mich. Der Mexikaner am Boden röchelte. Ich beugte mich über ihn und schlug noch einmal mit dem Revolver zu. Jetzt schwieg er.
Ich rannte los. In der Schlucht fielen nur noch vereinzelt die Schüsse. Joe kauerte hinter einem Felsblock. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. »Komm«, presste ich hervor. »Auf uns warten vier gesattelte Pferde.«
Wir glitten durch die Dunkelheit, die nicht mehr so dicht und dabei war, sich in diesiges Grau zu verwandeln. Die Pferde drängten sich, nervös vom Kampflärm, zusammen und prusteten. Wir banden sie los und saßen auf. Jeder von uns führte ein zweites Tier am langen Zügel. Als säße uns der Leibhaftige im Nacken jagten wir tiefer in die Schlucht hinein.
Die Schlucht endete und wir durchritten ein Tal. Es war jetzt fast hell. An den Sätteln hingen Wasserflaschen. Endlich konnten wir unseren Durst löschen.
Joe sah schlecht aus. Unter seinen fiebrigen Augen lagen dunkle Ringe. Nach vorne gekrümmt saß er auf dem Pferd. Ich zügelte und auch Joe hielt an. »Ich will mir deine Wunde ansehen«, sagte ich und glitt vom Pferd. Auch mein Gefährte stieg ab. Er verzog das Gesicht. Seine Beine knickten ein. Er ächzte. Dann saß er am Boden und ich half ihm, Weste und Hemd auszuziehen. Die Kugel war ihm unter dem Schlüsselbein in die Schulter gefahren. Die linke Seite seines Oberkörpers war mit Blut verklebt. Das Stück Blei steckte in der Schulter.
Ich holte eine Flasche von einem der Sättel und wusch das Blut ab. Die Wunde hatte zu bluten aufgehört. Um das Einschussloch herum hatte sich die Haut entzündet. Ich suchte in den Satteltaschen nach Verbandszeug, und fand sogar eine flache, verbeulte Messingflasche, in der ich Schnaps vermutete. Es war Tequila. Ich schüttete etwas über die Wunde, Joe sog die Luft durch die Zähne, weil die scharfe Flüssigkeit wie Feuer brannte, dann legte ich meinem Gefährten einen Verband an. Danach half ich ihm wieder, das Hemd und die Weste anzuziehen.
Längst hatten wir die Orientierung verloren. Wir hatten nicht den geringsten Hauch einer Ahnung, wo wir uns befanden und wie weit wir noch bis zur Grenze hatten. Hunger rumorte in unseren Eingeweiden. Als ich zum Himmel blickte, sah ich einige Aasgeier, die lautlos ihre Bahnen zogen.
Wir ritten wieder nach Norden. Die Steinwüste endete. Steppenartige Wildnis schloss sich an. Hier wuchsen dornige Sträucher und hartes, braunverbranntes Büschelgras. Hügel buckelten im Westen und vor uns. Über einen der Hügel sah ich eine Rauchfahne steigen. Wir ritten den Hügel hinauf, ich saß unterhalb des Kammes ab und lief das letzte Stück, und dann sah ich in dem sich anschließenden Tal die Hazienda. Ein großer, flacher Bau diente als Wohnhaus, es gab Ställe, Schuppen und eine große Scheune, Corrals mit Pferden, Pferche mit Schafen und Ziegen und eine Koppel, auf der zwei Milchkühe weideten. Rauch stieg aus dem Schornstein. Bei den Corrals waren vier Vaqueros dabei, Pferd auszusondern. Rund um das Anwesen weideten Rudel von Rindern. Ein schmaler Creek floss an den Gebäuden vorbei nach Norden, wahrscheinlich zum Rio Grande.
Wir ritten hinunter ...
*
Die Vaqueros wurden auf uns aufmerksam, hielten in ihrer Arbeit inne und beobachteten uns. Ein Mann kam aus dem Stall, ein anderer aus einem der Schuppen. Wir ritten bis vor das Wohnhaus und zügelten. Eine Frau kam ins Freie. Sie war atemberaubend. Lange, schwarze Haare fielen in leichten Wellen über ihre Schultern und auf ihren Rücken. Das Gesicht war von einer Rasse, die ihresgleichen suchte. Sie zog mich in ihren Bann. Die Augen waren groß und dunkel, der Mund rot und sinnlich. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Rock, einer weißen Bluse und einer braunen Lederweste, die kunstvoll bestickt war.
Etwas misstrauisch musterte sie uns. Wir grüßten. Ich stieg vom Pferd und trat vor sie hin. »Entschuldigen Sie die Störung, Señora«, sagte ich. »Wir sind zwei Gesetzesbeamte aus Texas und sind auf dem Weg in die Staaten. Mein Kollege hat eine Kugel in der Schulter. Wir sind hungrig und durstig ...«
»Verfolgen euch die Rurales?«
»Nein«, sagte ich. »Die Bluthunde von Ernesto Esteban haben uns gejagt. Wir haben keine Ahnung, wie weit es noch bis zur Grenze ist. Bitte, helfen Sie uns.«
»Ich bin Maria Vasquez. Die Hazienda gehört meinem Bruder. Er befindet sich in San Pedro. Ihr Kollege schaut schlecht aus, Hombre. Haben Sie auch Namen?«
»Ich bin Bill Logan, das ist Joe Hawk.«
»Natürlich werde ich euch Gastfreundschaft gewähren«, sagte Maria. »Kommt herein.«
Ich half Joe vom Pferd. Er war bleich. Die Linien in seinem Gesicht schienen sich vertieft zu haben. »Es geht schon«, murmelte er und gab sich einen Ruck. Maria gebot einem der Männer, sich um unsere Pferde zu kümmern, dann ging sie vor uns her ins Haus. In der Küche bot sie uns Sitzplätze am Tisch an. Dann trug sie Schinken und Brot auf, zu trinken gab es Milch. Wir ließen uns nicht zweimal bitten und griffen zu. Maria sagte: »Bis zur Grenze sind es noch fast vierzig Meilen. Mit der Kugel in der Schulter schaffen Sie das nicht.«
»Ich muss es schaffen«, versetzte Joe.
»Ich will mir, wenn Sie gegessen haben, die Wunde ansehen.«
»Haben Sie Erfahrung in der Behandlung von Wunden, Ma'am?«, fragte ich.
»Unsere Männer verletzen sich immer wieder einmal«, antwortete Maria. »Dann verarzte ich sie. Alles, was ich brauche, habe ich im Haus. Wenn ich nicht helfen kann, dann holen wir aus San Pedro den Arzt. Nun, wir werden es sehen.«
Nachdem wir gegessen hatten, begutachtete sie die Wunde. Der Entzündungshof um die Wunde war etwas größer geworden. Meine Desinfektion mit Tequila war also nutzlos gewesen. Maria sagte: »Die Kugel muss raus, sonst zieht sich Wundbrand hinzu und dann stirbt Ihr Kollege. Ich werde sie ihm herausholen. Natürlich können Sie die Nacht über auf der Hazienda bleiben. Mein Bruder wird nichts dagegen haben.«
Sie legte Holz ins Feuer und setzte einen Topf voll Wasser auf die Platte des gemauerten Herdes. Dann holte sie aus einer Schublade eine lange Pinzette sowie ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel und Verbandszeug. Als das Wasser kochte, hielt sie die Pinzette hinein. Dann kam sie auf Joe zu und sagte: »Sie müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, Señor. Es wird sehr, sehr wehtun.«
»Machen Sie nur, Señorita«, knurrte Joe und fügte sarkastisch hinzu: »Gelobt sei, was hart macht.«
Sie schob die Pinzette in den Wundkanal. Joes Zähne knirschten übereinander. Er hielt die Luft an. Blut sickerte aus der Wunde und rann über seine Brust. Schweiß glitzerte auf seiner Stirn. Dann hielt er es nicht mehr aus und sein Laut, der sich anhörte wie trockenes Schluchzen, stieg aus seiner Kehle.
Maria zog die Pinzette heraus. Sie warf die Kugel auf ein Tuch, das auf dem Tisch lag. Joe sank auf dem Stuhl zurück. Maria legte ein zusammengefaltetes Stück Leinen auf die Wunde. Joes Atem ging stoßweise. Der Schmerz hatte ihm die Tränen in die Augen getrieben.
Maria arbeitete geschickt und sicher. Sie stillte die Blutung, desinfizierte die Wunde und verband Joe. Dann sagte sie: »Sie sollten sich jetzt hinlegen. Suchen Sie sich ein Bett in der Mannschaftsunterkunft. Die meisten Vaqueros befinden sich auf der Weide. Es sind also viele Betten frei.«
Ich half Joe ins Hemd und in die Weste, dann begaben wir uns gemeinsam in das Schlafhaus. Als Joe im Bett lag, kehrte ich ins Haupthaus zurück. Maria führte mich in einen Wohnraum, der gediegen eingerichtet war. Sie schenkte uns roten Wein ein, der wie Rubin in den Gläsern funkelte. Er schmeckte vorzüglich.
»Was für ein Gesetzesbeamter sind Sie, Señor Logan?«, fragte Maria.
»U.S. Deputy Marshal im texanischen Panhandle, das ist in Nordtexas.« Ich dachte kurz nach. »Wir haben Viehdiebe über die Grenze verfolgt. Aber die Rurales waren schneller als wir und haben uns die Kerle vor der Nase weggeschnappt. Auf dem Rückweg gerieten wir in einen Hinterhalt der Banditen Estebans. Sie brachten uns in ihr Lager. Uns gelang die Flucht ...«
»Esteban kämpft für mehr Gerechtigkeit im Land«, sagte Maria. »Polizei und Militär sind oftmals korrupt in Mexiko. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Viele meinen, dass längst wieder einmal eine Revolution fällig wäre. Und es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis das Volk auf die Barrikaden geht und Truppen nach Mexiko City ziehen, um die Regierung zum Teufel zu jagen.«
»Revolution ist ein blutiges Geschäft«, knurrte ich.
»Ernesto Esteban wäre der Mann, der eine Revolution führen könnte. Er hat viele Anhänger. El Vengador nennen ihn viele – der Rächer. Die große Unterstützung, die er beim Volk genießt, ist auch der Grund, weshalb ihn bisher die Rurales nicht schnappen konnten. Niemand würde es einfallen, El Vengador zu verraten.«
Ich hatte eine andere Meinung von Esteban, hielt aber damit hinter dem Berg. Ich wollte unsere Gastgeberin nicht verärgern. »Seine Angst war es, dass wir ihn an die Polizei verraten könnten«, erklärte ich. »Er drohte, uns zu töten. Ich weiß nicht, ob er uns wirklich umgebracht hätte.«
In dem Moment erklangen draußen Hufschläge. Maria erhob sich. »Das wird Roberto sein.« Sie verschwand im Flur. Ich nippte an meinem Wein. Es dauerte nicht lange, dann waren schwere Tritte zu hören. Wenig später betrat ein mittelgroßer, schwarzhaariger Mann die Wohnstube. Er war um die dreißig und glatt rasiert, seine Haut über Kinn und Wangen wies die schwarze Schattierung auf, die auf einen starken Bartwuchs schließen ließ. Hinter ihm kam Maria.
Ich stand auf und ging um den Tisch herum. »Guten Tag, Señor Vasquez. Ihre Schwester hat uns Gastfreundschaft gewährt. Ich denke, sie hat Ihnen alles erzählt.«
»Ich weiß nicht, ob ich glücklich darüber sein soll, dass Sie sich auf unsere Hazienda verirrt haben«, sagte Vasquez. »Hinter Ihnen ist El Vengador her. Und sicher wird er jeden als seinen Feind behandeln, der Ihnen hilft.«
»Mein Gefährte ist verwundet, wir hatten Hunger und Durst. Wir ...«
Der Bursche winkte ab. »Machen Sie sich keine Gedanken. Nun sind Sie einmal hier. Beten wir, dass die Bravados Ihre Spur verloren haben. Wie lange werden Sie bleiben?«
»Nur diese Nacht, bis sich mein Freund etwas erholt hat. Der Blutverlust hat ihn ziemlich geschwächt.«
»Es ist in Ordnung.«
Wir setzten uns, Maria schenkte auch ihrem Bruder ein Glas Wein ein. Ich erzählte auch ihm die Geschichte, die ich seiner Schwester erzählt hatte. Die beiden sollten nicht erfahren, dass wir auch von der mexikanischen Polizei gesucht wurden. Das Abendessen nahm ich am Tisch der beiden ein. Dann brachte ich Joe eine Portion. Ich schaute ihm zu. Als er fertig war, brachte ich das Geschirr in die Küche. Maria war dabei, abzuspülen. Sie sagte: »Roberto befindet sich in der Wohnstube. Er hat sicher nichts dagegen, wenn Sie ihm Gesellschaft leisten.«
Mir steckte jedoch die Müdigkeit wie Blei in den Knochen, und das sagte ich Maria. Sie lächelte. Ihre Lippen gaben eine Reihe perlweißer, ebenmäßiger Zähne frei. O verdammt, war das eine schöne und begehrenswerte Frau. Im trüben Licht wirkten ihre Züge besonders weich und gelöst. Ihr Hals war schlank, die Linie des feingeformten Kinns makellos. Ein erregender Hauch von Fraulichkeit ging von ihr aus. Ihr Blick war unergründlich. »Dann sollten Sie sich aufs Ohr legen, Logan«, sagte sie. »Schlafen Sie gut.«
»Vielen Dank«, sagte ich und kehrte in die Mannschaftsunterkunft zurück.
Ich wurde wach, als ich laute Stimmen hörte. Es dauerte einige Herzschläge lang, bis ich mich zurechtfand. Ein Pferd wieherte. Durch die kleinen Fenster sickerte etwas Mondlicht. Einige der Männer im Schlafhaus waren wach geworden und saßen auf ihren Betten. Einer erhob sich, ging zum Fenster und öffnete es.
»... nichts von den beiden Gringos gesehen!«, hörte ich eine dunkle Stimme sagen. »Bestellt Ernesto schöne Grüße von mir. Sollten die beiden Gringos noch auftauchen, schicke ich einen Boten.«
Obwohl Roberto Vasquez spanisch sprach, konnte ich mir zusammenreimen, was er gesagt hatte.
Hufgetrappel entfernte sich. Die Banditen hatten also noch immer nicht aufgegeben. Und bis zur Grenze waren es noch fast vierzig Meilen. Joe war verwundet und nur halbwertig ...
Wir brachten die Menschen auf der Hazienda in Gefahr. Das wurde mir in diesen Augenblicken so richtig bewusst. Ich begriff auch, dass die Geschwister kein falsches Spiel mit uns trieben. Ein warmes Gefühl der Dankbarkeit stieg in mir auf. Ich erhob mich, schlüpfte in meine Stiefel und ging hinüber ins Wohnhaus. Roberto öffnete mir die Tür und ging vor mir her in die Wohnstube. In einem der Sessel saß Maria. Als ich saß, sagte Roberto: »Das waren El Vengadors Männer.«
»Ich weiß. Ich bin Ihnen beiden zu großem Dank verpflichtet.«
»Wenn wir jemandem Gastfreundschaft gewähren, verraten wir ihn nicht«, sagte Roberto. »Aber Sie werden höllisch auf der Hut sein müssen, wenn Sie morgen die Hazienda verlassen. El Vengadors Späher sind überall im Land unterwegs und sie verständigen sich per Spiegelzeichen. Vierzig Meilen sind keine große Strecke – aber sie können zur Hölle werden, wenn man gejagt wird.«
»Vielleicht sollten Sie den morgigen Tag noch auf der Hazienda verbringen«, schlug Maria vor. »Ihr Freund würde einen Tag länger ausruhen können, und wenn Sie in der Dunkelheit reiten, werden Sie nicht so leicht wahrgenommen wie während des Tages. Ihre Chance, die Staaten zu erreichen, würde sich um ein hohes Maß erhöhen.«
Ich schaute Roberto an und versuchte in seinem Gesicht zu lesen. In seinen Augen flackerte es kurz auf. Ich wusste nicht, wie ich diese Reaktion deuten musste. War er verärgert über den Vorschlag seiner Schwester? Doch jetzt nickte er und sagte: »Eine gute Idee. Sie sollten darüber nachdenken, Logan.«
»Sie wären damit einverstanden?«, fragte ich.
»Ja. Allerdings müsste ich Sie bitten, das Schlafhaus nicht zu verlassen. Falls die Hazienda beobachtet wird ...«
»Ich rede mit meinem Gefährten drüber.«
Wenig später setzte ich Joe den Vorschlag der schönen Frau auseinander. »Was meinst du, Logan-Amigo?«, fragte mich mein Freund.
»Ich wäre nicht abgeneigt.«
»Gut, dann bleiben wir hier. Wir haben vier Pferde und können wechseln. Wenn wir hart reiten, können wir die vierzig Meilen in einer Nacht schaffen.«
Ich war skeptisch und verlieh dem auch Ausdruck: »Nicht mit deiner zerschossenen Schulter, Partner. Du würdest irgendwann aus dem Sattel kippen.«
*
Am Morgen brachte uns Maria das Frühstück in die Mannschaftsunterkunft. Der Kaffee duftete. Es gab frische Tortillas mit Ahornsirup, aber auch Eier mit Speck. Die Vaqueros und Arbeiter hatten das Schlafhaus längst verlassen. Die Geräusche, die von draußen hereinsickerten, verrieten, dass man auf der Hazienda das Tagwerk aufgenommen hatte. Helle Hammerschläge waren zu hören. Pferde wieherten. Hufe pochten.
Nach dem Frühstück rauchten wir.
»Wie fühlst du dich?«, fragte ich Joe.
»Ich könnte Bäume ausreißen.«
»Das kannst du deiner Großmutter erzählen.«
Joe grinste. »Ich fühle mich wirklich gut. Abgesehen von dem Ziehen und Stechen in der Schulter geht es mir hervorragend. Du wirst es sehen, Logan-Amigo: Morgen früh sind wir am Rio Grande.«
»Ich bin gespannt, ob die Texas Rangers Big Jack Brewster festgenommen haben.«
»Als ich auf der Hells Half Ranch war, erfreute er sich noch seiner Freiheit«, erklärte Joe.
»Wenn die beiden Kerle, die die Texas Ranger verhaftet haben, redeten, dürfte Big Jack schon hinter Gittern schmachten. Der Kerl hat was gut bei mir. Nur seinetwegen machen wir das alles durch. Sollte er noch nicht von den Rangers kassiert worden sein, werde ich ihm eine mörderische Tracht Prügel verabreichen. Und dann werde ich ihn bei den Rangers abliefern.«
Ich drückte meine Zigarette aus und legte mich auf das Bett, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und starrte zur Decke hinauf. Die Zeit schien nicht vergehen zu wollen. Hin und wieder erhob ich mich, ging zum verstaubten Fenster und schaute hinaus in den Hof. Er lag im gleißenden Sonnenschein. Weder Maria noch ihr Bruder ließen sich sehen. Das Warten auf den Abend zerrte an den Nerven. Andererseits aber konnte sich Joe einigermaßen erholen, und auch mir tat die Ruhe nach vielen Tagen voller Strapazen und Entbehrungen gut.
Es mochte um die Mitte des Vormittags sein, als ein Trupp Reiter auf die Hazienda kam. Ich erschrak. Es waren Rurales. Aus dem Wohnhaus trat Maria. Die Pferde stampften auf der Stelle und schlugen mit den Schweifen nach den blutsaugenden Bremsen an ihren Seiten. Da das Fenster geschlossen war, konnte ich nicht hören, was gesprochen wurde. Und wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht verstanden.
Einige Minuten verstrichen, in denen Maria einem der Polizeireiter Rede und Antwort stand. Dann zogen sie ihre Pferde herum und ritten fort. Nur noch aufgewirbelter Staub markierte den Weg, den sie vom Hof der Hazienda genommen hatten.
Ein Stein fiel mir vom Herzen. Als Maria das Mittagessen brachte, fragte ich sie: »Was wollten die Rurales?«
»Sie durchkämmen das Gebiet auf der Suche nach El Vengador. Ich habe ihnen erklärt, dass ich ihnen nicht helfen könne. Der Teniente wollte wissen, ob fremde Reiter vorbeigekommen seien. Ich habe ihm weder von euch beiden noch von Estebans Männer erzählt, die in der Nacht hier waren.«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Maria.«
»Wir sind Christenmenschen«, sagte sie einfach. »Und wenn jemand in Not ist, helfen wir ihm. Ihr seid amerikanische Gesetzesmänner. Aber ich denke, dass ihr inoffiziell über die Grenze gekommen seid. Darum müsst ihr die Rurales fürchten. Habe ich recht?«
»Ich war Gefangener der Rurales«, gab ich zu. »Mein Freund hat mich aus dem Gefängnis in La Morita befreit. Seitdem sind wir auf der Flucht. Vor den Rurales und vor Estebans Bravados.«
Maria verließ das Schlafhaus wieder.
Zwei Stunden später kamen die Rurales zurück. Bei ihnen waren drei Männer in groben Leinenanzügen. Sie waren gefesselt. Einer saß ganz krumm im Sattel. Über seiner Schulter war die Jacke blutgetränkt. Die Rurales stiegen im Hof von den Pferden und zerrten die drei Gefangenen von den Pferden. Einige der Polizeireiter waren verwundet. Maria kam in den Hof. Sie sprach mit einem der Polizeireiter, der die Schulterklappen eines Offiziers trug. Es war sicher der Teniente, den sie erwähnt hatte.
Die Gefangenen wurden zu einem Schuppen bugsiert und durften sich in den Schatten setzen. Die Polizeireiter scharten sich um den Brunnen, hievten Wasser in die Höhe und tranken. Dann ging einer mit einem Eimer voll Wasser und der Schöpfkelle, die am Brunnen an einem Nagel gehangen hatte, zu den Gefangenen hin und gab ihnen zu trinken. Die anderen machten sich daran, die Wunden ihrer Gefährten zu versorgen.
Einige Polizeireiter führten die Pferde zum Fluss.
Ich verspürte Anspannung. Wenn es einem der Kerle einfiel, in das Schlafhaus zu gehen, würde das für Joe und mich in einer Katastrophe enden. Draußen schwirrten Stimmen durcheinander. Ich konnte nichts tun. Unruhig stand ich neben dem Fenster und beobachtete das Treiben. Jetzt ging Maria ins Haus. Roberto war am Morgen auf die Weide geritten. Als sie wieder ins Freie kam, trug sie ein Tablett mit Schinken, Käse und Brot. Sie ging damit zu den Gefangenen hin und begann sie zu füttern.
Der Teniente folgte ihr und schaute ihr kurze Zeit zu, plötzlich schlug er ihr das Tablett aus den Händen. Die Lebensmittel landeten im Staub. Der Teniente herrschte Maria an. Als sie etwas erwiderte, holte er aus und schlug ihr die flache Hand ins Gesicht.
Ich war nahe daran, hinauszustürzen und dem Kerl für seine Unverschämtheit eine Abreibung zu verpassen. Aber ich brachte den Aufruhr meiner Gefühle sehr schnell unter Kontrolle und beruhigte mich. Maria ging mit gesenktem Kopf ins Haus.
Ich sah den Teniente auf die Mannschaftsunterkunft zuschreiten. Mein Herz begann einen Takt schneller zu schlagen. Ich verwünschte diesen Kerl. »Da kommt einer«, sagte ich zu Joe und glitt zur Tür, baute mich daneben auf, sodass mich das Türblatt deckte, wenn die Tür geöffnet wurde. Ich zog den Revolver. Der Teniente kam in die Unterkunft. Ehe er zum Denken kam, legte ich ihm von hinten den linken Arm um den Hals, hielt ihm die Mündung des Revolvers unter das Kinn und spannte den Hahn. »Keinen Laut!«
Der Offizier schluckte würgend. »Por Dios! Wer seid ihr?«
Ich bugsierte ihn zu meinem Bett und befahl ihm, sich zu setzen. Dann trat ich zurück und hielt den Revolver auf ihn angeschlagen. »Ich bin U.S. Deputy Marshal Bill Logan«, sagte ich und wies mit dem Kinn auf Joe. »Das ist mein Kollege Joe Hawk. Er wurde von Estebans Banditen angeschossen. Wir sind auf dem Weg zur Grenze.«
»Was haben Sie in unserem Land zu suchen?«
Auch ihm erzählte ich die Geschichte von den Viehdieben, denen wir nach Mexiko gefolgt waren. Ich schloss mit den Worten: »Die Banditen wurden von Ihren Kollegen verhaftet und ins Gefängnis nach La Morita gebracht. Nun sind wir auf dem Rückweg in die Staaten.«
»Sie sind illegal über die Grenze gekommen.«
»Auf der Spur von Männern, auf die man auch in Ihrem Land keinen Wert legt.« Mit dem letzten Wort stieß ich den Revolver ins Holster. »Wenn Sie vernünftig sind, Teniente, dann geschieht Ihnen nichts.«
Der Mexikaner verzog den Mund. »Draußen sind über ein Dutzend Polizisten. Welche Chance rechnen Sie sich aus?«
»Wir haben Sie als Geisel, Teniente. Was sind das für Männer, die sie gefangen haben?«
»Banditen El Vengadors. Wir sind nördlich von hier in ihren Hinterhalt geritten, waren ihnen im Endeffekt aber überlegen. Drei der Bravados haben wir getötet. Einige meiner Männer wurden verwundet. Die drei da draußen werden hängen oder erschossen.« Der Teniente leckte sich über die Lippen. »In Ordnung. Ich drücke beide Augen zu und gewähre euch freien Abzug. Reitet auf dem schnellsten Weg zur Grenze, und ich werde euch keine Steine in den Weg legen.«
In seinen Augen glitzerte die Hinterhältigkeit.
Ich durchschaute ihn. »Sicher«, sagte ich nickend. »Sie werden uns freien Abzug gewähren und wir werden auf dem schnellsten Weg zur Grenze reiten. Aber Sie kommen mit uns, Teniente. Sie sind der Garant dafür, dass uns Ihre Männer in Ruhe lassen.«
»Sie machen sich eines Verbrechens schuldig.«
»Ich würde es eher unter dem Begriff Notwehr zusammenfassen, Teniente«, versetzte ich. »Da Sie uns freien Abzug gewähren wollen, wird es Ihnen nichts ausmachen, freiwillig ein Stück mit uns zu reiten. Oder hegten Sie etwa Hintergedanken?«
»Wenn ich mein Wort gebe, dann hat das auch Geltung«, blaffte der Bursche.
Ich sagte zu Joe: »Halt ihn in Schach, Partner. Ich spreche mit seinen Männern.«
Joe nahm seinen Revolver und richtete ihn auf den Offizier. Ich holsterte mein Eisen und ging hinaus. Die Rurales wurden auf mich aufmerksam. Die Unterhaltungen erstarben. Ich wurde angestarrt. Zwei Schritte vor der Tür blieb ich stehen und rief: »Ich habe mit dem Teniente gesprochen. Mein Partner und ich sind amerikanische Gesetzesbeamte und auf dem Weg zum Rio Grande. Der Teniente gewährt uns freien Abzug und wird uns ein Stück begleiten. – Maria!«
Sofort kam die schöne Frau aus dem Haus. Mir blieb die Unruhe in ihren Zügen nicht verborgen.
Ich rief: »Lassen Sie unsere Pferde satteln, Maria. Wir haben uns entschlossen, nicht länger zu warten und sofort nach Norden aufzubrechen.«
»In Ordnung«, rief die Frau und winkte einem der Arbeiter.
Ich ging in die Unterkunft zurück und übernahm es wieder, den Teniente in Schach zu halten. Joe zog sich etwas umständlich an. Dann wurden die Pferde vor das Schlafhaus geführt.
»Gehen wir«, sagte ich und stieß den Revolver ins Holster. »Ich hoffe, Sie sind vernünftig genug, Teniente. Wenn Sie Ihren Leuten den Befehl geben, auf uns zu schießen, sorgen Sie für ein Blutbad.«
»Ihr habt nichts zu befürchten«, sagte der Offizier. »Ich kann mich in eure Situation hineinversetzen. Mit den Texas Rangers haben wir ein Abkommen ...«
»Es freut mich, dass Sie so vernünftig sind«, sagte ich.
Wir gingen hinaus. Vor der Unterkunft standen die vier Pferde, mit denen wir gekommen waren.
»Sagen Sie Ihren Männern Bescheid, Teniente«, forderte ich.
Er rief: »Es ist gut, Männer. Es sind zwei US-Marshals. Ich reite ein Stück mit ihnen. Wartet hier auf mich.«
Wir stiegen auf die Pferde. Joe konnte seinen linken Arm nicht gebrauchen. Er hing schlaff nach unten. Maria stand vor dem Haupthaus und schaute zu mir her. Ich ritt vor sie hin. »Vielen Dank, Maria. Ich hoffe, dass Sie unseretwegen keine allzu großen Schwierigkeiten bekommen.«
»Wir haben nichts Schlimmes getan«, sagte sie. »Es war unsere christliche Pflicht. Ich glaube nicht, dass das unter Strafe steht.«
»Auf Wiedersehen, Maria.«
»Gott sei mit euch, Americano.«
Ich zog das Pferd herum, dann ritten wir los. Der Teniente ritt zwischen Joe und mir. Ich wusste, dass wir uns nicht korrekt verhielten. Aber außergewöhnliche Umstände verlangten außergewöhnliche Maßnahmen. Keiner von uns wollte in einem mexikanischen Gefängnis verrotten.
*
Wir kamen zu der Stelle, an der die Rurales in den Hinterhalt der Bravados geritten waren. Ich sah einen Toten. Er lag auf dem Gesicht. »Sind einige der Banditen entkommen?«, fragte ich.
»Ja. Es ist möglich, dass sie uns längst beobachten.«
Wir hatten dem Teniente seinen Revolver, den er in einem geschlossenen Holster trug, nicht abgenommen.
»El Vengador hat im Volk eine Menge Sympathisanten«, sagte ich.
»Das ist leider so. Manchmal gibt er den Armen von dem Geld und dem Vieh, das er raubt. Er tut es nicht uneigennützig, denn er brauchte die Unterstützung der Menschen. Sie verehren ihn. In Wirklichkeit aber ist er ein skrupelloser Verbrecher, der seine Taschen füllt. Er nützt die Gutgläubigkeit der Menschen schamlos aus.«
»Wird es für Maria und ihren Bruder Konsequenzen haben, weil sie uns Gastfreundschaft gewährten?«
»Ich werde einen Bericht machen müssen. Was dabei herauskommt, weiß ich nicht. Es ist möglich, dass sie eine Strafe bekommen, weil ihr illegal im Land seid und sie euch aufgenommen haben. Ich denke mal, man wird sie zu einer kleinen Geldstrafe verurteilen.«
»Wir müssen keine Feinde sein, Teniente«, sagte ich. »In Mexiko wird Vieh gestohlen und von Amerikanern aufgekauft. Oftmals handelt es sich um Auftragsdiebstähle. Wir kennen den Namen eines der Männer, die das gestohlene Vieh aufkaufen. Er wird in den Staaten seine gerechte Strafe erhalten.«
»Im Endeffekt machen wir alle dieselbe Arbeit«, mischte sich Joe ein. »Wir ...«
Ein Schuss krachte. Der Teniente stürzte vom Pferd. Ich sprang aus dem Sattel. Eine Kugel streifte mein Pferd an der Kruppe und das Tier stieg erschreckt auf die Hinterhand. Joe gab seinem Pferd die Sporen und stob, ein lediges Pferd am langen Zügel führend, nach links zwischen die Hügel. Ich bändigte mein Pferd und zog die Winchester aus dem Scabbard. Dann warf ich mich neben den Mexikaner ins Gras. Er atmete. »Wo hat es Sie erwischt, Teniente?«, fragte ich.
»Die – die rechte Brustseite. Maldito – verdammt! Es brennt wie Feuer. Das sind die Bravados. Sie werden uns allen die Hälse durchschneiden.«
»Noch leben wir«, versetzte ich hart. »Und solange ein Funke Leben in uns ist, haben wir eine Chance. Bleiben Sie hier liegen, Teniente, und rühren sie sich nicht. Stellen Sie sich tot.«
Ich schnellte auf die Beine, erreichte mit zwei langen Schritten mein Pferd, kam mit einem kraftvollen Satz in den Sattel und gab dem Tier die Sporen. Es streckte sich. Schüsse krachten, aber sie verfehlten mich. Ich stob hinter Joe her um einen Hügel herum, lenkte das Tier hangaufwärts und sprang oben aus dem Sattel. Da standen auch Joes Pferde. Mein Kollege hatte mit seiner Winchester bei einem Felsen Stellung bezogen. Ich trat neben meinen Gefährten und achtete darauf, in der Deckung des Felsens zu bleiben. Unten in der Senke lag wie tot der Teniente. Das Pferd, das er geritten hatte, stand neben ihm und witterte mit erhobenem Kopf. Von den Banditen war nichts zu sehen. Aber ich wusste ungefähr, wo sie sich verschanzt hatten.
Einige Zeit verstrich. Plötzlich sah ich eine Gestalt aus der Deckung eines Strauches laufen. Sie rannte in Richtung des Teniente. Ich hob das Gewehr an die Schulter, mein Auge folgte über Kimme und Korn dem Burschen, ich krümmte den Zeigefinger. Mit einem peitschenden Knall verließ die Kugel den Lauf. Der Kerl schien einen Moment lang schräg in der Luft zu hängen, dann krachte er zu Boden, rollte auf den Bauch und brachte sich kriechend in Sicherheit.
Die Gewehre der Bravados begannen zu krachen. Sie hatten sich auf den benachbarten beiden Hügeln verteilt und schossen die Rohre heiß. Blei klatschte gegen den Felsen, der uns deckte, wurde platt gedrückt und pfiff mit grässlichem Heulen nach allen Seiten davon. Der Lärm mutete an wie ein höllisches Intermezzo. Plötzlich aber schwiegen die Waffen. Die Mexikaner griffen an. Sie huschten von einer Deckung zur nächsten, überwanden kurze Strecken freier Flächen indem sie Haken schlugen wie Hasen, verschwanden hinter Felstrümmern und Sträuchern und näherten sich uns unaufhaltsam. Es waren noch drei. Der Kerl, dem ich eine Kugel ins Bein geschossen hatte, war außer Gefecht gesetzt.
»Lass sie nur herankommen«, sagte ich grimmig zu Joe. »Diese Narren sind so sehr versessen darauf, uns zu unseren Ahnen zu schicken, dass sie gar nicht merken, dass wir jeden Vorteil auf unserer Seite haben.«
»Noch steht das Verhältnis vier zu zwei«, wandte Joe ein. »Und auf die leichte Schulter sollten wir diese Hombres auf keinen Fall nehmen.«
»Bleib du hier und halt sie dir vom Leib«, sagte ich und lief zurück, bis mich die Hügelkuppe deckte, dann eilte ich um den Hügel herum, lief hangabwärts, durchquerte eine Mulde, hetzte um den nächsten Hügel herum und hörte die Schüsse, die Joe den Banditen schickte, die versuchten den Hügel zu stürmen. Ich hetzte den Hang hinauf und kam ein wenig atemlos auf der Kuppe an. Jetzt konnte ich die Schufte sehen. Sie hatten den Fuß des Hügels erreicht, auf dem Joe hinter dem Felsen steckte, und kauerten hinter Felsen und Sträuchern.
Ich zielte und schoss. Einer der Kerle wurde umgerissen. Die beiden anderen sprangen auf und wirbelten herum. Wir hatten sie zwischen uns. Mit dem Peitschen von Joes Gewehr brach einer der Banditen zusammen. Der andere rannte geduckt los. Ich schoss ihn von den Beinen. Das Echo meines Schusses zerflatterte. Auf dem anderen Hügel trat Joe aus der Deckung. Er winkte mir zu.
Ich schritt hangabwärts. Den Kolben der Winchester hatte ich mir unter die Achsel geklemmt. Meine Linke umklammerte den Schaft, der Zeigefinger lag um den Abzug, die drei anderen Finger steckten im Ladebügel.
Plötzlich peitschte Joes Gewehr. Einer der Kerle warf den Revolver fort, den er gezogen hatte, und riss die Hände in die Höhe.
Nacheinander entwaffnete ich die Bravados. Sie waren verwundet. Zweien hatten wir jeweils den Oberschenkel durchschossen, einer hatte eine Kugel in der Schulter, der vierte in der Hüfte. Sie fluchten und stöhnten. Joe holte die Pferde des Quartetts. Mit Schnüren, die wir in ihren Satteltaschen fanden, fesselten wir ihnen die Hände. Und während Joe sie in Schach hielt, ging ich zum Teniente hin. Er hatte sich aufgesetzt und seine Hand mit dem Halstuch unter die Jacke geschoben. »Ich glaube, ich hatte verdammtes Glück«, sagte er heiser. »Die Kugel hat mich ziemlich weit rechts erwischt. Was nun?«
»Ich werde Sie verbinden«, sagte ich. »Und dann bringen wir Sie und die Bravados zu Ihren Leuten.«
Er starrte mich ungläubig an. »Ihr wollt die Chance, zu entkommen, verschenken?«
»Alleine werden Sie in Ihrem Zustand mit den vier Banditen nicht fertig«, sagte ich. »Auch will ich Sie mit der Kugel im Leib nicht einfach zurücklassen.«
»Meine Leute sind uns sicher gefolgt und werden mich finden.«
»Was ist, wenn sie uns nicht gefolgt sind?«
Der Teniente schaute nachdenklich drein. Ich verband seine Wunde, dann half ich ihm aufs Pferd. Auch die Bravados mussten aufsitzen. Da wir ihnen die Hände auf den Rücken gefesselt hatten, musste ich auch ihnen helfen. Es blieb an mir hängen, denn Joe war selbst gehandicapt.
Dann brachen wir auf. Wir ritten den Weg zurück, den wir gekommen waren. Nachdem wir etwa zwei Meilen zurückgelegt hatten, kamen uns die Rurales entgegen. Sie kreisten uns ein und schlugen die Waffen auf uns an. Wir wurden entwaffnet. Dann ritten wir zurück zur Hazienda. Der Teniente wurde ins Schlafhaus getragen und auf ein Bett gelegt. Joe und ich saßen zusammen mit den mexikanischen Banditen im Schatten eines Schuppens. Drei Polizeireiter hielten uns in Schach. Einmal sah ich Maria am Fenster des Wohnhauses.
Dann kamen zwei Rurales heran. Einer war ein Sargento. Er schaute erst auf Joe herunter, dann richtete sich sein Blick auf mich, und er sagte: »Der Teniente hat angeordnet, euch reiten zu lassen. Ihr seid nicht länger unsere Gefangenen.«
Wir erhoben uns. Unsere Pferde wurden herangeführt. In den Scabbards steckten die Gewehre. Der Sargento sagte: »Die Revolver findet ihr in den Satteltaschen. Reitet auf dem schnellsten Weg zum Rio Grande.«
Wir saßen auf. Jetzt erschien Maria in der Tür des Wohnhauses. Sie winkte uns zu. Wir winkten zurück, dann trieben wir die Pferde an ...
*
Am Morgen des folgenden Tages ritten wir über den Grenzfluss. Joe hatte durchgehalten. Auf amerikanischer Seite saßen wir ab. Seufzend sank Joe zu Boden. »Na, Logan-Amigo, was habe ich gesagt.«
»Du bist hart wie Stahl, Partner«, versetzte ich und lächelte.
Wir gönnten den Pferden eine Stunde Pause. Dann zogen wir weiter. Nach etwa zwei Stunden erreichten wir eine Ortschaft. Wir ritten zwischen die Häuser und fragten einen Passanten, wo wir gelandet waren.
»Das ist Mariscal«, erklärte der Mann. »Ihr befindet euch in der Big Bend. Ho, ihr seht ziemlich mitgenommen aus. Kommt ihr aus dem Greaserland?«
»Ja«, sagte ich. »Wir sollen zum San Francisco Creek.«
»Folgt dem Rio Grande nach Nordosten. Zwei Tage, dann stoßt ihr auf den Fluss – wenn ihr vorher nicht aus den Sätteln kippt.«
Wir ritten am Fluss entlang. Mittag schoss ich einen Präriehund, häutete ihn, dann brieten wir ihn über einem Feuer und ließen ihn uns schmecken. Unser ärgster Hunger war gestillt. Wir mussten von dem leben, was die Natur uns bot. Auch das Abendessen bestand aus einem Präriehund. Die Nacht verbrachten wir in einer Gruppe von Büschen. Wir schliefen tief und fest. Am Morgen ging es weiter. Um die Mitte des Vormittags stießen wir an der Mündung eines Flusses in den Rio Grande auf eine Farm. Auf dem Hof spielten zwei Kinder. Eine Frau kam aus dem flachen Wohnhaus. Ich fragte sie, wo wir uns befanden. Sie erklärte, dass es sich bei dem Fluss um den Maravillas Creek handelte und dass es bis zum San Francisco Creek noch etwa dreißig Meilen waren.
Die Frau gab uns zu essen und zu trinken. Ihr Mann und ihr Sohn befanden sich auf dem Feld. Sie packte uns etwas Dörrfleisch und Brot ein, dann ritten wir weiter.
Am Abend erreichten wir den San Francisco Creek. Wir folgten ihm, bis wir zur Hells Half Ranch gelangten. Die Pferde gingen mit hängenden Köpfen und zogen die Hufe durch den Staub. Aus den Fenstern der Mannschaftsunterkunft fiel Licht. Das Ranchhaus lag in Dunkelheit. Vor dem Bunkhouse saßen wir ab, banden unsere Pferde an den Holm und gingen hinein. Am Tisch saßen drei Männer. Einige lagen auf ihren Bunks herum. Im Licht der Laternen glitzerten ihre Augen wie Glasstücke. Einer sagte: »Bist du es wirklich, Logan? Wo kommst du her? Wurde die Mannschaft, die nach Mexiko geritten ist, nicht aufgerieben? Die Texas Ranger haben den Boss abgeholt und nach Del Rio gebracht.«
»Wir sollten gestohlenes Vieh in Mexiko abholen«, sagte ich. »Ich fiel den Rurales in die Hände. Big Jack wurde also verhaftet. Das ist nur recht und billig. Bei den Viehdiebstählen in Mexiko wurden Männer getötet. Dafür muss Big Jack büßen, denn er machte gute Geschäfte mit dem geraubten Vieh. Wir werden morgen nach Del Rio reiten und ich werde dort meine Aussage machen.«
»Wen hast du da mitgebracht, Logan?«
»Das ist mein Freund und Partner Joe Hawk. Er reitet als U.S. Marshal für das Distriktgericht in Amarillo.«
Die Burschen schauten betroffen drein. Einer sagte: »Wir wussten nichts von Big Jacks Machenschaften. Wenn er aus Mexiko Rinder holte, gingen wir davon aus, dass es sich um legale Geschäfte handelte. O verdammt, wir wissen nicht, was werden soll. Wenn sie Big Jack einsperren, gibt es keinen mehr hier, der uns beschäftigt.«
»Big Jack wird sicher einen Verwalter einsetzen«, sagte ich. »Lasst es auf euch zukommen, Männer. Wobei ich natürlich nicht weiß, für wie lange der Richter euren Boss ins Gefängnis schickt.«
»Ja«, sagte der Mann. »Wir lassen es auf uns zukommen. Und dann sehen wir weiter. Ihr habt sicher Hunger und Durst.«
Der Mann begleitete uns in den Küchenanbau und briet uns Eier mit Speck. Wir aßen hungrig. Nach dem Essen schenkte uns der Bursche einen doppelten Whisky ein. »Du reitest morgen nach Del Rio, Logan«, sagte der Mann dann. »Wirst du auch mit dem Boss sprechen?«
»Ich kann das gerne machen. Vielleicht bekomme ich von ihm einige Instruktionen, die ich an euch weitergeben kann.«
»Wir haben deinen Kampf mit Curly Moorcock erlebt und haben von eurem Kampf mit den Malone-Brüdern in Del Rio gehört. Wärst du nicht der Mann, der die Ranch führen könnte, Logan?«
Ich lachte. »Ich werde wieder für das Bezirksgericht in Amarillo reiten. Aber mach dir keine Sorgen. Big Jack hat sicher eine Lösung parat. Wie ist dein Name? Ich werde Big Jack vorschlagen, dich als Verwalter einzusetzen.«
»Ben Donegan.«
»Traust du es dir zu, die Hells Half Ranch zu führen?«
»Ich hätte sicher die Unterstützung der Mannschaft. Curly Moorcock wird sicher Einwendungen geltend machen ...«
»Er wird sich der Entscheidung Big Jacks beugen müssen«, versetzte ich.
Am Morgen ritten wir los. Tags darauf kamen wir in Del Rio an. Ich erfuhr, dass Big Jack dem Sheriff übergeben worden war, der ihn in seinem Jail festhielt. Wir begaben uns zum Sheriff's Office. Der Sheriff war ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Seine Haare waren grau. Sein Blick war ruhig und fest. Er hörte sich an, was ich zu sagen hatte. Dann erwiderte er: »Es handelte sich um Auftragsdiebstähle in Mexiko. Dass die Viehdiebe dort unten über Leichen gingen, war Brewster egal, Hauptsache sein Gewinn stimmte. Er wird für einige Jahre ins Gefängnis gehen. – Okay, Logan, ich werde Ihre Aussage aufnehmen und sie zu gegebener Zeit dem Gericht präsentieren. Sie sind ein wichtiger Zeuge.«
»Kann ich mit Brewster sprechen?«
Der Sheriff führte uns in den Zellentrakt. Brewster saß auf der Pritsche. Jetzt erhob er sich, kam zur Gitterwand, seine Hände legten sich um zwei der zolldicken Eisenstäbe. Seine Backenknochen mahlten. »Ich hielt Sie für tot, Logan.«
»Sie haben uns in die Hölle geschickt, Big Jack«, sagte ich. »Vier der Männer haben die Rurales getötet. Ich hatte einen besonderen Schutzengel, der mir das Leben bewahrte. Sie haben uns verheizt, Big Jack.«
»Sie waren mir dankbar, dass ich Ihnen ein Job gab, Logan. Also, was wollen Sie?«
»Nur Bill Conrad war eingeweiht. Die anderen Burschen ritten blindlings in ihr Verderben. Ihren Tod können Sie sich an Ihre Fahne heften, Brewster.«
»Gehen Sie zum Teufel, Logan.«
»Die Männer auf der Ranch wissen nicht, wie es weitergehen soll«, grollte ich. »Sie werden sicher wollen, dass die Geschäfte weitergeführt werden, Brewster. Ben Donegan wäre sicher ein geeigneter Mann, um die Ranch während Ihrer Abwesenheit zu führen. Wenn Sie damit einverstanden sind, benötigt er eine Vollmacht, Geschäfte in Ihrem Namen abzuwickeln.«
»Ich werde darüber nachdenken«, knurrte der Rancher, wandte sich ab, ging zur Pritsche und setzte sich. »Ich werde den besten Anwalt konsultieren, den ich kriegen kann. Noch bin ich nicht verurteilt.«
»Die Aussage Logans wird dazu führen, dass Sie verurteilt werden, Brewster«, gab der Sheriff mit Nachdruck im Tonfall zu verstehen. »Es wäre wohl tatsächlich besser, einen Verwalter auf der Ranch einzusetzen.«
Der Blick von Brewster, der mich traf, war voll Hass. Hart traten die Backenknochen in seinem Gesicht hervor, so sehr biss er die Zähne zusammen.
Als wir wieder im Office waren, sagte der Sheriff. »Wie war das mit der Schießerei auf der Malone Ranch, Logan? Die Malone-Brüder haben Anzeige gegen Sie und Bill Conrad erstattet. Erzählen Sie mir Ihre Version der Geschichte.«
Ich berichtete dem Sheriff von dem Versuch der Brüder, Bill Conrad und mich um unsere Dollars zu erleichtern. Als ich geendet hatte, sagte der Sheriff: »So etwas Ähnliches dachte ich mir schon. Die Brüder taugen nichts. Aber sie haben Rache geschworen. Nehmen Sie sich in Acht, Logan, solange Sie in der Gegend weilen.«
»Nun«, sagte ich, »das wird nicht sehr lange der Fall sein. Morgen früh machen wir uns auf den Weg nach Norden. Ich kann es kaum erwarten, mir wieder den Stern anstecken zu können.«
Wir blieben die Nacht über in Del Rio. Am Morgen des nächsten Tages standen wir frühzeitig auf. Nach dem Frühstück verließen wir das Hotel. Zwischen den Gebäuden wob der Morgendunst. Er war Vorbote der kommenden Hitze. Die Stadt war noch ruhig. Joe und ich gingen am Fahrbahnrand. Das Gewehr trug ich links am langen Arm. Als wir noch zwanzig Schritte von der Gasse entfernt waren, in der der Mietstall lag, humpelte aus ihr ein Mann in die Main Street. Er benutzte eine Krücke. In seiner Rechten lag ein Revolver.
Ich erkannte ihn. Es war einer der Malones – Cash Malone, dem ich eine Kugel ins Knie geschossen hatte. Er blieb nach wenigen Schritten stehen und wandte sich uns zu.
Joe und ich hielten an.
Hinter uns mahlte Staub unter Ledersohlen. Ich drehte den Kopf. Wayne Malone kam hinter einem Gebäude hervor. Er hielt eine Winchester an der Hüfte im Anschlag. »Du hast eine Rechnung bei uns offen, Hombre!«, rief Wayne Malone. Eine düstere Drohung ging von ihm aus.
»Übernimm du den Kerl vor uns«, zischte ich Joe zu und drehte mich zu Wayne herum. Mit lauter Stimme sagte ich: »Ich habt es herausgefordert, Malone. Du solltest es akzeptieren. Sei froh, dass du noch lebst. Ich hätte dir die Kugel auch in die Brust schießen können.«
»Unser Bruder wäre fast draufgegangen!«, fauchte Wayne Malone. Dann drückte er ab. Ich warf mich zur Seite. Meine Rechte schnappte den Revolver aus dem Holster. Ehe Wayne Malone noch einmal abdrücken konnte, feuerte ich. Auch bei Joe dröhnte der Sechsschüsser. Die Detonationen schmolzen ineinander und stießen durch die morgendliche Stadt.
Die beiden Brüder lagen am Boden und stöhnten. Ich ging zu Wayne Malone hin. In seinen Mundwinkeln zuckte es. Der Schmerz verzerrte sein Gesicht.
Menschen kamen auf die Straße. Nach wenigen Minuten erschien auch ein Deputysheriff ...
*
Ich klopfte gegen die Tür. »Herein!«, ertönte es und ich öffnete.
Der Richter saß hinter seinem Schreibtisch. Seine Miene hellte sich auf, als er mich erkannte. »Logan!«, entrang es sich ihm erfreut. »Setzen Sie sich.«
Hinter mir kam Joe.
»Sie haben ihn also tatsächlich wieder zurückgebracht, Joe«, sagte der Richter.
Wir setzten uns.
»Joe hat Ihnen sicher die blutige Geschichte von Clint Anderson erzählt, Logan?«, ergriff der Richter sogleich wieder das Wort.
Ich nickte. »Die Wahrheit dahingehend, was sich am Sweetwater abgespielt hat, werden wir wohl nie herausfinden. Aber wie es scheint, hatte Anderson auch so genug Dreck am Stecken, sodass er gewiss nicht als Unschuldiger gehängt wurde.«
Der Richter lächelte. »Sind Sie bereit, wieder in den Sattel des Distriktgerichts zu steigen?«
»Ja, Sir.«
Der Richter zog den Schreibtischschub auf und griff hinein. »Dann darf ich Ihnen Ihren Stern zurückgeben, Logan ...«
Ich war wieder zu Hause. Ein Glücksgefühl, wie ich es noch nie verspürt hatte, durchströmte mich.