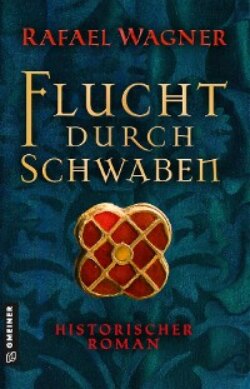Читать книгу Flucht durch Schwaben - Rafael Wagner - Страница 11
Cap. IV
ОглавлениеFreitag, 28. April 926
Ein unsäglicher Schmerz durchfährt meine rechte Schulter, sodass ich hochschnelle und sogleich die Kraft aus meinem Körper schwindet. »Runter!« Anna reißt mich zur Seite und drückt mich hinter einem Busch zu Boden. Ihre Hand presst sie auf meinen schmerzverzerrten Mund, sodass ich keinen Laut mehr herauskriege. In der Ferne ertönt ein schriller Pfiff, der von lautem Hufgetrappel beantwortet wird. »Er zieht sich zurück. Was für ein Glück! Nach den zwei Spähern heute Morgen, die unser Nachtversteck, ohne Verdacht zu schöpfen, passiert haben, habe ich nicht mit einem dritten gerechnet. Schön, dass du auch endlich wach bist. Da hatten wir echt noch einmal Glück«, flüstert mir Anna zu, doch sind die letzten Silben nur noch als unverständliches Glucksen zu verstehen. Das Glück hat sich gerade etwas relativiert. Ein dicht befiederter Pfeil steckt in meiner Schulter.
»Warum kommt er nicht zurück und erledigt mich endgültig«, stöhne ich mit bleichem Gesicht.
»Halte still«, befiehlt mir Anna, die ihre Stimme mittlerweile wiedergefunden hat. »Du blutest zum Glück nur schwach, doch kann ich den Pfeil nicht entfernen, ohne dass du zu viel Blut verlierst. Du musst ruhig bleiben.« Wie soll ich denn jetzt ruhig bleiben? Ich wurde grade von einem dieser berittenen Bastarde wie Wild erlegt. Kraftvoll drückt sie mir ein Bündel aus Moos und einem Stück Holz auf den Teil der Wunde, der von der Pfeilspitze neben der eigentlichen Einschussstelle zusätzlich aufgerissen wurde. Ich reiße den Mund auf zum Schrei, übergebe mich vor Schmerz aber ins dichte Unterholz des Waldes. Mit einem Stück ihres Leinengewandes legt Anna einen straff gezogenen Druckverband über meine verletzte Schulter. »Ich habe den Pfeil etwas stabilisiert. Der Verband sollte verhindern, dass zu viel Schmutz in die Wunde kommt. Jemand mit Erfahrung sollte sich das anschauen. Ich wage nicht, den Pfeil selbst zu entfernen.«
Einige Minuten bleiben wir beide an Ort und Stelle liegen. Momente der Ruhe, die ich bitter nötig habe. »Sie sind wohl endgültig weitergezogen. Wahrscheinlich halten sie dich ohnehin für tot. Für einzelne Personen scheinen sie sich nicht sonderlich Zeit zu nehmen. Die sind auf unbewachte Höfe, schwach befestigte Siedlungen und schnelle Beute aus.«
Langsam kehren meine Sinne zurück, doch wage ich nicht, mich zu bewegen. Ein stechender Schmerz durchfährt mich beinahe bei jedem Herzschlag. Doch steigt mir ein unangenehmer Geruch in die Nase: »Riechst du das?«
»Na, dein Erbrochenes ist es jedenfalls nicht«, entgegnet Anna, die – aufgeputscht vom Schrecken – schon wieder zu ersten Scherzen aufgelegt ist. »Aber ich weiß, was du meinst. In der Nähe brennt es wohl. Diese Richtung.« Sie weist mit ihrer Hand in irgendeine Richtung, doch kann ich weder erklären, woher sie das nun wieder weiß, noch ob es wirklich eine gute Idee ist, sich in Kriegszeiten einem Brandherd zu nähern.
»Aber Feuer ist im Moment gleichbedeutend mit der Präsenz ungrischer Krieger.«
Während sie mir beim Aufstehen hilft, entgegnet Anna harsch: »Was sollen wir sonst tun? Wir müssen schnellst möglich deine Wunde versorgen. Zurück zum Kastell können wir nicht. Die erwarten uns sicher. Und wer weiß, was Strello dem Tribun alles über unseren Verbleib erzählt hat.«
Wir kämpfen uns durch den fast undurchdringlichen Wald und nähern uns einer Lichtung. Hätten wir bloß eines der Schwerter der gestern getöteten Feinde mitgenommen. Anna lässt mich an einen Baum gelehnt zurück und sondiert die Lage. Mitten auf der Lichtung steht ein stattliches Gehöft in Flammen. Die Tiere wurden bestimmt schon alle weggeführt und die Menschen getötet oder versklavt. Hat der Späher deshalb von mir abgelassen? Der hat sich bestimmt lieber auf die schon fast offen dargebotene Beute gestürzt. Außer dem römischen Kastell sind mir kaum irgendwelche Befestigungsmaßnahmen aufgefallen. Ein wahres Freudenfest für eine solche Horde auf Raubzug.
»Bitte helft uns«, höre ich plötzlich eine zittrige Stimme von hinten. Ich versuche, den Kopf zu drehen, und blicke in die verschmutzten kleinen Gesichter zweier Kinder.
»Wer seid ihr? Was ist hier passiert?« Offenbar handelt es sich um die zwei Söhne des Bauern, der einst diesen Hof bewirtschaftet hat. Die beiden blicken sich ängstlich um und erklären sich mir mit wenigen Worten. Der Ältere, Liubman, ist nur wenige Jahre jünger als ich, der Jüngere, Jacob, zählt in etwa die Hälfte meiner Lebensjahre. Ich mustere die beiden, pfeife dann laut, um Anna zurückzurufen, und bitte den Älteren um Aufklärung. Ihre Mutter weilt anscheinend schon länger nicht mehr unter den Lebenden, während ihr Vater vor zwei Tagen losgezogen ist, um beim Abt von Sankt Gallen wegen der drohenden Gefahr um Hilfe zu bitten. Heute Morgen seien plötzlich vier Reiter aufgetaucht. Sie hätten gerade noch aus dem Haus in den Wald rennen können, während der Knecht ihres Vaters auf der Stelle niedergestreckt worden sei.
»Er liegt hinter der Scheune«, bestätigt Anna, die soeben zu uns zurückgekehrt ist. »Wir haben leider nicht die Zeit, ihn ordentlich zu begraben. Du musst versorgt werden, und es könnten jederzeit weitere Reiter auftauchen.«
»Lasst uns nicht zurück«, beginnt plötzlich Jacob zu wimmern, und Liubman fügt, an Anna gewandt, hinzu:
»Wir können euch helfen. Mit dem Pfeil da kommt er nicht weit. Der Abt des Gallusklosters muss ganz in der Nähe sein. Er soll unten an der Sitteruna eine kleine Befestigung errichtet haben. Unser Vater wollte uns holen kommen, sobald er sich dessen sicher war. Ich kann euch dorthin führen.« Was bleibt uns anderes übrig?
Während Stunden kämpfen wir uns nun schon durch den dichten Wald. Ich muss meine letzten Kräfte mobilisieren, der Schmerz ist schier unerträglich geworden. Plötzlich hören wir vor uns Schritte und das Knacken von Ästen. »Noch mehr Späher?«, flüstert mir Anna zu. Doch das konnten keine Ungrer sein, dann wären wir längst tot.
Vor uns treten drei Mönche, zwei mit übermannsgroßen Stöcken, der dritte mit einem einfachen Jagdbogen und eingenocktem Pfeil. »Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was glaubt ihr, auf der terra sancti Galli zu finden?« Wir erklären uns hastig, froh, den Vertretern des heiligen Gallus begegnet zu sein, und sichtlich erleichtert, dass der zittrige Mönch mit dem Bogen endlich den Pfeil zurück in den Köcher steckt. Die Mönche, die zur Nahrungsbeschaffung ausgeschickt wurden, führen uns in ihr Refugium an der Sitteruna.
Schon während des Aufstiegs zum Torverhau hören wir eine halb belustigte, halb besorgte Stimme rufen: »Dachtet ihr, wenn es schon keine Nahrung mehr gibt, bringen wir stattdessen einige weitere hungrige Mäuler mit?« Ein respekteinflößender Mann von 30 bis 40 Jahren mit Kutte und Tonsur tritt vor das Tor hinaus. Sein Blick wird sogleich milder, als er die zwei Jungen in unserem Gefolge entdeckt. Er stellt sich uns als Dekan der Gemeinschaft des heiligen Gallus vor und führt uns hinein in die – wie er es nennt – »Burg«. Nun ja, Burg ist übertrieben. Arbon ist eine Burg, aber wir wollen die unerwarteten Gastgeber nicht schon bei unserer Ankunft beleidigen.
Stattdessen fragt ihn Anna besorgt: »Sind wir hier sicher?«
Bevor der Dekan antworten kann, hören wir eine andere Stimme: »Locus a Deo oblatus.«
»Eine Stelle wie von Gott dargeboten«, versuche ich mit inzwischen leiser und schwacher Stimme Anna die Aussage zu übersetzen, die von einem Mann kam, vor dem selbst der Dekan ehrerbietig einen Schritt zurücktrat.
»Der junge Herr spricht Latein. Welchem Konvent gehörst du an?« Bevor ich darauf reagieren kann, sacke ich zu Boden, und alles wird schwarz.
»Haltet ihn so fest ihr könnt!« Ich spüre, wie ich an Armen und Beinen mit festem Griff zu Boden gedrückt werde. Alles ist verschwommen. Ich kann weder einordnen, wo ich bin, noch was gerade vor sich geht. Wer sind all die Menschen um mich herum?
Da spüre ich eine warme Hand sanft über meine Stirn streicheln. »Sei jetzt stark, ich bin hier. Ich bleibe an deiner Seite«, höre ich Annas sanfte Stimme, während ich im schummrigen Licht ein glühendes Licht aufblitzen sehe.
»Jetzt!« Das Glühen verschwindet aus meinem Blickwinkel, und in meine rechte Schulter bohrt sich ein stechender Schmerz. Erneut verdunkelt sich alles.
Ich glühe und friere zugleich am ganzen Körper. Beim Versuch, mich wegzudrehen, schaffe ich es bloß, den Kopf hin und her zu werfen. »Alles ist gut. Bleib ganz ruhig. Ich bin da.« Annas Stimme gibt mir die nötige Zuversicht, dass wirklich alles in Ordnung ist. Mit einem kalten, nassen Tuch wischt sie mir den Schweiß aus dem Gesicht. Ich habe keine Vorstellung davon, wie lange ich schon hier liege oder wo ich bin. Zudem fehlt mir die Kraft, Anna zu fragen. Immer wieder schlafe ich ein und höre aus weiter Ferne besorgte Stimmen und Gespräche. Und immer wieder spüre ich Annas umsorgende Wärme und höre ihre Stimme. Alles ist gut.
»Was ist mit meinem Arm?«, vermag ich einmal, Anna zu fragen.
»Der Pfeil konnte entfernt werden, doch die starke Blutung musste sofort gestoppt werden. Der Infirmar hat deine Wunde mit einem glühenden Eisen ausgebrannt. Du wirst wieder gesund.« Anna flößt mir etwas Haferbrei und verdünnte Cervisa ein. Alles wird gut.
Dazwischen plagen mich wilde Träume. Vieles davon erscheint mir so wirr, dass ich mit einem Schrei aufschrecke. Einmal befinde ich mich wieder auf den Mauern in Arbona. Ich wandle durch Dörfer voller Blut und Feuer. Ich falle in ein schwarzes Nichts und warte auf den Aufprall, doch nie erreiche ich den Grund. Ein weißes Pferd bäumt sich vor mir auf. Hunderte Pfeile verbergen das Licht der Sonne. Und Anna. Immer wieder sehe ich Anna. Sie streichelt mein Gesicht. Einsam steht sie im finsteren Wald, in ihrer Hand ein rotes Stück Stoff. Um den Hals trägt sie ein merkwürdiges längliches Stück Knochen. Vertraute Gesichter blicken mich an. Immer wieder ist es derselbe Mann, dieselbe Frau. Ich kenne sie, aber woher? Dann plötzlich treibe ich einsam auf einem See. Das Ufer rundherum glüht. Es gibt kein Entkommen. Anna entfernt sich von mir. Ihr dunkles Haar fällt ihr in den Nacken. Fest umklammere ich mein Schwert. Überall stehen pferdeköpfige Gestalten. Aus der Ferne höre ich Annas Schreie. Ich kann nichts tun. Ich bin gefangen. Immer wieder schrecke ich hoch, mal ist es hell, mal ist es dunkel. Doch immer ist sie bei mir, hält meine Hand, hält meinen Kopf, tröstet mich. Alles wird besser.