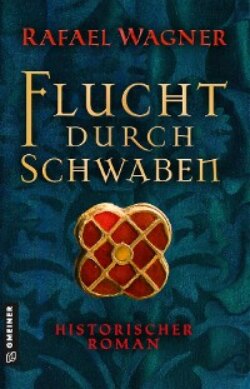Читать книгу Flucht durch Schwaben - Rafael Wagner - Страница 12
Cap. V
ОглавлениеMontag, 1. Mai 926
Ich blicke auf und sehe in die tiefblauen Augen derjenigen Person, die ich in diesem Moment an meiner Seite haben wollte. »Na, gut geschlafen?« Um Annas Mundwinkel kräuselt sich ein Lächeln. Sie selbst scheint erschöpft und besorgt, will sich aber offenbar nichts anmerken lassen.
Das Strahlen ihres wundervollen schmalen Gesichts lässt Wärme in mir hochsteigen: »Wie lange liege ich schon hier?«
»Wir sind vor drei Tagen hier angekommen, du hattest Fieber.« Ich versuche, mich von meinem Bettlager aufzurichten, doch sogleich durchfährt ein stechender Schmerz meine Schulter bis in die Brust. Augenblicklich lasse ich mich zurück aufs feuchte Moos und Stroh zurückfallen, wobei mir auffällt, dass ich nun in einem einfachen Hemd aus Hanf stecke. »Keine Sorge, die Mönche haben dir das übergezogen«, fällt mir Anna in die Gedanken. Mein Blick verriet offenbar mehr Unbehagen, als ich wollte. »Das neue Hemd hat leider nichts an deinem Gestank geändert. Ich helfe dir hoch«, spottet Anna mit gerümpfter Nase. Vorbei am steinernen Gebetshaus und dem Lager der Bediensteten des Abtes gehen wir langsam hinab in den unteren Teil der Befestigung, wo gerade drei Mönche mit der Hilfe der zwei Jungen, die uns vom abgebrannten Gehöft hierher geführt haben, einen Brunnenschacht ausheben. Jacob, der jüngere von beiden, winkt mir im Vorbeigehen fröhlich zu, bis er sich unter dem strengen Blick seines Bruders wieder seiner Arbeit widmet.
»Bis die Brunnen fertig sind, müssen wir wohl das Risiko auf uns nehmen, den sicheren Hafen des heiligen Gallus zu verlassen«, spöttelt Anna leise in meine Richtung. »Der Fluss ist mir ohnehin lieber. Seit du fiebernd auf deinem Bett lagst, habe ich nichts anderes mehr getan, als Essen zu holen. Dein Blut klebt wahrscheinlich immer noch an mir. Ich muss mich waschen.« Nur zu gerne würde ich ihr sagen, wie wunderschön sie aussieht. Ein Engel, der zwei Tage und Nächte über mich gewacht hat. »Wir wollen zum Fluss!«, ruft Anna, als wir uns dem südlichen Wallabschnitt nähern.
»Auf eure eigene Verantwortung«, hören wir hinter uns die gewohnt strenge Stimme des Dekans, »außerhalb der Wälle können wir euch nicht mehr beschützen. Öffnet das Tor!«
»Schnell, bevor er seine Meinung ändert«, zischt Anna in mein Ohr und drängt mich vorwärts. Die Bäume sind zur Errichtung der kleinen Festung und der zahlreichen Annäherungshindernisse in der ganzen Flussschleife gefällt worden. Flink eilt Anna Richtung Fluss. Am Rand der äußersten Biegung des Flusses entdecken wir einige niedrige Büsche, die uns vor den Blicken der Wachen auf dem Wall verbergen dürften. Das Flussbett ist jetzt im Frühling wegen der Schneeschmelze wohl breiter als sonst. Also dürfte der Randbereich hoffentlich eine Sandbank mit langsam fließendem Wasser bereithalten. Ich begebe mich langsam in das etwas breitere und flachere Wasser des Flusses, während Anna das tiefere Wasser der Flussbiegung bevorzugt.
»Lass dich bloß nicht mitreißen!«, rufe ich ihr noch durch die Büsche hinterher, welche uns im Uferbereich die Sicht nehmen. Auf beiden Knien im Wasser schöpfe ich mit meinen Händen Wasser aus dem Fluss und möchte das kühle Nass über mein Gesicht gießen. Doch der pochende Schmerz in meiner linken Schulter lässt mich schnell davon absehen, sodass ich mich entschließe, einfach meinen ganzen Kopf unterzutauchen. Was für ein Segen! Am liebsten würde ich gleich ganz ins Wasser springen, doch weiß ich nicht, ob ich mich notfalls wieder allein aus dem Fluss würde schleppen können. Anna möchte ich nicht schon wieder um Hilfe bitten. Sie hat schon zu viel für mich getan.
Ich wasche mich mehr schlecht als recht und klettere dann etwas unbeholfen einige Meter den kleinen Abhang hoch, um mich auszuruhen. Als ich mich zum Setzen umdrehe, stockt mir der Atem. Nun etwas erhöht sitzend, fällt mein Blick durch die Büsche auf Anna. Anders als ich traut sie sich an die tiefen Stellen, wofür sie sich ihr Leinengewand abgestreift hat. Sie steht nackt und mit dem Rücken zu mir bereits knietief im Wasser. Mein Blick wandert ihre schlanken Beine hoch zu ihrem festen Hintern, weiter über ihre schmale Taille bis zum Nacken, der zur Hälfte von ihrem langen dunkelbraunen Haar verdeckt wird. Ich bewundere ihre schneeweiße zarte Haut, welche die nun hervorkommenden Sonnenstrahlen beinahe einzusaugen scheint. Was für ein perfektes Wesen. Vorsichtig lässt sie sich ins eiskalte Wasser der Sitteruna gleiten, was ihren Körper kurz zusammenzucken lässt. Erst macht sie einen, dann einen weiteren Schwimmzug, bevor sie vollständig untertaucht. Dann dreht sie sich auf den Rücken und lässt sich kurz von der Strömung treiben. Ihre kleinen weißen Brüste scheinen kaum weiter aus dem Wasser zu ragen als ihr flacher Bauch und werden in regelmäßigen Abständen von den kleinen Strudeln des Flusses umspült. Völlig gebannt sitze ich hinter den Büschen und vermag kaum zu atmen. Alles fühlt sich schwer an. Mein Puls rast. Was tue ich da nur? Ich möchte mich abwenden, doch gelingt es mir nicht. Mittlerweile ist sie wieder untergetaucht und kommt einige Meter flussabwärts langsam ans Ufer des Flusses, wo sie sich aufrichtet und sich mir ihre ganze Vollkommenheit offenbart. So schnell hätte ich sie nicht zurück am Ufer erwartet, woraufhin ich mich augenblicklich zur Seite drehen möchte. Doch scheint mein Körper nicht ganz gehorchen zu wollen, und gerade, als ich ihren Blick langsam die Böschung hochwandern sehe, wird alles schwarz.
Ich öffne die Augen, und erneut erwartet mich ein Augenpaar. Doch ist es diesmal jenes von Jacob. »Er ist wach!«, höre ich seine Stimme dumpf aus der Ferne, obwohl er doch ganz offensichtlich über mir kniet. Sein Gesicht verschwindet aus meinem Blickfeld, und stattdessen erscheint Annas besorgter Blick.
»Kannst du aufstehen? Wir sind schon viel zu lange außerhalb des Walls.« Ihre Stimme klingt nun viel klarer, und mir schießen urplötzlich die letzten Erinnerungen vor der Ohnmacht ins Bewusstsein.
»Ich … ich …«
»Keine Zeit!«, schneidet mir Anna das Wort ab. Mittlerweile trägt sie wieder ihr Leinengewand. »Die Späher berichten von einer Gruppe Ungrer, die hierher unterwegs sind.« Zusammen mit Jacob gelingt es Anna, mich hochzuziehen, und plötzlich spüre ich die Kraft zurückkommen. Wir begeben uns zurück zum Tor, und ich versuche, das Thema in eine andere Richtung zu lenken.
»Was machst du hier draußen?«, richte ich meinen Blick nun auf Jacob, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. Doch nun spüre ich sein Unbehagen und verstärke den Druck meiner Hand auf seiner Schulter, mit der er mich zu stützen versucht. »Jacob?«
»Ich wäre doch nicht gegangen, ohne euch Lebwohl zu sagen!«
»Gehen? Du wolltest von hier weg?«
Jacob wird schlagartig klar, dass wir wohl nicht im Traum auf diese Idee gekommen wären, und bereut seine vorschnelle Antwort. Er versucht, sich zu rechtfertigen, und berichtet von einer Gruppe Flüchtlinge, welche ebenfalls in der Burg der Mönche Schutz gefunden hat. Diese erzählten ihm von einer Handvoll Bauern, welche den Ungrern heimlich nachsetzen, um sich ihre gefangenen Angehörigen zurückzuholen, vielleicht auch nur, um sich an diesen Unheilbringern zu rächen. »Bestimmt ist mein Vater einer dieser Männer. Er ist so mutig!«
»Und du wolltest ganz allein und ohne Orientierungsmöglichkeiten durch den Wald streifen?«
Etwas ungläubig guckt mich Jacob von unten an: »Natürlich nicht! Ich wollte zu dem Floß, das ich gestern weiter flussabwärts entdeckt habe. Vater hat uns immer wieder eingeschärft, stets den Flüssen zu folgen, um nicht verloren zu gehen. Doch dann habe ich dich hier unten sitzen und aufs Wasser glotzen sehen und habe mich nicht weiter vorgewagt. Und dann bist du plötzlich umgekippt. Was hast du denn da unten gemacht?«
Damit wären wir also doch wieder bei dem Thema, von dem ich eigentlich ablenken wollte. Abwehrend entgegne ich: »Na, jedenfalls wollte ich mich nicht ohne Abschied aus dem Staub machen!«
Im Tordurchgang werden wir bereits ungeduldig von einem Mönch erwartet: »Was, bei Gallus und Otmar, habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Schnell, folgt mir.« Wir hören, wie der hölzerne Verhau, der im südlichen Abschnitt als eine Art Tor dient, erneut vorgeschoben und verankert wird. Mit schnellen Schritten, die mich beinahe erneut zusammenbrechen lassen, führt uns der etwas zu kurz geratene Mönch in den höher gelegenen Teil der Befestigung hinter das Gebetshaus. »Was war los mit ihm?« Verwirrt blicke ich auf und frage mich, warum er nicht gleich mit mir spricht.
Bevor ich reagieren kann, erwidert Anna: »Seine Wunde ist erneut aufgegangen. Ich konnte die Blutung stoppen und habe die Wunde notdürftig mit einem Stück Leinen verbunden.« Mein Blick wandert nach links, und tatsächlich entdecke ich dort frisches Blut an meinem Hemd. »Und, Bruder Infirmar –«, Anna zögert, »seine Wunde hat angefangen zu eitern.« Besorgt mustert mich der kleine Mann, der offenbar nicht einfach nur Mönch, sondern wohl gar der Sankt Gallener Klosterarzt ist. Er muss mich bereits bei unserem Eintreffen versorgt haben.
»Für ein erneutes Ausbrennen der Wunde ist es bereits zu spät. Die Öffnung beginnt, sich zu entzünden. Das Fleisch beginnt zu faulen. Ich sehe das nicht zum ersten Mal. Wenn nicht bald etwas geschieht, stirbt er.« Erneut erstarre ich zu Eis. Aber dieses Mal liegt es nicht an Anna; vielmehr ist es der blanke Horror, der mich mit offenem Mund und leerem Blick langsam zu Boden sinken lässt.
»Gibt es nichts, was ihr tun könnt?« Annas Stimme klingt nun bei Weitem nicht mehr so ruhig, wie ich es von ihr kenne.
»Das übersteigt meine Fähigkeiten und mein Wissen. Zudem fehlen mir hier draußen sämtliche Mittel.« Der Infirmar hält kurz inne und fährt dann fort: »Es sei denn …«, er schüttelt den Kopf, »nein, das schafft er nie.«
»Bitte sprecht!« Anna ist näher zum Mönch gerückt. Ihre Hände zittern.
»Es sei denn, ihr schafft es, den Infirmar unserer Brüder in Seckinga um Hilfe zu bitten. Ein weit gereister Mann, der einst bei den Sachsen auf der anderen Seite des Meeres, fernab vom Reich der Francen in den Diensten des großen Königs Alfred stand. Ich habe gesehen, wie er einst einen übelriechenden faulenden Fuß mit dem bloßen Auftragen einer geheimen Salbe geheilt hat. Das übersteigt meine Fähigkeiten bei Weitem. Ich kann lediglich etwas zur Schmerzlinderung beitragen und hoffen, dass der Faulungsprozess damit etwas aufgehalten wird«, ergänzt der Infirmar und reicht mir dabei ein kleines Tontöpfchen mit einer cremigen Substanz.
»Was ist das?«
»Das ist eine Salbe, die ich vor wenigen Tagen aus der Wallwurz, die hier unten am Ufer der Sitteruna wächst, hergestellt habe. Viel ist nach deiner Ankunft jedoch nicht mehr übrig geblieben. Hätte ich bloß meine Kräuter aus dem Infirmarium im Kloster.« Vorsichtig hilft mir Anna, etwas von der Salbe auf die Wunde aufzutragen, die nach anfänglichem Brennen schon nach kurzer Zeit meine Schmerzen etwas lindert.
»Wie kommen wir am schnellsten nach Seckinga?« Annas Tatendrang ist ansteckend, doch vermag ich gerade nicht klar genug zu denken.
Der Infirmar schüttelt nachdenklich den Kopf. »Das schafft ihr nie! Unser junger Freund ist viel zu schwach. Abgesehen davon: Woher wollt ihr wissen, dass Seckinga nicht ebenfalls schon von den Ungrern heimgesucht wurde?«
Während unseres Gesprächs eilen immer mehr Klosterbrüder hoch zum nördlichen Tor. Als das Stimmengewirr immer lauter wird, beschließen wir, uns den anderen anzuschließen, und begeben uns in den höher gelegenen Abschnitt der Burg. »Das ist unmöglich! Man hat uns gesagt, er sei tot.« Nicht nur dem Infirmar ist das Erstaunen ins Gesicht geschrieben.
»Bruder Heribald, du lebst!« Eine etwas dümmlich wirkende Person mit verwirrtem Blick kommt gerade durch das nördliche Tor geschritten. In seinen Armen hält er ein kleines Weinfässchen, und an der Kordel seines Mönchsgewands hängen einige kleine Beutel. Nun ist tragen etwas untertrieben. Vielmehr umklammert er dieses Fässchen, als wäre es sein Erstgeborener, was bei einem Mönch nun doch ein leicht ungeschickter Vergleich ist.
Der Infirmar ist stehen geblieben, doch Heribald, der ihn in der Menge offenbar sogleich erkannt hat, geht geradewegs auf diesen zu. »Wie geht es dir? Wie hast du es hierher geschafft? Was ist geschehen?«
Als hätte er gar nicht zugehört, versucht Heribald, einen der Beutel von seiner Kordel zu lösen, ohne sich dabei vom Fässchen zu trennen. Als dies endlich gelingt, schleudert er dem Infirmar das kleine Beutelchen vor die Füße und klagt: »Die sind völlig nutzlos! Ich wollte den Wein für unsere fremdländischen Brüder etwas schmackhafter machen. Die habe ich bei deinen Sachen gefunden.« Heribald deutet auf den kleinen Beutel im Dreck. »Hat ihnen nicht geschmeckt. Mir war’s auch zu bitter.«
Der Infirmar beugt sich hinab zum Beutel, hebt ihn hoch und begutachtet seinen Inhalt: »Das sind auch keine Gewürze, sondern Heilkräuter!« Er dreht sich zu uns um und strahlt: »Hier drin sind auch Blüten der Johannisblume! Die werden euch helfen.« Wieder an Heribald gewandt, ergänzt er: »Nur gut, hast du nichts davon getrunken. Das wäre dir gar nicht gut bekommen. Du hast doch nichts davon in den Wein gemischt?«
»Bei allen Heiligen! Unseren Gästen habe ich davon gegeben. Was passiert jetzt mit ihnen? Ich muss schnell zurück und sie warnen!«
»Das sind nicht unsere Gäste, und keinesfalls gehst du auch nur einen Schritt zurück!«
Der Dekan drängt sich nach vorne, legt seinen Arm um Heribald und führt ihn fort, weg von der Menge. »Geht wieder an die Arbeit, Brüder!«
Der Infirmar eilt mit dem Kräuterbeutel davon. Wir können ihm kaum folgen. Aus einem Topf, worin gerade die Überreste eines der letzten mitgeführten Schweine ausgekocht werden, schöpft er mehrmals die obenauf schwimmende Fettschicht ab und sammelt den trüben, dickflüssigen Saft in einem kleinen Töpfchen. Zurück bei unserem Schlafplatz der letzten Nächte, der sich gerade als mobile Krankenstatt des Infirmars herausstellt, erhitzt dieser das Schweinefett auf kleinem Feuer, zerpflückt die Blüten aus Heribalds Beutel und gibt sie ins kochende Fett.
»Was wird das, wenn es fertig ist?«
»Eine schmerzlindernde Salbe«, kommt Anna dem Infirmar zuvor und zwinkert mir dabei stolz lächelnd zu.
»Sehr gut, junge Dame. Ihr kennt euch aus. Sobald das Gemisch ausgekühlt ist, können wir es durch diesen Leinenbeutel abtropfen lassen.« Der Infirmar hält einen kleinen Beutel hoch und versichert mir, dass die schmerzstillende Wirkung ein gemächliches Reisen zulassen wird. »Bis morgen früh sollte die Tinktur ausreichend eingedickt sein.«
Urplötzlich zerreißen angsterfüllte Stimmen und Rufe die Ruhe der sich senkenden Abenddämmerung: »Seht dort! Rauch!«
»Herr im Himmel, unser Kloster! Es steht in Flammen!« Entsetzt wenden sich alle Blicke in die Richtung, in der das Kloster des heiligen Gallus zu stehen scheint, und tatsächlich erheben sich gleich mehrere schwarze Rauchsäulen gen Himmel. Aufgrund der fortgeschrittenen Dämmerung wären diese nicht mehr ohne Weiteres zu entdecken gewesen, hätte nicht ein fernes Glimmen das aufziehende Übel angekündigt. Und das Übel war nah.
»Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen; und ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus sieghaft, und dass er siegte.« Ich drehe mich um und erblicke einen hochgewachsenen Mann. Mit entschlossenen Schritten marschiert er an uns vorbei zum unteren Abschnitt der Befestigung. Sein Blick ist fest auf eine Stelle am anderen Ufer der Sitteruna gerichtet. Seiner Tonsur und dem Mönchsgewand nach zu urteilen, gehört er wohl ebenfalls zu den Mönchen. Erst das große hölzerne Kreuz um seinen Hals lässt mich ihn als den Abt erkennen. An seiner linken Seite hängt ein beeindruckendes Langschwert mit edel verziertem Knauf, und am Hals ragt ein Kragen aus feinen Eisenringen unter der Mönchskutte hervor. Plötzlich bleibt der Abt stehen und zeigt nun in jene Richtung, die er gerade so konzentriert beobachtet hatte. Ich folge seinem Blick und sehe ein weißes Pferd, und der, der darauf sitzt, hat einen Bogen. Sie haben uns gefunden.