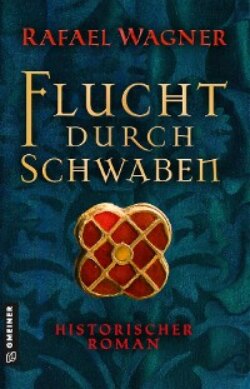Читать книгу Flucht durch Schwaben - Rafael Wagner - Страница 8
Cap. I
Оглавление»In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden; sie werden sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen.« Der Mann neben mir murmelt mit leerem Blick vor sich hin. Ich umklammere den Griff meines Kurzschwertes und wünsche mir das Ende unserer Wache herbei. Inzwischen ist die Sonne aufgegangen. Dennoch lässt uns der feuchte Morgennebel auf der alten Romanenmauer erzittern. Ich höre, wie die Wellen des Sees im langsamen Takt gegen die Uferbefestigungen brechen. Das Wasser ist unruhig. Ein starker Wind kommt auf und treibt weitere Nebelschwaden über uns hinweg. Ich beobachte, wie sich ein kleines Boot, nicht weit von der Mauer entfernt, mit jeder Welle aufs Neue leicht hebt und senkt. Ein pfeifender Wind sucht sich seinen eiskalten Weg meinen Nacken hinab. Trotz allem stehe ich regungslos hier oben auf der Mauer und versuche, neben dem plätschernden Wasser noch andere Geräusche wahrzunehmen. Die Sicht reicht nur knapp bis zum Wassergraben, der die Halbinsel mit Ausnahme eines schmalen Durchgangs beinahe zur Insel gemacht hätte. Höre ich da leises Gemurmel? Schritte?
Plötzlich erschallen aus dem Nebel vor uns verzweifelte Rufe und Schreie. Wie aus dem Nichts taucht eine Gruppe von acht oder neun Personen auf. Sie treffen auf den Graben und folgen diesem bis zur kleinen Holzbrücke. Die zwei Personen an der Spitze haben den Übergang schon fast erreicht. Unsere Turmwache schlägt die Sturmglocke. Aus allen Gebäuden und Unterständen hallen nun Rufe wider, und Männer machen sich bereit für den Kampf. Ich konzentriere mich weiterhin auf die Menschen vor unserem Tor. Ist das eine List? Plötzlich ertönt lautes Hufgetrappel, und aus dem Nebel jagt ein zentaurenähnliches Wesen hervor. Eine Klinge schnellt blitzartig herum und hinterlässt auf dem feuchten Gras einen Schwall von Blut. Die Person am Ende der Flüchtlingsgruppe sackt zuckend in sich zusammen. Zwei weitere werden von Pfeilen niedergestreckt. Ich höre das verzweifelte Hämmern von Fäusten gegen unser Tor. Die ersten Flüchtlinge haben unsere Doppeltoranlage erreicht.
»Tribun, was sollen wir tun?«
»Keiner öffnet die Tore! Das ist eine Falle.«
Es schwirren noch drei weitere Pfeile aus unterschiedlichen Richtungen auf unser Tor zu, doch gehen sie ins Leere. Stille. Wir warten. Wie ein Geist ist der Tod diesen Morgen aus dem Nebel aufgetaucht, und wie ein Geist ist er auch wieder verschwunden.
»Mein Gott, öffnet endlich die Tore!«
Mit einem kurzen Nicken gibt der Tribun den Wachen im Hof die Erlaubnis. Einer der Torflügel wird knarrend aufgezogen, und die Überlebenden retten sich mit letzter Kraft hinter die festen Steinmauern. Der grausame Klang eines Horns lässt uns erschauern. Sofort wird das Tor wieder geschlossen. Gebannt blicken wir in den Nebel. Ein zweites Mal ertönt das grausige Horn. Und plötzlich tauchen aus dem Nebel schemenhaft vier fremdartige Reiter auf. Vier Krieger in aufgebauschter Kleidung sitzen dort auf ungewöhnlich kleinen Pferden. Dieses Zusammenspiel von Ross und Reiter erklärt auch das merkwürdige Erscheinungsbild des säbelschwingenden Angreifers von vorhin. Eine gefühlte Ewigkeit stehen sie dort hinter dem Graben und beobachten uns. Dann ertönt das Horn ein drittes Mal. Das ganze Ufer entlang erscheinen wie von Zauberhand grelle Lichtkegel.
»Was ist das für ein Teufelswerk?«
»Was haben sie vor?« Überall auf den Mauern ertönen angsterfüllte Rufe, und Menschen sinken zum Gebet auf die Knie.
»Selbst Gott kann uns jetzt nicht mehr retten«, höre ich erneut die zittrige Stimme meines Nebenmanns.
»Ruhe!«, erhebt der Tribun seine kräftige Stimme. »Das sind Menschen. Sie bluten wie wir, sie sterben wie wir. Ich habe diese Teufel schon in jungen Jahren bei Brezalauspurc bekämpft.« Auf den Mauern ist inzwischen Ruhe eingekehrt. »Seit Tagen haben wir Kunde von fremden Horden, die über die östlichen Marken herfallen. Nun sind sie hier. Doch wir sind bereit, und ich werde sie jederzeit aufs Neue bekämpfen.« Mit seiner tiefen, hallenden Stimme schafft es der Tribun, selbst meinen zitternden Nebenmann zu beruhigen. »Jeder, der es wagt, unsere Mauern zu erklimmen, soll in seinem eigenen Blut ertrinken. Arbona ist noch nie gefallen, Arbona wird nie fallen, solange tapfere Männer seine Mauern verteidigen.« Die neuesten Ereignisse beflügelten die Moral ja nicht gerade, doch der Tribun hat recht: Wir befinden uns gut geschützt auf einer Halbinsel hinter dicken Steinmauern. Zwar weisen die Mauern an gewissen Stellen Lücken auf, und zwei der Halbrundtürme sind teilweise zugunsten eines Kirchenbaus abgetragen worden, doch verfügen wir über ausreichend Männer, um unser Bollwerk über längere Zeit zu halten, und die besonders gefährdeten Stellen sind längst mit Holz verstärkt worden.
»Folge mir, der Centenar versammelt gerade die Wachen der letzten Nacht«, raunt mir einer der Torwächter schulterklopfend zu. Erleichtert folge ich meinem Kameraden die Leiter hinunter in den Hof.
»Ihr habt heute guten Dienst geleistet«, setzt der Centenar an und nickt der Turmwache, die als Erste Alarm geschlagen hatte, anerkennend zu. »Wir müssen sie weiterhin mit unserer Präsenz auf den Mauern von einem Angriff abhalten. Unsere geschützte Lage im Bodamansee und die dicken Mauern scheinen diesen Feiglingen die Lust zum Angriff zu nehmen. Den verdammten Romanen sei’s gedankt!« Der Centenar grinst in die Runde, merkt, dass seine kleine Ansprache auf nur wenig Zuspruch stößt, und fährt dann mit ernster Miene fort: »Lasst euch nicht von ihren billigen Tricks entmutigen. Die zahlreichen Fackeln am Ufer sollten nur eine zahlenmäßige Überlegenheit demonstrieren und euch einer ausweglosen Situation bewusst werden lassen. Doch wir befinden uns zweifellos in der besseren Position als sie. Wir haben schließlich den See.« Noch immer scheinen ihm unsere müden Gesichter nicht ausreichend motiviert. So fährt er resigniert zum eigentlichen Punkt seiner kleinen Ansprache fort: »Ich weiß, ihr seid erschöpft und habt euch euren Schlaf redlich verdient. Doch muss ich euch noch um eine letzte Sache bitten. Den Menschen, die heute zu uns gestoßen sind, ist Schreckliches widerfahren. Gebt ihnen zu essen. Zeigt ihnen einen Platz zum Schlafen.«
Währenddessen haben uns die Überlebenden, die in der Nähe des Tors erschöpft am Boden sitzen, aufmerksam beobachtet. Besonders der Blick einer kleinen Gestalt unter einem dicken Umhang erregt dabei meine Aufmerksamkeit. Müde nähern wir uns der Gruppe von Flüchtlingen, und ich erkenne unter der Kapuze das feine, blasse Gesicht eines Mädchens, kaum älter als ich. Ich weiß nicht, wie lange sie mich während der Ansprache des Centenars bereits beobachtet hat, doch in ihrem Blick liegt etwas angenehm Vertrautes. Kenne ich sie? Ihr scheint es ebenso zu gehen. Sie kann die Augen kaum von mir abwenden. Als die Gruppe unser Tor passierte, ist sie mir gar nicht aufgefallen. Sie mustert mich eingehend, wendet dann jedoch den Blick von mir ab, als sich einer meiner Wachkameraden ihrer annimmt und ihr den Weg in die Küche weist. Zwar verfügen wir über ausreichend Männer zur Bemannung der Festung, doch können wir jedwede Unterstützung gebrauchen, ob auf der Mauer oder in der Küche. Wir geleiten die Gruppe zur Feuerstelle und stillen dabei auch unseren Hunger. Meine Gedanken sind noch beim geheimnisvollen Mädchen. Gibt es so etwas wie Seelenverwandte? Vielleicht habe ich sie auch einfach so unangenehm lange angestarrt, dass sie irgendwann zurückblicken musste. Ich schüttle meinen Kopf frei von all diesen Überlegungen. Es sollten mich nun ganz andere Dinge kümmern. Gedankenverloren bin ich als Erster mit meinem Haferbrei fertig und eile zu den Stallungen, um mir einen guten Schlafplatz im Stroh zu suchen, möglichst nahe beim Vieh. Hier ist zwar nicht alles perfekt, doch bin ich lieber hier als draußen bei diesen schwertschwingenden Teufeln.