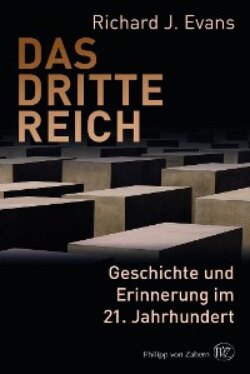Читать книгу Das Dritte Reich - Richard Evans - Страница 15
III
ОглавлениеIm 18. Jahrhundert erlebten gesellschaftliche Randgruppen und Außenseiter daher weniger eine allgemeine Verbesserung ihrer Stellung, sondern eher die Anfänge einer Neudefinition dessen, wer ein Außenseiter war, wer es bleiben und wer – wenigstens dem Gesetz nach – in die Gesellschaft integriert werden sollte. Diese Prozesse wurden durch die Auflösung der traditionellen sozialen Ordnung im Zuge des Bevölkerungswachstums, des ökonomischen Wandels und der Auswirkungen der britischen Industrialisierung auf dem Kontinent beschleunigt. Die französischen Revolutionskriege und die Napoleonischen Kriege befeuerten den Reformeifer aufgeklärter Monarchen und Bürokraten, die sich bemühten, ihre Herrschaft angesichts der Gefahr aus Frankreich zu modernisieren und effektiver zu gestalten. Allmählich entstand eine neue bürgerliche Öffentlichkeit, deren gebildete Mitglieder an Gleichheit vor dem Gesetz und die Verbreitung staatsbürgerlicher Freiheiten und Verantwortlichkeiten in einem freien Markt und einer liberalen politischen Ordnung glaubten. Am wichtigsten für den Integrationsprozess aber war die drastische Einschränkung der Macht der Zünfte in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, die einerseits durch die Industrialisierung ausgehöhlt und andererseits von staatlichen Reformen angegriffen wurde. Der Übergang von einer „Ständegesellschaft“ zur „Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert stellte gesellschaftliche Außenseiter vor eine neue Situation.
Viele Gruppen, die per Gewohnheit und Gesetz aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden waren, wurden im Zuge der liberalen Reformen ab der Jahrhundertmitte allmählich, wenn auch in manchen Fällen unvollkommen, integriert. Die veränderte Situation der Juden war das augenfälligste Beispiel. Sie erlangten 1871 die staatsbürgerliche Gleichstellung und gaben in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in wachsender Zahl ihre gesellschaftliche Isolation und religiöse Identität auf. Natürlich waren sie auch weiterhin von den höchsten Machtpositionen in Armee, öffentlichem Dienst und Politik ausgeschlossen. Aber obwohl sie weiter unter Diskriminierung litten, machte sie das nicht zu gesellschaftlichen Außenseitern. Juden waren vor dem Ersten Weltkrieg auf mannigfache Weise in die deutsche Gesellschaft integriert. Selbst Kaiser Wilhelm II. hatte, trotz seiner gelegentlichen antisemitischen Ausfälle, eine Reihe enger persönlicher Freunde, die Juden waren.
Auch andere Gruppen blieben von Spitzenpositionen in Regierung und Gesellschaft des Bismarck’schen und Wilhelminischen Reiches ausgeschlossen. Die zahlenmäßig stärkste dieser Gruppen bildeten die Frauen, die nicht einmal wählen durften und nur langsam ein Mindestmaß an grundlegenden Bürgerrechten erlangten. Frauenrechtlerinnen, die ihr Los zu verbessern suchten, waren häufig anhaltenden Schikanen durch die Polizei ausgesetzt. Noch mehr ins Auge fiel, dass die beiden größten politischen Bewegungen der damaligen Zeit, die Sozialdemokraten und der politische Katholizismus, auf politischer wie administrativer Ebene vom Staat ausgegrenzt und weitreichender gesetzlicher Diskriminierung und politischer Schikane ausgesetzt waren. Doch am Ende waren diese Gruppen zwar gesellschaftlich benachteiligt, keineswegs aber gänzlich ausgeschlossen, denn zusammengenommen bildeten sie die überwiegende Mehrzahl der damals in Deutschland lebenden Menschen.
Allerdings ist ihre missliche Lage nicht ohne Bedeutung für die spätere Geschichte der staatlichen Politik gegenüber gesellschaftlichen Außenseitern. Insbesondere Bismarcks Taktik, Sozialdemokraten und Katholiken als „Reichsfeinde“ abzustempeln und sie auf mannigfache Weise zu verfolgen, von Inhaftierung aufgrund kleinlicher oder erfundener Beschuldigungen bis zum generellen Verbot vieler ihrer Aktivitäten, schuf für die Zukunft einen unheilvollen Präzedenzfall. Die konservative Rhetorik hatte im 19. Jahrhundert verschiedentlich Verbrechen und Revolution in einen Topf geworfen und dafür plädiert, politische Radikale wie gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. In dieser Tradition nutzten Bismarck und seine Nachfolger das Strafrecht, um Gefährdungen der sozialen und politischen Ordnung des Reiches zu bekämpfen. In den Köpfen vieler Richter und Vollzugsbeamten, die den Zusammenbruch des kaiserlichen Deutschland 1918 überstanden hatten und die ganze Weimarer Republik hindurch auf ihren Posten verblieben waren, war dieses Vorgehen weiterhin sehr präsent.12 Auch in anderen Ländern waren politische Bewegungen – vor allem der Anarchismus, der im ausgehenden 19. Jahrhundert für eine Welle politischer Morde in Europa und Amerika verantwortlich zeichnete – polizeilicher und gesetzlicher Unterdrückung ausgesetzt, aber nur in wenigen Ländern westlich des zaristischen Russland ging das so weit wie hier.
Die politische Unterdrückung verwob sich schon zu jener Zeit mit dem Strafrecht und der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, da der Staat in Deutschland seine Haltung zur sozialen Ausschließung rationalisierte. Als die Macht der Zünfte schwand, wurden viele Gewerbe, vom Müller bis zum Leineweber, geachteter. Andere, etwa die Schäferei, sanken zu marginaler Bedeutung herab. Die Ehre verlor ihren Stellenwert bei der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung, und zugleich verlor die Entehrung ihren Stellenwert als Mittel der Bestrafung durch Gesetz und Staat. Eine geregelte Arbeit und ein fester Wohnsitz, denen schon von den aufgeklärten Verwaltungen des 18. Jahrhunderts größte Bedeutung beigemessen worden war, avancierten im 19. Jahrhundert zu ausschließlicheren Kriterien sozialer Zugehörigkeit. Ohnehin brachten Industrialisierung und Verstädterung mit ihren kürzeren Kommunikationswegen, mit Massenproduktion und -vertrieb dem Wandergewerbe größtenteils den Niedergang. Die verbliebenen Wander- und Saisonarbeiter, etwa die Handwerksgesellen, hatten zunehmend Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und mussten sich in wachsendem Maße aufs Betteln verlegen. Zugleich zog das Wirtschaftswachstum bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften in den Städten und Großstädten nach sich. Viele Arbeiter reisten auf der Suche nach Arbeit durchs Land und waren den raschen Schwankungen der industriellen Produktion schutzlos ausgesetzt. Schließlich ersetzten auch die Großgrundbesitzer des Nordens und Ostens sesshafte Arbeitskräfte zunehmend durch Saisonarbeiter, was wiederum große Gruppen fahrender Landarbeiter (oft aus Polen) anlockte, die zu verschiedenen Zeiten des Jahres Arbeit suchten.
All dies trug zu dem bei, was zeitgenössische Beobachter im späten 19. Jahrhundert als wachsendes Vagabundenproblem bezeichneten. Lösungsversuche reichten von neu errichteten Arbeiterkolonien bis zur erstmaligen Bereitstellung billiger Herbergen für Wohnungslose, gegründet von karitativen, oftmals religiös inspirierten Stiftungen. Vagabunden und Wanderarbeiter blieben jedoch stets der Schikane und Belästigung durch Polizei und Gerichte ausgesetzt, die Bettelei ebenso ahndeten wie das Nichtmitführen von Papieren und Landstreicherei, was mit der wiederholten kurzzeitigen Inhaftierung in einem Arbeitshaus oder Gefängnis bestraft wurde.13 Aus der Armenfürsorge, bis dahin eine Sache allgemeiner Barmherzigkeit, wurde in dieser Zeit unter dem Einfluss des sogenannten Elberfelder Systems eine genaue Beaufsichtigung der Mittellosen, die zugleich unter Androhung des Verlusts ihres Unterstützungsanspruchs gezwungen wurden, sich Arbeit in einem Arbeitshaus oder in einer schlecht bezahlten Stellung zu suchen. Eine ähnliche Strategie verfolgte man gegenüber den Sinti und Roma, die von der Polizei mit der Ausweispflicht, dem Steuerrecht, dem Gesetz gegen das Konkubinat und der Meldepflicht ständig schikaniert wurden.
Nachdem die Vollbeschäftigung weitgehend erreicht war und eine staatliche und freiwillige Arbeiterfürsorge existierte, galten Vagabundentum, Bettelei und Landstreicherei nicht mehr als Reaktionen auf Arbeitslosigkeit, sondern als persönliche Entscheidungen seitens der „Arbeitsscheuen“ und all jener, deren Verhalten von der Norm abwich. Allerdings hatten solche Strategien ihre Grenzen. Das Fehlen einer nationalen Polizei und die Zuständigkeit lokaler Beamter bedeuteten, dass die Behörden sich häufig damit begnügten, „Zigeuner“ und Landstreicher einfach aus ihrem Verwaltungsbezirk zu verbannen und die Verantwortung anderen zu überlassen. Tatsächlich versahen lokale Behörden sie oft genug mit Ausweispapieren, die bescheinigten, dass sie redliche Wandergesellen seien, bloß um sie loszuwerden.14
Dieselbe Art von Strategie wurde auf die Prostitution angewandt, die Kommentatoren gewöhnlich nicht als das ansahen, was sie sehr oft war, nämlich ein vorübergehendes Auskommen junger Frauen als Reaktion auf Arbeitslosigkeit oder uneheliche Mutterschaft, sondern als freiwillige Devianz. Folglich waren Prostituierte weiterhin polizeilicher Schikane ausgesetzt, wenn sie sich weigerten, sich der kleinen Minderheit anzuschließen, die in staatlich reglementierte „öffentliche Häuser“ oder Bordelle gesperrt wurde. Die meisten jedoch konnten sich der polizeilichen Aufmerksamkeit entziehen.15
Zur selben Zeit beharrte der Staat zunehmend auf der Notwendigkeit, sich in eigens geschaffenen Einrichtungen um geistig und körperlich Behinderte zu kümmern. Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der großen Nervenkliniken und „Irrenanstalten“, als Medizin und Recht eine Reihe medizinischer Definitionen für abweichendes Verhalten ausarbeiteten. Angesichts der zunehmenden Verstädterung aufgrund von Landflucht wurde es für die Mehrzahl der Familien schwieriger, ihre geistig und körperlich behinderten Angehörigen zu versorgen. Zumal auch die Ärzteschaft zunehmend eingriff, um die Einweisung der geistig Behinderten in Einrichtungen zu erzwingen, selbst wenn die Familie der betroffenen Person sich sträubte.16
Es wäre falsch, solch ärztliches Eingreifen in ausschließlich negativem Licht zu sehen. Zweifellos gab es einige Arten geistiger Verwirrung, die ärztlich behandelt werden konnten; und die Situation der geistig und körperlich Behinderten in den Elendsquartieren deutscher Großstädte im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert war sicher nicht beneidenswert. Ärztliches Eingreifen und die Einweisung einer Person in eine Einrichtung mögen das Leben manches Betreffenden durchaus verlängert haben; in einigen Fällen retteten sie sogar Leben, wenn die Gerichte überzeugt werden konnten, wegen der Geisteskrankheit eines Mörders auf die Verhängung der Todesstrafe zu verzichten.17 Dennoch trug zweifellos die stärkere Intervention der Ärzteschaft, die zunehmend auch den Staat dafür gewann, geistige oder körperliche Unzurechnungsfähigkeit zu bescheinigen, im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer zunehmenden Stigmatisierung bestimmter Arten geistiger und körperlicher Behinderung bei.
All dies läuft darauf hinaus, dass soziale und sexuelle Devianz im 19. Jahrhundert nicht in erster Linie durch Maßnahmen und Initiativen auf Regierungsebene angegangen wurde, sondern in den alltäglichen Aufgabenbereich von Instanzen fiel, die man als niedere Überwachungs- und Verwaltungsebene bezeichnen könnte. Mal unter Anwendung des Strafrechts, mal mit dem Hinweis auf lediglich lokale Verordnungen oder Verfügungen, schikanierte und bedrängte die Polizei Nichtsesshafte, Bettler, Vagabunden, Sinti und Roma und Prostituierte mehr oder weniger genauso wie aufsässige katholische Priester während des Kulturkampfs oder sozialdemokratische Aktivisten unter dem Sozialistengesetz und noch lange danach. Auch Paragraf 175 des Reichsstrafgesetzbuchs von 1871, der gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern (nicht zwischen Frauen) verbot, war ein solches Instrument in den Händen der Polizei, die Homosexuelle in Großstädten wie Berlin drangsalierte.18
Die Folgen waren beinahe vorhersehbar. Das Fehlen nationaler Richtlinien und die unzureichenden polizeilichen Ressourcen sorgten dafür, dass gesellschaftliche Außenseiter als deviant stigmatisiert und identifiziert wurden, durch zahlreiche Verurteilungen für die Behörden leicht fassbar waren und sich häufige und willkürliche Einmischungen in ihre Lebensweise gefallen lassen mussten. Dass die polizeiliche Intervention die Zahl der gesellschaftlichen Außenseiter reduziert oder ihre Integration in die Gesellschaft befördert hätte, ist illusorisch. Im Gegenteil, polizeiliche Schikane stärkte die Außenseiteridentität noch, indem sie den Groll gegen die Gesellschaft schürte und das Entstehen schützender Subkulturen beförderte. Folglich entwickelte sich in Berlin eine homosexuelle und im Süden und Westen eine katholische Subkultur. Auch die organsierte deutsche Sozialdemokratie entwickelte eine Art Gauner-Szene, mit eigenem Jargon, eigenen Treffpunkten und eigenen Kreidezinken an Häusern und Straßenecken.19 Die Kultur der Sinti und Roma, obschon kaum Gegenstand etablierter historischer Forschung, wurde höchstwahrscheinlich in ähnlicher Weise durch diese unstatthafte, aber unausweichliche Verfolgung gefestigt.20
Dasselbe kann man von der kriminellen Subkultur im Deutschland des 19. Jahrhunderts behaupten. Als Inhaftierungen die öffentliche Körperstrafe als wichtigste strafrechtliche Sanktion ersetzten, fiel Kommentatoren auf, dass die Mehrzahl der Gefängnisinsassen Wiederholungstäter waren. Das Gefängnis schien kriminelle Identitäten also zu festigen und nicht zu ihrer Läuterung beizutragen. Ein Vorstrafenregister versperrte Menschen den Weg zu regulärer Beschäftigung, sofern sie eine solche wünschten, während die Gesellschaft anderer Häftlinge ihr kriminelles Identitätsgefühl bestärkte. Alle Versuche, diese Situation zu bessern, scheiterten. Einzelhaft, die Schweigeregel, religiöse Unterweisung und Gefängniserziehung, wie von Reformern befürwortet, wurden zu sporadisch in die Tat umgesetzt, um irgendeine allgemeine Wirkung zu entfalten. Auch Freiwilligenvereine zur Betreuung entlassener Häftlinge gab es zu wenige, als dass sie mehr als marginalen Einfluss hätten ausüben können, und karitative „Magdalenenheime“ zur Besserung von Prostituierten, philanthropische Arbeiterkolonien und karitative Herbergen für Vagabunden streiften kaum das Problem, das sie in Angriff zu nehmen versuchten.
Tatsächlich trug die Stigmatisierung dieser gesellschaftlichen Außenseiter weiterhin dazu bei, die soziale Bedrohung zu perpetuieren, welche sie in den furchtsamen Augen der achtbaren Gesellschaft darstellten. Sie erinnerte das Bürgertum und die achtbare Arbeiterschaft gleichermaßen an das Schicksal, das jene erwartete, die gravierend von den sozialen, sexuellen oder gesetzlichen Normen abwichen. Zu einer etwas anderen Kategorie gehörten die ethnischen Minderheiten Preußens und später des kaiserlichen Deutschland, hauptsächlich Elsässer und Lothringer, Dänen und vor allem Polen. Doch auch hier gab es einen überwältigenden Trend zur Assimilation. Lokale deutsche Behörden versuchten den Gebrauch des Polnischen, Französischen, Dänischen und der elsässischen Mundart in offiziellen Kontexten einschließlich staatlicher Schulen zu unterdrücken, begünstigten deutschsprachige Siedler und wendeten das Gesetz zum Nachteil der ansässigen nicht deutschsprachigen Bevölkerung an. Das Ergebnis war so vorhersehbar wie in anderen Kontexten: Nationalistische Bewegungen erstarkten, und es entstand eine starke regionale oder nationalistische Subkultur, welche in den Deutschen kaum mehr sah als eine Besatzungsmacht.21 Inwieweit auch körperlich und geistig Behinderte in der Lage waren, innerhalb der Einrichtungen, in die man sie sperrte, eigene Subkulturen auszubilden, ist schwer einzuschätzen; von ihrer Familie und Gemeinschaft getrennt und von der Welt jenseits der Anstaltsmauern weitgehend abgeschnitten, waren sie unter allen gesellschaftlichen Außenseitern im Deutschland des 19. Jahrhunderts wohl die schutzlosesten.