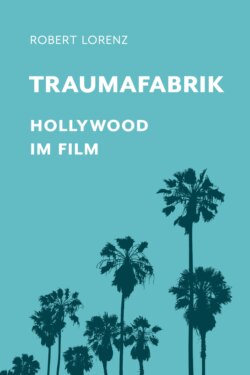Читать книгу Traumafabrik - Robert Lorenz - Страница 3
Vorspann
Оглавление„Hollywood was another planet. Everything looked different, smelled different, tasted different.“ (Evans, Robert: The Kid Stays in the Picture, New York 2013 [1994], S. 37) Hollywood wurde „Traumfabrik“, Dream factory, getauft, was zu der Aussage von Elia Kazan, dem Regisseur einiger der größten Hollywoodfilme, passt: „Hollywood is […] an art organized as an industry.“ (Kazan, Elia: A Life, New York 1988, S. 250.) „Tinseltown“ ist ein anderer Kosename für die Stadt, in der die größten Filmstudios der Geschichte entstanden und Menschen zu Überlebensgröße anwachsen konnten. Sie entwickelte sich zum Mythos, hat mit extravaganten Kinogebäuden wie „Grauman’s Chinese“ oder dem „Pantages Theatre“ eine faszinierende Architektur hervorgebracht – als Kinos mit ihren palastartigen Ausmaßen noch regelrechte Tempel der Lichtspielunterhaltung waren. Und mit weltbekannten Gesichtern wie jenen von Charlie Chaplin, Marilyn Monroe oder James Dean hat sie eigene Ikonen erschaffen.
Die charismatische Aura Hollywoods entfaltete schon früh ihre Wirkungskraft; so schrieben die Geschwister Erika und Klaus Mann auf ihrer USA-Reise in den späten 1920er Jahren: „Die Atmosphäre von Hollywood hat, bei aller Ödigkeit, viel Faszinierendes, sie zieht an, saugt auf, nimmt gefangen. Man verliert das Gefühl für die Zeit, wie im Zauberberg, sie entgleitet, ohne daß man wüßte, welchen Inhalt sie hatte.“ (Mann, Erika/Mann, Klaus: Rundherum. Abenteuer einer Weltreise, Reinbek bei Hamburg 2017 [Berlin 1929], S. 31.)
Als 1913 der damals 32-jährige Cecil B. DeMille in Los Angeles ankam und in einer gelben Scheune nahe einem Filmlabor sein Quartier aufschlug, gab es dort bereits mehrere Filmbetriebe. Die Jesse L. Lasky Feature Play Company – das Unternehmen von DeMille, Lasky und Samuel Goldfish (der sich später Goldwyn nannte), aus dem wenig später Paramount Pictures hervorging – war allerdings bald schon das älteste noch existierende Studio, da die anderen kleinen Firmen in den üblichen Turbulenzen einer Gründerzeit relativ rasch wieder verschwanden. Hollywood als geografischer Ort, der von dem mentalen, ikonologischen schon bald überstrahlt wurde, war da gerade Los Angeles einverleibt worden.
Die damals noch nahezu kleinstädtisch-ländliche Region lockte mit ihrem einzigartigen Klima und ihrer vielseitigen Topografie die frühen Filmentrepreneur:innen an: „[T]hey had God-given light for more than twelve hours a day, 360 days in the year, as well as every known type of landscape from snow to desert, from arid plains to spectacular mountains and everything in between“ (Olivier, Laurence: Confessions of an Actor. The Autobiography, London 2002 [1982], S. 209), beschrieb der zeitweilige Hollywoodimmigrant Laurence Olivier die örtlichen Vorzüge. „It [Hollywood] was a pleasant, intimate place – everybody knew everybody“ (Allan Dwan zit. nach Bogdanovich, Peter: Who the Devil Made it, New York 1997, S. 81), erinnerte sich Allan Dwan, einer der Regiepioniere. „And it was rural – hardly any traffic to speak of – orange groves and lemon groves everywhere; not many houses and no big buildings. It was just a small town.“ (Allan Dwan zit. nach Bogdanovich 1997, S. 82.) In Windeseile transzendierte Hollywood vom geografischen zum mentalen Ort, wurde zum Synonym für die US-amerikanische Filmbranche, später dann zum Antagonisten unterschiedlichster Strömungen, von der Nouvelle Vague über die British New Wave bis zum New Hollywood-Kino.
Als Ursprungsort weltweit vertriebener Filmunterhaltung eroberte sich Hollywood schnell einen Platz in der Öffentlichkeit. Und ganz konform mit den Gesetzen der modernen Massenmedien fielen die Blicke in dieser Arena vor allem auf die Verfehlungen, die sich das Hollywoodvölkchen regelmäßig leistete. Das in den 1960er Jahren zunächst verbotene, zehn Jahre später wiederaufgelegte Buch „Hollywood Babylon“ von Kenneth Anger war ein boulevardeskes Kompendium teilweise, vermutlich sogar größtenteils ausgedachter Skandalgeschichten, das Hollywood als lasterhaften Ort von maroder Moral zeigte. Blickt man auf die Schilderungen jener Menschen, die in Hollywood gelebt, seine Werte und Gesellschaft hautnah miterlebt haben – Regisseure, Stars, Produzenten –, dann sind es tatsächlich oft Erzählungen von Niedertracht, Leid und Untergang. Viele Hollywoodbewohner:innen kamen aus ärmlichen oder allenfalls bescheidenen Verhältnissen, ehe sie in Los Angeles reich und berühmt wurden. Aber in unzähligen Fällen schien sich ihr privates Unglück lediglich zu verlagern oder aufzuschieben. Die soziale Mobilität, die Hollywood ermöglichte, war jedenfalls oft genug bloß ein Unglücksmoratorium. Eine Zeit lang ließ sich kommod im Reichtum schwelgen, ließen sich die Edeletablissements, Sportwagen und Strandhäuser genießen; aber bei etlichen Stars und Mächtigen überwog doch am Ende das Unheil, folgten Scheidungen, Bankrotte, Selbstmorde.
Hollywood präsentierte sich als abenteuerlicher Möglichkeitsraum, konnte sich aber auch schnell zum mentalen Gefängnis entwickeln, das seinen Insassen freilich eine komfortable Haft gestattete. „In this town, it’s not how you perceive yourself, it’s how others perceive you“ (Robert Aldrich zit. nach Petit, Chris/Combs, Richard: Interview with Robert Aldrich (1977), in: Miller, Eugene L./Arnold, Edwin T. (Hg.): Robert Aldrich. Interviews, Jackson 2004, S. 125–142, hier S. 139), resümierte (und warnte) der Regisseur Robert Aldrich (1918–83), der oft als Hollywoodaußenseiter apostrophiert worden ist, sich dem System mit seinen Zwängen und Routinen, so oft es ging, entzog, aber nichtsdestotrotz dort seine Karriere begonnen und auch für die großen Studios gearbeitet hatte. Einen dieser Zwänge brachte einmal die 1934 geborene Shirley MacLaine, die eine der langlebigsten Hollywoodkarrieren vorzuweisen hat, auf den Punkt: „Everyone in Hollywood wants to be appealing to large masses of people, particularly the bosses.“ (MacLaine, Shirley: My Lucky Stars. A Hollywood Memoir, New York u.a. 1996, S. 126.)
Als eines der traurigsten Beispiele für das Ausmaß von Erfolg und Scheitern dient ausgerechnet der erste Gigant der Filmgeschichte, D.W. Griffith. Der 1875 in Kentucky geborene Regisseur, Sohn eines Südstaatenoffiziers und ehemaliger Fahrstuhlführer in einem Kaufhaus, gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher:innen überhaupt, auf seine Projekte gingen bahnbrechende Innovationen zurück, Techniken wie das Close-up, die unmittelbar in das kinematografische Standardrepertoire übergingen. Mit Produktionen wie „The Birth of a Nation“ (1915) erklomm der Film als künstlerisches Werk und Unterhaltungsprodukt ein völlig neues Niveau. Aber gerade Griffith, der Avantgardist des modernen Kinos, war auch eines seiner ersten prominenten Opfer. Bei dem epischen Stummfilmspektakel „Intolerance“ (1916) mit seinen kolossalen Kulissen und tausenden Statist:innen fielen Vision und Größenwahn zusammen. Mitr diesem Film verschaffte sich Griffith zwar Respekt, aber verschuldete sich hoch. Als auch später der Publikumserfolg ausblieb, wollte niemand mehr mit Griffith drehen. Der Regisseur, der die Grundpfeiler des Hollywood eingezogen hatte, das ihn nun fallen ließ, ruinierte sich im Alkohol und starb 1948 als verbitterter Trunkenbold.
Etliche Filme, viele davon in Hollywood produziert, blicken auf diesen sagenumwobenen, mythischen Ort an der US-amerikanischen Westküste, auf unterschiedliche Hollywoodepochen und -aspekte. Sie zeigen, dass sich Hollywood so wichtig nimmt, aus sich selbst ein eigenes Subgenre zu machen – den Hollywood-Film (Filme über Hollywood im Unterschied zu Hollywoodfilmen: Filmen aus Hollywood). Viele dieser Filme sind nicht nur für sich allein schon sehenswert – künstlerisch beeindruckend, packend erzählt oder cineastisch relevant –, sondern werden es spätestens, sobald man die zahlreichen Facetten beleuchtet, die sie mit dem „echten“ Hollywood verbinden.
Die kalifornische Filmindustrie spezialisierte sich von Beginn an auf den menschlichen Eskapismusbedarf. Hollywood entführte die Zuschauerinnen und Zuschauer:innen in ferne Länder, Zeiten, Szenarien; und weil die zivile Luftfahrt gerade erst ihren Anfang nahm, musste Hollywood all diese Orte lokal verfügbar machen – was zu den gigantischen Kulissengeländen führte, auf denen ganze Welten im Kleinformat entstanden. Durch seine kommerzielle Ausrichtung und, damit verbunden, die künstlerische Sensorik seiner Filmemacher:innen war Hollywood auch immer ein Indikator. Hollywoodproduktionen haben eine sehr straffe Intention, viel Geld zu verdienen. Diese Absicht impliziert die Notwendigkeit, die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen zu ergründen, zu kennen. Insofern lagert in Hollywoodfilmen oftmals eine mutmaßliche Publikumsmentalität, die sowohl etwas über die Schöpfer:innen als auch das anvisierte Publikum dieser Filme zu erzählen weiß. Regisseur:innen und Drehbuchschreiber:innen sind tendenziell hochkreative Köpfe, die Stimmungen, Mentalitätskonjunkturen, die Lage der US-amerikanischen Seele zu spüren meinen und diese Eindrücke in ihren Filmen verarbeiten.
Für die USA besaß Hollywood stets eine zwiespältige Bedeutung: Einerseits galt es als unfassbarer Sündenpfuhl, als Ort der Dekadenz und Skandale, des moralischen Abgrunds; andererseits erschien es als ultimative Bestätigung des American Dream, als die weit sichtbare Verwirklichung des in der Verfassung verbürgten Rechts auf das „pursuit of happiness“. Für viele war es daher ein Sehnsuchtsort, wo sich das vage Versprechen auf Reichtum und Glück tatsächlich verwirklichen ließ. Dass dies freilich nur einem Bruchteil der Menschen gelang, die dafür nach Los Angeles kamen, ließ sich geflissentlich ausblenden. Für Schauspieler:innen schien jedenfalls das maximale Ziel darin zu bestehen, Star eines der großen Filmstudios zu werden. Gleich mehrere Filme thematisieren diesen Traum und seine Verwirklichung – aber auch, wie er in einen Albtraum umschlagen kann.
„What Price Hollywood?“ aus dem Jahr 1932 zeigt den Aufstieg einer Kellnerin zum Superstar. Er ist zugleich der Urahn der „A Star Is Born“-Filme, in dessen erster Variante eine Frau ganz und gar gemäß dem amerikanischen Traum buchstäblich von der Tellerwäscherin zur Millionärin wird. „A Star Is Born“ ist inzwischen so etwas wie das Gütesiegel einer periodischen Selbstbeschau der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Der gleichnamige Originalfilm stammt aus dem Jahr 1937; darin spielen Janet Gaynor und Fredric March das tragische Duett der gegenläufig auf- und absteigenden Stars. Nach der Neuauflage im Jahr 1954 mit Judy Garland und James Mason in den Hauptrollen folgte dann 1976 eine dritte Version – diesmal mit den seinerzeitigen Entertainment-Granden Barbra Streisand und Kris Kristofferson (der sich im Hinblick auf seinen damaligen Lebenswandel als Alkoholiker darin größtenteils selbst spielt); die Hauptfiguren wurden von der Film- in die Musikbranche versetzt; 2018 folgte dann ein Remake des Remake-Remakes mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Die Essenz der Geschichte ist bei allem Wandel jedoch gleich geblieben:
„An ambitious girl rises to the top while the man who has supported her and adores her goes to the bottom. She never ceases to love him, despite the fact, that the relationship becomes more and more impossible. And in the great tragedy, her love survives.“ (Selznick an William Wyler, 11.11.1949, zit. nach Behlmer, Rudy (Hg.): Memo from David o. Selznick. The Creation of Gone With the Wind and Other Motion-Picture Classics – as revealed in the producer’s private letters, telegrams, memorandums, and autobiographical remarks, New York 2000, S. 430.)
Das war der romantische Nukleus, den der Produzent David O. Selznick in den frühen 1930er Jahren für seine Idee wählte, einen ernsthaften, in vielen Aspekten realistischen Film über Hollywood zu drehen, um dem Publikum auf der ganzen Welt endlich Hollywoods Vielseitigkeit zu zeigen.
Die „A Star Is Born“-Filme entführen ihr Publikum nicht nur hinter die Kulissen des Showbusiness, womit sie zeigen, welch Leid und Quälereien großem Entertainment zugrunde liegen; sondern sie machen es zu Voyeur:innen, die mit ihrem bedenkenlosen Unterhaltungskonsum, mit ihrer wechselhaften Gunst und ihren kurzlebigen Sympathien ebendieses System unterstützen, aber auch mit ihrem Interesse an Skandalen und Fehltritten, den Sujets und Bildern der Boulevardpresse, immer neue Norman Maines (so der Name des tragischen Stars in den ersten beiden Versionen von 1937 und 1954) hervorbringen. Der Blick auf die düsteren Seiten der Filmindustrie im Allgemeinen, Hollywoods im Besonderen erreicht hier zwar nicht das schonungslose Niveau des New Hollywood-Kinos in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern; aber es sind doch erstaunlich (selbst-)kritische Perspektiven auf unerbittliche Systemmängel: den unstillbaren Hunger der Öffentlichkeit auf Enthüllungen und den damit einhergehenden Verlust jeglicher Privatsphäre; die erbarmungslose Priorität von PR-Strategien; oder den Box-Office-Erfolg – das Einspielergebnis an den Kinokassen – als das Maß aller Dinge. Insbesondere die 1954er „A Star Is Born“-Variante steckt zudem voller realer Tragik, wie sie sich keine Drehbuchabteilung hätte ausdenken können. Große Teile der Dialoge wurden unverändert dem Original von 1937 entnommen; aber die Tragiktiefe, welche die 1954er Version erreicht, ist durch das Schicksal der Judy Garland doch eine ganz und gar andere.
Deutlich düsterer wird es dann in „The Bad and the Beautiful“ (1952), der die unerhörte Skrupellosigkeit eines Filmproduzenten (gespielt vom späteren Produzenten Kirk Douglas) zeigt. Auf den Filmemacher blickt der Film aus drei unterschiedlichen Perspektiven: des Regisseurs, des Stars und des Drehbuchautors. Im selben Jahr erschien ein anderer (Hollywood-)Film über Hollywood, der in Optik und Stimmung wie ein Gegenstück zu „The Bad and the Beautiful“ anmutet: „Singin’ in the Rain“, das ultimative Hollywoodmusical. Er spielt in den späten 1920er Jahren und befasst sich – wie „The Artist“ (2011) – mit dem Aufkommen des Tonfilms als Herausforderung für Studios und Künstler:innen. Im Frühjahr 1928 triumphierte Warner Bros. mit „The Jazz Singer“ (1927) als erstes Studio, das Tonfilme drehte (mit dem „Vitaphone“-System). Als „The Jazz Singer“ zum Kassenkracher geriet, dämmerte – wie in „Singin’ in the Rain“ – selbst den störrischsten Technikskeptiker:innen, dass sich dieses neue Verfahren nicht mehr länger ignorieren ließ. An diesem Punkt steigt „Singin’ in the Rain“ ein: Beim Dreh eines Kostümstreifens wird gezeigt, wie die Techniker und der Regisseur mit der neuen Dimension des Tons hadern, indem sie erst mit der geeigneten Position für das Mikrofon experimentieren müssen und die Hauptdarstellerin ständig die geeignete Position vergisst, um eine brauchbare Aufnahme zu erzielen. Das bunte Technicolor-Spektakel sprüht vor Elan und Heiterkeit – die Strapazen, die mit dem perfektionistischen Dreh der furiosen Tänze verbunden waren, bleiben darunter völlig verborgen. Von der Transitionsphase mit dem Übergang vom Stumm- zum Tonfilm erzählt auch „It Happened in Hollywood“ (1937), dessen zwei Stars Richard Dix und Fay Wray diesen technologischen Gezeitenwechsel rund zehn Jahre zuvor selbst miterlebt hatten.
Welchen Größenwahn und unerhörten Reichtum die Stummfilmära in Hollywood gebar und was das unfreiwillige Karriereende aus den einstigen Stars machen konnte, hat wohl kein Film so kunstvoll und tragikomisch beschrieben wie Billy Wilders „Sunset Blvd.“ aus dem Jahr 1950. Der Film zeigt das Schicksal eines Ex-Stars, Norma Desmond, einer in Vergessenheit geratenen Schauspielerin, die von ihrer Rückkehr auf die Leinwand träumt und daran zerbricht. Dieser Aspekt der Ruhmsucht und des Bedeutungsverlustes durchströmt auch Robert Aldrichs „What Ever Happened to Baby Jane?“ (1964) – nicht nur durch die Story um zwei ungleiche Has-beens, sondern allein schon verkörpert von den beiden Hauptdarstellerinnen Joan Crawford und Bette Davis, die damals alle Studios bereits abgeschrieben hatten und denen gegen alle Erwartungen mit diesem Film ein phänomenales Comeback gelang. Apropos Bette Davis: Sie spielt die Protagonistin von „The Star“ (1952), eine einstmals erfolgreiche Darstellerin, deren Ressourcen versiegt und Reserven aufgebraucht sind. Der Film zeigt die Rückkehr zur Normalität als weitaus größeres Problem als die Star-Werdung.
Ein Vierteljahrhundert nach „Sunset Blvd.“ griff Wilder das Thema der Star-Pathologien erneut auf, in seinem vorletzten Film „Fedora“ (1978), diesmal allerdings aus einer Position, die unweigerlich an Norma Desmond erinnerte: eine einstmals gefeierte Hollywoodgröße, die niemand mehr engagieren will. Wilder war damals bekümmert, dass seine Filme im Hollywoodkino der Siebziger keinen Platz mehr hatten, dass er nach Europa gehen musste, um sich von steuersparenden Zahnärzten finanzieren zu lassen. Die Siebziger müssen für Wilder eine ungemein morbide Dekade gewesen sein, in der seine Art des Filmemachens – eine ganze Kultur und Philosophie – verblichen schien; und diese Verbitterung reflektiert letztlich „Fedora“.
Der Billy Wilder, der in den späten Siebzigern „Fedora“ drehte, war vor dem Hintergrund, dass sich Filme wie „Earthquake“, „The Towering Inferno“ (beide 1974) oder „Jaws“ (1975) an den Kinokassen als gigantische Hits erwiesen hatten, ein konsternierter Mensch, der nicht glauben konnte, dass audiovisuelle Effekte – eine Hai-Attrappe! – den gleichen Stellenwert haben konnten wie ausgefeilte Dialoge. Hatte Wilder 38 Jahre zuvor in „Sunset Blvd.“ (1950) die drastische Vergänglichkeit des Starruhms und die brachiale Verdrängung einer ganzen Schauspielgarde am Ende der Stummfilmära ergründet, lag sein Fokus in „Fedora“ auf dem paranoiden Schönheitswahn und Perfektionsstreben des Showgeschäfts – und wie diese ewige Pathologie der Unterhaltungsbranche eine ganze Kette von Schicksalen im Umfeld des Stars ruiniert. In keinem Film ist Hollywood so präsent, ohne eigentlich jemals wirklich gezeigt zu werden, wie in „Fedora“ – worin sich ausdrückt, dass Hollywood mehr mentaler Topos denn geografischer Ort ist.
Dass auch eine scheinbar intakte Star-Karriere nicht automatisch Glück zu bringen vermag, damit befassen sich „The Goddess“ (1958) und „Inside Daisy Clover“ (1965). „The Goddess“, mit Kim Stanley in der Hauptrolle als Rita Shawn, ist der ultimative Film über die Leere der Fülle, wenn der maximale Leinwanderfolg mit völliger Vereinsamung und Ziellosigkeit einhergeht und tief reichende Probleme lediglich verdeckt. Auf dem Weg einer jungen Frau zum Hollywoodruhm bleiben erst ihre Tochter, dann ihr zweiter Ehemann und schließlich sie selbst auf der Strecke. „Inside Daisy Clover“ handelt von einem Mädchen, das in den 1930er Jahren beim Aufbruch nach Hollywood sein Glück kaum fassen kann, später dann seinen Kopf in den Gasofen steckt, um sich umzubringen: von der frechen Autogrammfälscherin Daisy Clover, die dank eines Talentwettbewerbs selbst zum Star wird. Das Mädchen, das nach Hollywood geht und berühmt wird – es ist die Geschichte von Natalie Wood selbst, die Daisy Clover spielt.
Die autokratischen Studiobosse, die Daisy Clover ausbeuten und mit Norma Desmond, Fedora oder Rita Shawn Millionen scheffeln – die berüchtigten Hollywoodmoguln –, tauchen in fast allen Filmen auf, am stärksten jedoch in „The Last Tycoon“ (1976). Die Literaturverfilmung des unvollendeten letzten Romans von F. Scott Fitzgerald zeigt einen nur schwach kaschierten Irving Thalberg, das legendäre Wunderkind der US-amerikanischen Filmbranche in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren. Auf wenige Menschen der Hollywoodhistorie sind derart grandiose Elogen gehalten wurden wie auf Thalberg, „possibly one of the greatest geniuses ever in the picture business“ („The Wizard of Oz“-Produzent Mervyn Leroy 1974 zit. nach Stevens, Jr., George: Conversations with the Great Moviemaker’s of Hollywood’s Golden Age at the American Film Institute, New York 2006, S. 146.). Thalberg, so Howard Hawks, einer der bedeutendsten Regisseure aller Zeiten, habe „more brains than anybody else in the picture business“ gehabt (Howard Hawks zit. nach Lehman, Peter/Staff: Howard Hawks: A Private Interview (1976), in: Breivold, Scott (Hg.): Howard Hawks. Interviews, Jackson 2006, S. 159–192, hier S. 169). An der fiktiven und doch eben realen Figur des Monroe Stahr, gespielt von einem jungen Robert De Niro, werden Magie und Härte des Filmemachens in der Studio-Ära des Golden Age von Hollywood sichtbar. Der von Elia Kazan erdachte Schluss drückte indes weniger Monroe Stahrs als seinen eigenen, Kazans, Abgang am Ende des Films aus – „The Last Tycoon“ war Kazans letzte Regiearbeit, die letzte Szene des Films zugleich Kazans letzter Regiemoment.
Die Thalberg-Romantik wurde indes auch oft kontrastiert, vielleicht am stärksten in den beiden Aldrich-Filmen „The Big Knife“ (1955) und „The Legend of Lylah Clare“ (1968), die den Studioboss jeweils mit starken Anspielungen auf reale Persönlichkeiten als cholerischen, bisweilen psychopathischen Tyrannen zeigen. Darin reflektierte sich sicherlich auch Robert Aldrichs Meinung über die Studiodiktaturen. Noch etwas weiter ging Blake Edwards, der sich von Studiolenkern beinahe in den Tod getrieben fühlte und sich gleich mit zwei Filmen an Hollywood rächte: In „S.O.B.“ (1981) zeigt er den an reale Vorbilder angelehnten Studiochef in Strapse, in „Sunset“ (1988) – angesiedelt im Hollywood der späten Dreißiger – macht er den Studioboss sogar zum sadistischen Mörder.
Zu was sich Hollywood in den Jahrzehnten nach den großen Studiobossen, die in den 1960er Jahren quasi buchstäblich ausstarben, entwickelte, inszenierte Robert Altman 1992 in „The Player“ mit satirischer Schärfe. Die Yuppie-Produzenten scheinen hier nur noch auf den Box-Office-Appeal prominenter Namen zu achten – das taten die Cohns, Mayers und Warners des alten Hollywood natürlich auch, doch waren sie daneben von erstaunlicher Leidenschaft und bemerkenswertem Sendungsbewusstsein getrieben. Nachdem sie abgetreten waren und an ihrer statt nun Geschäftsleute mit meist kurzlebigen Karrieren an den Studiospitzen regierten – ein Hollywood, das „What Just Happened“ (2008) zeigt –, schuf Peter Bogdanovich mit „Nickelodeon“ (1976) eine Slapstickhommage, die sogar gleich in die Hollywood-Inkunabeln der 1910er Jahre abtauchte, als das Filmemachen so spontan und fluide war, dass man notfalls auf einer Straußenfarm drehte.
„Postcards from the Edge“ (1990) indes kreist um eine Showbusiness-Familie, in der die Kinder mitunter drohen, an der Prominenz der Eltern zugrunde zu gehen. Romanvorlage und Drehbuch stammen von Carrie Fisher, Tochter der berühmten „Singin’ in the Rain“-Aktrice Debbie Reynolds und des gleichfalls prominenten Entertainers Eddie Fisher, die 1977 mit „Star Wars“ selbst zum Star avancierte, ehe sie vollends in eine selbstzerstörerische Drogen- und Alkoholsucht abdriftete, die sie in dem Film mit seinen starken Wirklichkeitsbezügen verarbeitet. Eine andere Literaturadaption ist „The Day of the Locust“ (1975), die Verfilmung der über die Jahre zum Kultbuch gereiften Nathanael-West-Novelle gleichen Namens aus dem Jahr 1939, in der sich die Frustration der von Hollywood ausgeschlossenen und Blockierten am Ende in einem fürchterlichen Gewaltexzess entlädt und das Verträumte an der Traumfabrik – der Geist, in welchem die Protagonistinnen von „What Price Hollywood?“ oder „A Star Is Born“ einst voller Hoffnung in die Stadt kamen – jäh vergeht.
Natürlich gibt es noch weitaus mehr Filme über Hollywood. Doch fällt eine Totalerhebung ab einem gewissen Ausmaß schwer, woraus stets der Zwang zur pragmatischen Eingrenzung – und somit Auswahl – folgt. Die hier versammelten Texte konzentrieren sich daher auf Filme, die erstens ein breites Spektrum an Perspektiven auf Hollywood eröffnen und in denen sich zweitens oft auch die Zeit ihrer Entstehung widerspiegelt, weshalb sie in vielen Fällen gleich zu mehreren Epochen des Hollywood’schen Filmemachens etwas zu berichten haben.