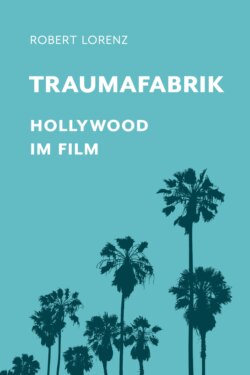Читать книгу Traumafabrik - Robert Lorenz - Страница 4
What Price Hollywood? (1932)
ОглавлениеMary Evans ist in die Stadt gekommen, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten noch ein paar Möglichkeiten mehr verspricht. Sie ist der Prototyp einer bestimmten Hollywoodspezies: der Aspirantin, der Star-Anwärterin ohne Anwartschaft. Es ist die Zeit, in der die Automobile vor dem Start noch angekurbelt werden müssen, in der Kinosäle etwas stärker als heute Portale zu anderen Welten sind. Das Aufkommen des Tonfilms liegt erst fünf Jahre zurück und auf dem Mount Lee schlängelt sich noch „Hollywoodland“ über den Hang. Evans (Constance Bennett) hat sich in einem kleinen Zimmer eingemietet und taktisch geschickt an einen der zentralen Umschlagplätze des Hollywoodbetriebs begeben; zwischen ihren ständigen Besuchen in den Casting-Büros kellnert sie in einer der angesagten Locations der Stadt, dem „Brown Derby“, das seinem Namen entsprechend die Form einer riesigen Melone hat und dessen Standort damals am Wilshire Boulevard lag. Dort verdient Evans nicht nur das Geld, um die Zeit bis zum Moment ihrer erhofften Entdeckung zu überbrücken, sondern sie kann dort genau darauf lauern: auf all die Produzenten und Regisseure, die sich an die Tische begeben, um Geschäftliches zu besprechen oder einfach nur um im ewigen Spiel des Sehens und Gesehen-Werdens mitzumischen. Das „Brown Derby“ ist eines von Hollywoods In-Restaurants, wo einen die Filmleute mit billigen Anmachsprüchen und profanen Tauschangeboten à la Körper gegen Karriere behelligen („Hello, sugar. Say, do you wanna go into pictures? There’s a great part for a girl like you.“). Zu Hause in ihrem kleinen Appartement übt sie vor dem Spiegel die Posen der Stars ein, die sie sich aus den Fanmagazinen abschaut. Mary Evans träumt den Traum, den Unzählige vor und nach ihr geträumt haben.
Aber hatte sich dieser Traum nicht schon für so viele erfüllt? Waren nicht fast alle Hollywoodstars mit ihren Villen, Pools und Limousinen aus einfachen, nicht selten ärmlichen Verhältnissen hervorgegangen? Insofern träumt Mary Evans wohl nicht zu Unrecht. Und ihre spätere Entdeckung durch eine glückliche Restaurantbegegnung ist denn auch – zumindest im Film – der Beweis für den Hollywoodmythos, dass sich zu träumen lohnt; und sie zeigt die Macht und Bedeutung des Zufalls in der Filmbranche.
Evans will also unbedingt entdeckt werden, hat sich mit ihren Hochglanzmagazinen auf die glamouröse Hollywoodwelt vorbereitet und tauscht eines Abends eilig mit einer Kollegin, damit sie den just hereinspazierten Regisseur bedienen – und hoffentlich beeindrucken – kann. Dieses berechnende Buhlen um die Aufmerksamkeit der Filmemacher mit fingierten Begegnungen in einem Restaurant, sich für einen kurzen, entscheidenden Moment zu zeigen und adrett zu posieren, das wird auch in einer Szene in „Variety Girl“ (1947) ausgebreitet, die sich in der 1929 eröffneten Hollywoodfiliale des „Brown Derby“ zuträgt: Darin fasst die Schauspielaspirantin Amber La Vonne (Olga San Juan) zwei Filmleute ins Auge, die gerade das Restaurant betreten haben, und lässt sich von der Rezeption aufrufen, dringend zum Telefon zu kommen (so wie dort tatsächlich damals Gäste bei Telefonanrufen ausgerufen wurden); zuvor passiert der Möchtegernstar La Vonne zuerst den Tisch der beiden Männer und spricht dann so laut in den Telefonhörer (in Wirklichkeit ist niemand dran), dass ihre Stimme zugleich vom Mikrofon der Rezeption erfasst und per Lautsprecher in den ganzen Saal übertragen wird – in ihrem Fake-Gespräch imitiert sie den Dialog des Drehbuchschreibers, der mit dem Regisseur am Tisch sitzt, den sie von sich begeistern will. In „A Star Is Born“ (1937), dem Quasi-Remake von „What Price Hollywood?“, versucht die Protagonistin Esther Blodgett (Janet Gaynor) auf einer Hollywoodparty, mit Mae-West- und Greta-Garbo-Imitationen die Filmschaffenden von ihrem Talent zu überzeugen. Auch Mary Evans übt sich in ihrer Wohnung in einer Imitation, in diesem Fall von Greta Garbo.
Ist Evans mit ihrer Aufstiegs- und Entdeckungsambition ein typisches Hollywoodgeschöpf, so ist es der Mann, den sie bedient, erst recht: der berühmte Regisseur Maximilian Carey, der am Premierenabend seines neuen Films reichlich beschwipst erst einmal an alle Gäste im „Brown Derby“ Gardenien in Wassergläsern verteilen lässt, die er großmütig einer alten Frau an der Straße abgekauft hat. Zur Premiere fährt er nicht mit seiner Limousine vor (in der hat er die Gardenienverkäuferin nach Hause chauffieren lassen), sondern in einer Rostlaube, deren überhitzter Kühler bei der Ankunft am roten Teppich dampft. Und an seiner Seite: Mary Evans. Ihre Schlagfertigkeit hat ihm gefallen, außerdem hatte er seine ursprüngliche Verabredung ohnehin schon versetzt. In dieser Nacht muss es noch feuchtfröhlich zugegangen sein, denn als Max Carey am nächsten Morgen durch das Telefonklingeln verkatert im Bett seiner Villa in den Hollywood Hills erwacht, kann er sich an nichts erinnern. Auf dem Sofa in seiner Bibliothek schläft allerdings eine Frau, die ihn zusammen mit dem Taxifahrer ins Haus geschleppt hat, wie ihm sein Butler berichtet, während sich Carey bereits neuen Alkohol einflößt. Evans erzählt ihm von seiner Jodeldarbietung – und dass sie ihren Job im „Brown Derby“ für ihn geschmissen habe. Sie will eine Chance und er verschafft ihr einen Screentest am Set seines aktuellen Filmprojekts.
Wie die Star-Aspirantin sich dann am Set als blutige Anfängerin erweist und ihren Screentest vermasselt, ist eine unterhaltsame Szene – selten ist Dilettantismus derart professionell gespielt worden wie hier von Constance Bennett (Bennett war von 1941 bis 1945 mit Gilbert Roland, dem „Gaucho“-Darsteller aus dem ebenfalls in diesem Buch besprochenen „The Bad and the Beautiful“ (1952), verheiratet). Bennetts Mary Evans gibt aber nicht auf und vermittelt dabei gleich noch eine weitere Hollywoodweisheit: Neben der Gnade des Zufalls bedarf es auch der Hartnäckigkeit und des Durchhaltevermögens, den Zufallsmoment abzuwarten und Rückschläge wegzustecken. So kommt Mary Evans jedenfalls doch noch zu ihrer Karriere – ein Siebenjahresvertrag wird ihr angeboten, wie es damals eben üblich war, um vielversprechende Talente möglichst risikofrei langfristig zu binden.
Nachdem Carey ihr zum Einstieg verholfen hat, ist Evans nun in den Händen des Studiobosses der Saxe Productions. Julius Saxe, gespielt von Gregory Ratoff, ist eine schillernde Figur, ein jovialer Autokrat und umtriebiger Filmemacher, mehr Mann der Tat denn kontemplierender Grübler. Als er ihren Namen hört, will er ihn sofort ändern lassen, nur um in seinem stürmischen Vorwärtsdrang dies sofort wieder zu vergessen und „seine“ Neuentdeckung sogleich den versammelten Abteilungsleitern mit den Worten vorzustellen: „I want you to meet our new star.“ Die Star-Werdung par ordre du mufti. Ohne neben dem Namen auch nur ein weiteres Detail ihrer Biografie und Lebensweise zu kennen, ordnet Saxe als Nächstes eine landesweite Werbekampagne an, um der ganzen Nation seinen neuen Star als „a typical American girl“ zu präsentieren – nein, noch besser: als „America’s pal“ (eine Anspielung auf Mary Pickfords Status als „America’s Sweetheart“). Und wie als Beweis für die wundersame Macht Hollywoods leuchtet kurz darauf tatsächlich Mary Evans’ Name von den Portalen der großen Kinos, das Insigne eines gültigen Star-Status – a star is born.
Als für einen ihrer Filme eine Partie auf dem Santa Barbara Polo Field gefilmt wird, trifft Evans auf den Polocrack Lonny Borden (Neil Hamilton) – es ist die Begegnung von West- und Ostküstenelite, von Homo novus und Patrizier, von neuem und altem Geldadel. Borden lädt Evans zum opulenten Luxusdinner mit Dienerschar und eigenem Orchester ein (genauer: Als sie ihn versetzt, fährt er zu ihrer Villa, bricht durch die Scheibe in ihr Schlafzimmer ein und verschleppt sie); anschließend schwelgen die beiden in Champagner und Kaviar.
Will man die filmhistorische Dimension von „What Price Hollywood?“ erfassen, fällt der Blick unweigerlich auf David O. Selznick, den Produzenten des Films. Wann immer jemand die Granden der „klassischen“ Hollywoodära aufzählt, ist fast immer auch Selznicks Name unter den Genannten. Selznick war „a big man of enormous energies and appetites, with a great capacity for work and life“ (Huston, John: An Open Book, New York 1994 [1980], S. 268), erinnerte sich der legendäre Regisseur John Huston; „extravagant in everything he did – or should I say magnificent?“ (Huston 1994, S. 269.) Auch in seiner ganzen Erscheinungsweise war Selznick eine imposante Figur: von großer Statur, „a giant panda of a man, standing about six feet two and permanently struggling with a weight problem“ (Niven, David: Bring on the Empty Horses. True Tails From the Golden Age of the Silver Screen, London 2006 [1975], S. 187), zudem Kettenraucher mit einer Vorliebe für trockene Martinis. Selznick galt als Schürzenjäger und empfing Leute, die er vielleicht unter Vertrag nehmen würde, im Frotteebademantel. Auf Partys schwang der extrem kurzsichtige Selznick im Martini-Rausch gerne mal gegen verschwommene Kontrahenten die Fäuste und ging meistens zu Boden.
Der New Yorker Selznick (1902–65) war mit Anfang zwanzig nach Hollywood gekommen, seine ganze Familie steckte tief im Filmbusiness – der Vater hatte ein eigenes Studio, für das der ältere Bruder Filme produzierte. Die Firma ging jedoch pleite und hinterließ einen vor Talent und Ambition strotzenden David O. Selznick, der nun in Los Angeles sein Glück versuchte. Im Herbst 1931 machte die kriselnde RKO – damals eines der größten Filmstudios – Selznick zu ihrem Produktionsleiter. Zwischenzeitlich hatte er sich als Schwiegersohn des MGM-Autokraten Louis B. Mayer in die Hollywoodaristokratie eingeheiratet. Selznick galt als derart begabt und erfolgreich, dass ihn sogar Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) von RKO zurückholte, obwohl Mayer mit den Selznicks eine uralte Fehde verband und er sich mit aller Macht gegen den Eheschluss zwischen seiner Tochter Irene und David O. Selznick gestemmt hatte.
Obzwar der Name Selznick für den Hollywoodmogul Mayer also ein rotes Tuch war und er sich fürchterlich über die Heiratsabsichten seiner jüngsten Tochter aufgeregt hatte, schien Selznick offenbar über ein solchermaßen herausragendes Filmgespür zu verfügen, dass selbst der große Louis B. Mayer ihm nicht widerstehen konnte. Selznick wiederum gelang nicht nur, als ungebetener Schwiegersohn in die MGM-Führungsspitze Einzug zu halten, sondern obendrein der spektakuläre Coup, MGM gegen den Willen Mayers nach kurzer Zeit wieder zu verlassen, um seine eigene Produktionsfirma zu gründen und dennoch den größten Star seines Ex-Arbeitgebers für ebendieses Vorhaben zu gewinnen: Selznick lieh sich von MGM dessen Superstar Clark Gable aus, um „Gone with the Wind“ (1939) zu drehen.
Selznick war nicht nur einer der fähigsten Filmemacher:innen, die jemals über die Studiogelände der Weltgeschichte wandelten, sondern auch eine der wichtigsten Gestalten in der Hollywoodcommunity. Die Sonntagnachmittage am Selznick-Pool in Beverly Hills gehörten zu den begehrtesten Freizeit-Events der Branche. Selznick-Partys waren die Orte, an denen sich Hollywood vernetzte, wo man sich kennenlernte, Freund- und Feindschaften schloss. Und auf anderen Zusammenkünften zählte Selznick zu den Hollywoodleuten, neben denen all diejenigen sitzen wollten, die gerade ihre Karriere in Gang setzen, wiederbeleben oder vorantreiben wollten. Die Anekdoten sind Legion: An Selznicks Tennisplatz waren an manchen Nachmittagen Marlene Dietrich, Claudette Colbert und Paulette Goddard gleichzeitig als Zuschauerinnen zugegen; John Huston und Errol Flynn lieferten sich nach einer Party vor Selznicks Haus eine epische Prügelei. Selznick besaß überdies ein nahezu untrügliches Gespür für Talent: Er holte Alfred Hitchcock in die USA, entdeckte Katharine Hepburn, bereitete Fred Astaires Einstieg ins Filmgeschäft vor und schickte einst eine Mitarbeiterin nach Schweden mit der Anweisung, bloß nicht ohne einen Vertrag mit einer gewissen Ingrid Bergman zurückzukehren. Sein kassenträchtiger Instinkt erstreckte sich auch auf Filme: Selznick hatte früh das Box-Office-Potenzial von „King Kong“ (1933) gewittert und dem Projekt weitere Gelder zugeführt, womit er den größten Hit in der RKO-Geschichte beförderte. Neben „Gone with the Wind“ stand er auch hinter „Duel in the Sun“ (1946) oder „Rebecca“ (1940).
Selznick war freilich nicht nur ein grandioser Filmemacher, sondern auch einer der Produzenten, die sich – zum Verdruss vieler Regisseure – gerne in die Filmprojekte einmischten, ein Kontrollfreak, der auch die Karrieren aller Schauspielerinnen und Schauspieler, die bei ihm unter Vertrag standen, nur allzu gern bestimmte. Seine Regisseure malträtierte der Produzent mit seitenlangen Memoranden, in denen er seine Vorstellungen und Anweisungen an den Set übermittelte. Billy Wilder hätte „es nie ausgehalten, einen Produzenten wie Selznick ständig als eine Art Aufseher“ (Billy Wilder zit. nach Karasek, Hellmuth: Billy Wilder. Eine Nahaufnahme, Hamburg 1992, S. 120) anwesend zu haben.
„What Price Hollywood?“ entstand 1932, in der kurzen Zeit also, in der Selznick zwischen Ende 1931 und Anfang 1933 den Filmausstoß von RKO kontrollierte, ehe er das Studio im Streit wieder verließ. Damals übernahm also „a very bright, spectacularly promising, youngish man“ (Olivier 2002, S. 95) die Geschicke von einem der „Big Five“, der fünf Major-Studios in Hollywood (neben RKO noch Paramount, MGM, Warner Bros. und Twentieth Century-Fox). „What Price Hollywood?“ war zwar ein Herzensprojekt des aufstrebenden Selznick, doch geschrieben hatte es im Kern die Journalistin und Drehbuchautorin Adela Rogers St. Johns. Ihre Geschichte „The Truth About Hollywood“ kaufte Selznick im Jahr 1932 und ließ sie von Jane Murfin dramaturgisch überarbeitet in ein Drehbuch fassen.
Die Entstehung des Films steht geradezu exemplarisch für die hektische Kreativität und den haarsträubenden Improvisationsdruck, unter denen in Hollywood bisweilen gearbeitet wurde. Weil der Star des Films, Constance Bennett, nur für relativ kurze Zeit dem Projekt zur Verfügung stand, ehe sie den nächsten Streifen zu drehen hatte, mussten sich alle mit dem Drehbuch befassten Köpfe beeilen. Weil Murfins Werk nach Meinung der Produzenten noch Witz und Esprit fehlten, wurden mehrere Skriptdoktor:innen darauf angesetzt, die teilweise noch am Abend vor dem jeweils nächsten Drehtag die benötigten Szenen schrieben. Einer von ihnen war Gene Fowler, einst New Yorker Reporterstar, der so schillernde Figuren wie die Westernlegende Buffalo Bill, den Schwergewichtschampion Jack Dempsey oder das dauerbetrunkene Schauspielgenie John Barrymore zu seinen Freunden zählte. Und letztlich – nicht unüblich – erschien „The Truth About Hollywood“ bekanntlich dann unter einem ganz anderen Titel (eine weitere Alternative lautete „Hollywood Merry-Go-Round“ und sollte zu vertrauter Jahrmarktsmusik die Figuren des Films auf einem großen Karussell zeigen, während im Hintergrund charakteristische Hollywoodschauplätze eingeblendet würden).
Laut der Filmhistorikerin J.E. Smyth sei es Selznick vor allem um den Blick auf eine gerade untergegangene Epoche gegangen. Obwohl Selznick bei der Entstehung von „What Price Hollywood?“ mit gerade einmal Anfang dreißig noch beinahe als pausbäckiger Hollywoodproduzent daherkam und Hollywood mit seiner überschaubaren Historie ja eigentlich selbst noch sehr jung war, waren sowohl Hollywood als auch Selznick mit dem Ende der Stummfilmära doch zweifellos bereits in einen neuen Geschichtsabschnitt eingetreten. Selznick hatte diese Transition nicht nur überstanden, sondern befand sich in schier unaufhaltsamem Aufstieg. Insofern gehörte er schon mit Ende zwanzig bereits zwei Zeitaltern der US-amerikanischen Filmgeschichte an. Und er hatte gerade den Tod unzähliger Karrieren miterlebt: Mary Pickford, Douglas Fairbanks oder Pola Negri gehörten urplötzlich der Vergangenheit an. Selbstmorde und Suchttode folgten. Selznick wollte die Leidtragenden des technischen Fortschritts und der üblichen Karrierekonjunkturen der im Talkie-Rausch drohenden Vergessenheit entreißen – und er wollte mit diesem Thema viel Geld verdienen, da er auf den Voyeurismus des Kinopublikums vertraute, sich Einblick in die geheimnisvolle Welt der Stars und Sternchen verschaffen zu wollen. Ein Film über Clara Bow sollte her.
Wie vielleicht keine Zweite verkörperte Bow (1905–65) den rasanten Aufstieg zum ultimativen Star und dessen ebenso abruptes Verschwinden. Bow, kurz nach der Jahrhundertwende in Brooklyn geboren, stammte aus einfachen Verhältnissen und einer fragilen Familie – die Mutter psychisch krank, der Vater ein häufig arbeitsloser Kellner, mithin eine Verrückte und ein Taugenichts als Elternpaar –; schon früh träumte sie von einem Leben als Filmstar, gewann einen Talentwettbewerb in einem Fanmagazin, der ihre Entdeckung beförderte, und zu Beginn der Roaring Twenties nahm ihre Hollywoodkarriere dann tatsächlich Fahrt auf. Privat hatte Bow zahllose Probleme, oft schlechte Presse (Affären und Glücksspiel, Rauschgift und Alkohol). Viele in Hollywood waren promiskuitiv, alkohol- und/oder drogenabhängig – aber meist in der Lage, ihre Abstürze vor der Öffentlichkeit geheim zu halten; Clara Bow war nicht einmal gewillt, es auch nur zu versuchen. Als die 1930er Jahre mit der Wirtschaftskrise hereinbrachen, da schienen emanzipierte Frauenfiguren aus den wilden Zwanzigern mit der sexuellen Aura einer Clara Bow – dem „It Girl“ – nicht mehr gefragt; insbesondere, wenn sie sich wie Bow ihrer gewaltigen Star-Macht bewusst waren und sich nicht mehr so leicht wie früher vom Studio kontrollieren ließen, zumal andauernd von der Presse verrissen wurden. Wann immer Menschen Hollywood für einen Sündenpfuhl hielten, schien Bow die Bestätigung zu sein. Weil Paramount sie aber nicht feuern konnte, ließ man sie einfach so lange allein, bis sie sich emotional ausgebrannt von selbst aus dem gehässigen Gewerbe zurückzog.
Selznick indes, der Clara Bow aus gemeinsamen Paramount-Tagen kannte, war vermutlich nie ein Unterstützer der Anti-Clara-Bow-Front gewesen und hätte ihren Star-Appeal ungeachtet moralischer Bedenken am liebsten weiter in Kinokassenerfolge umgemünzt. Und so telegrafierte er im März 1932 an das New Yorker RKO-Büro euphorisch: „Suggest sensational comeback for Clara Bow in a Hollywood Picture titled ‚The Truth About Hollywood.‘“ (Telegramm von Selznick an RKO vom 04.03.1932, zit. nach Behlmer 2000, S. 47.) Damit wollte Selznick nicht nur den nach wie vor großen Namen Clara Bow zurück auf die Kinoleinwand bringen; darüber hinaus wollte Selznick RKO auf dem in seinen Augen profitablen Feld der Hollywoodfilme aufstellen, das schließlich „What Price Hollywood?“ bestellen sollte.
Allerdings strebte Selznick nicht nur nach einem Film über und mit Clara Bow. Der Blick auf die Branche war ihm ein persönliches Anliegen. Denn auch Selznicks Vater zählte zu den Opfern der Vergangenheit. L.J. Selznick, 1870 im russischen Zarenreich geboren und 1888 in die USA emigriert, gehörte zu den allerersten Filmproduzenten. Mit etwas mehr Glück wäre er von New York aus in die Riege der Warners, Mayers und Zukors aufgestiegen; aber stattdessen hatte er Schulden angehäuft und verpasst, wie die großen Studios eigene Kinoketten und Distributionskanäle aufzubauen. Auch hatte er kein Geld für Stars – in einer Zeit, in der beim wachsenden Publikum kein Film ohne die Mitwirkung populärer Gesichter mehr eine Chance zu haben schien. Ende 1922 war der alte Selznick als Filmproduzent jedenfalls gescheitert und keiner der großen Moguln geworden. Im Februar 1923 war die New Yorker Selznick Pictures Corporation mitsamt ihrem Büro in Los Angeles erledigt; ihr Bankrott und das Schicksal seines Vaters hatten den damals Anfang zwanzigjährigen Selznick für immer geprägt. Durch Bow und den alten Selznick wusste er, was ein Scheitern in der Filmbranche mit den Menschen machen konnte.
„What Price Hollywood?“ hat nicht die Schonungslosigkeit und den Zynismus eines New Hollywood-Films. Aber gerade weil er nicht im Fahrwasser einer bestimmten Bewegung entstand, ist er so besonders. Selznicks Projekt zeigt, wie Prominenz und PR-Verpflichtungen das Privatleben der Stars zerrütten und kaputtmachen konnten. Er zeigt das glamouröse Star-Leben als zwiespältige Angelegenheit, als Quell privaten Unglücks und entzaubert die Hochglanzbilder von Gable, Garbo & Co. Faszinierend sind vor allem die Wirklichkeitsbezüge des Films.
Das betrifft zunächst die Einblicke in das Filmemachen, das Arkanum der Hollywoodstudios, in die Normalsterbliche damals ja nie gelangten. „What Price Hollywood?“ bediente die mutmaßliche Neugier seines damaligen Publikums, indem er etwas über das Mysterium des Filmemachens und dessen technische Komplexität preisgab. Eine kurze Sequenz veranschaulicht das geschäftige Treiben in den Straßen zwischen den Soundstages auf dem Studiogelände. Kameramann und Tontechniker werden an ihren Arbeitsgeräten gezeigt, man sieht die immensen Scheinwerfer am Rande des Sets, beim Dreh dann die auf einem fahrbaren Gestell mitsamt Kinematografen und Regisseur drapierte Kamera, wie sie sich auf den Star zubewegt. Geheimnisse und Tricks hinter allbekannten Leinwandeffekten werden enthüllt – etwa die Schläuche, mit denen Regen mehr oder weniger glaubhaft simuliert wird; oder das Mikrofon, das neuerdings über dem Set schwebt.
Routinen werden gezeigt: Nach dem „Cut!“ beschließt der Regisseur den Tag – „That’s all for today!“ Im „Projection Room No 1“ („No Admittance“) flackert gerade zur Beurteilung ein Historienepos mit einer Schießerei über die Leinwand; die Konstellation: der Studiochef Saxe mit seiner Sekretärin in der mittleren Reihe, in der vorderen ein aufmerksamer Mitarbeiter, in der hinteren sieht man lediglich die weißen Schuhe eines offenbar eingeschlafenen Teilnehmers, der sich kurz darauf als Mary Evans’ Fürsprecher Max Carey entpuppt. Am Sitz des Studiobosses steht ein Telefon bereit, über das mit dem Vorführraum kommuniziert werden kann. Auch allerhand Floskeln und Jargon kommen vor, etwa wenn Regisseur Carey vom Studioboss Saxe gescholten wird: „All the time retakes, all the time over schedule.“ Hier und da wird auf die Wichtigtuer-Rituale der umtriebigen Hollywoodleute verwiesen, die sich im Restaurant ständig einen Telefonapparat an den Tisch bringen lassen – eine Prahlerei und Statusvergewisserung, die sich in Hollywoodfilmen über Hollywood bis zu Robert Altmans „The Player“ (1992) durchzieht.
Auch fängt „What Price Hollywood?“ ein wenig vom Zeitkolorit der Hollywoodkolonie in den frühen 1930er Jahren ein – mit den fürstlichen Villen, extravaganten Einrichtungen und unzähligen Anzeichen unermesslichen Reichtums. Wie Saxe, Evans, Carey und andere zur Besprechung eines Filmprojekts am Pool sitzen, mit Hollywoodschaukel und Gummitier, ist von heute aus betrachtet kaum mehr als extraordinärer Lebensstil erkennbar – aber damals muss dies auf die Menschen im Heartland oder den Großstädten wie eine weit entfernte Galaxie gewirkt haben. Das alte Hollywood zeigt sich gleich zu Beginn: Ein Film hat Premiere im „Grauman’s Chinese“ (ein geradezu obligatorischer Fixpunkt in Filmen über Hollywood); am Rande des roten Teppichs drängeln sich die Menschenmengen, während schrittweise, wie an einem Fließband, die Limousinen vorfahren und immer neue Prominenz entladen. Die Reporter:innen fangen mit ihren Mikrofonständern die O-Töne der Stars und großen Filmemacher ein, während sie mit ihren Begeisterungsstürmen und ihrem Star-Enthusiasmus tatkräftig am Mythos Hollywood mitwirken.
Die Realitätsnähe von „What Price Hollywood?“ nimmt – und darin liegt die eigentliche Kraft und Aura dieses Films – allerdings noch eine tragische, drastische Dimension an. Und das liegt vor allem an der Besetzung, konnten sich die zentralen Performances doch aus persönlichen Erfahrungen speisen. Da ist zuallererst Gregory Ratoff, der wie Julius Saxe aus Osteuropa stammt und dies mit seinem heftigen Akzent auch gar nicht erst zu verbergen versucht (in einer Szene bittet Saxe jemanden, etwas in das „microscope“ zu sagen). Saxe ist angeblich eine Samuel-Goldwyn-Persiflage, in seinem unberechenbaren Patriarchalismus aber sicherlich auch eine Anspielung auf Louis B. Mayer, den gebürtigen Minsker und MGM-Boss, der mal wohlwollend, mal tyrannenhaft in das Leben seiner Stars eingriff. „Gregory Ratoff“, schrieb damals das Branchenblatt Variety, „is closer to some film producers in his portrayal than the average audience will realize“ (O.V.: What Price Hollywood?, in: Variety, 01.01.1932).
Und schließlich auch die Protagonistin, gespielt von Constance Bennett. Sie übernimmt hier eine ihr nur allzu bekannte Rolle: die des Hollywoodstars. Selznicks Coup, Clara Bow zu engagieren, war nicht aufgegangen. Also griff er auf den größten Star zurück, den RKO gerade unter Vertrag hatte, eben Bennett. Bennett war damals die bestbezahlte Schauspieler:innen der Welt, erst kürzlich zu RKO gestoßen (durch die Sechs-Millionen-Dollar-Übernahme von Pathé, wo Bennett unter Vertrag stand), so wie David O. Selznick, der ebenfalls just zu RKO als Studioleiter geholt worden war. (Als eine seiner ersten Amtshandlungen hatte Selznick zudem seinen hochgeschätzten Freund George Cukor von Paramount zu RKO geholt, den er nun mit der Regie betraute.) Bennett hatte, wie Clara Bow, ihre Karriere im Stummfilm begonnen und gehörte zu den ersten Talkie-Stars. 1925 hatte sie, wie ihre Filmfigur Mary Evans mit Lonny Borden, mit Philip Plant selbst einen reichen Ostküstendynasten geehelicht; und wieder wie im Film hatte sie nach der Trennung von Plant Angst, ihr Ex könnte das Sorgerecht für ihren Sohn beanspruchen, weshalb sie das Kind vor der Öffentlichkeit versteckte. Auch wenn Bennetts privates Schicksal erstaunlich nah an ihrem Leinwandcharakter war und Selznick doch eher an Clara Bow dachte, so hatte Rogers St. Johns ihre Geschichte an den Stummfilmstar Colleen Moore (1899–1988) angelehnt. Moore gehörte zu den größten Stars der Zwanziger, prägte den Flapper-Stil mit seinem Kurzhaarschnitt und der jungenhafteren Kleidung. Zwischen 1923 und 1930 war Moore mit dem Filmproduzenten John McCormick (1893–1961) verheiratet, dessen Karriere parallel zu ihrem Aufstieg unter seinen heftigen Alkoholproblemen zugrunde ging.
Das eigentliche Glanzstück des Films ist indes die Besetzung des versoffenen Regisseurs mit Lowell Sherman (1888–1934) – einem versoffenen Regisseur. Sherman war ein arbeitswütiger Tausendsassa, der von Kindesbeinen an auf der Bühne gestanden und schließlich am Broadway gespielt hatte, ehe er im Stummfilm zu einem der allerersten Hollywoodstars avancierte. Sherman gehörte 1921 zu den Gästen der berüchtigten Party, die Roscoe „Fatty“ Arbuckle, einen der damals erfolgreichsten und bestbezahlten Schauspieler der Welt, wegen eines Vergewaltigungs- und Todesfalls die Karriere kostete (obwohl Arbuckle später freigesprochen wurde). Allein in den Zwanzigern spielte Sherman in mehr als dreißig Filmen mit, ein Dutzend Rollen folgten zwischen 1930 und 1932; von 1928 bis 1935 hatte er bei 15 Filmprojekten Regie geführt, ehe er 1935 im Alter von 46 Jahren verstarb. Als Regisseur kannte er also die beruflichen und auch die meisten übrigen Aspekte seiner Figur des Max Carey in- und auswendig.
Die Figur des Max Carey ist angeblich nach Colleen Moores Partner John McCormick geformt worden – dem triumphalen Produzenten, der plötzlich im Alkohol versank, während seine Frau zum Star avancierte. Doch viele erkannten darin auch den Bühnen- und Leinwandstar John Barrymore und sahen die Vergeudung großer Begabung unter dem Druck ebendieser Begabung veranschaulicht. Barrymores Trinksprüche mit ihrem heiteren Fatalismus klangen wie die des Max Carey – etwa die Carey-Sentenz, demnach die Ehe eines Filmstars genauso lange halte wie Careys Leber. Zumal: Sherman kannte Barrymore, war sogar mit ihm verschwägert, und hatte sich für seine Carey-Darstellung einige Barrymore-Momente geliehen; und viele der Dialoge von „What Price Hollywood?“ entstammten der Schreibmaschine des Barrymore-Kumpels Gene Fowler. Aber auch Marshall Neilan (1891–1958) – ein vom Alkoholismus gezeichneter Stummfilmregisseur und Produzent, der als D.W. Griffiths Chauffeur begonnen, später etliche Kassenschlager gedreht und zwei Schauspielerinnen geheiratet hatte – scheint eine Carey-Blaupause gewesen zu sein.
Carey steht für all jene Schauspieler:innen und Regisseur:innen, die trotz oder wegen ihres Talents und ihres Scharfsinns sich mit Alkohol und Drogen zugrunde richteten. Noch im ersten Teil des Films sitzt im studioeigenen Vorführraum ein nüchterner Carey, dem sein Boss wegen der andauernden Saufeskapaden ins Gewissen redet: „Five years ago you were ten years ahead of the business and now you’re not quite even with it. And what’s the answer? Whiskey!“ Gleich Careys erster Auftritt im „Brown Derby“ erfolgt in hochaktiver Trunkenheit – aber im Unterschied zu allen anderen Darstellungen jener Zeit wird Carey nicht als lächerlicher Trunkenbold gezeigt, sondern als tiefgründige Figur. Carey ist keine Hollywood’sche Comic Relief-Schnapsdrossel, sondern steht für die düstere Seite Hollywoods, hinter der Glamourfassade. Als ihm zum Frühstück ein Whiskey serviert wird, mag das noch komisch sein; als er am Ende eines mehrtägigen Sauftrips verlottert im Knast landet, um voller Scham seinem einstigen Protegé Mary Evans gegenüberzutreten, die ihm nun als Retterin begegnet, liegt darin schon nichts Komödiantisches mehr. Als er dann ein Scherbengericht über sich hält, ist die Tragik des Max Carey – einst einer von Hollywoods schöpferischsten Regisseuren – schon kaum mehr auszuhalten:
„You mustn’t be unhappy over a man who doesn’t exist anymore. I’m not the Max Carey you once knew. All burnt out, Mary. Don’t you see I’m dead inside? […] I’m washed up in pictures, done for. I haven’t got it anymore.“
Und dann folgt eine Sequenz, die „What Price Hollywood?“ für sich allein genommen zu einem der interessantesten Hollywoodfilme überhaupt macht.
Nachdem Evans ihren Mentor Carey aus dem Gefängnis ausgelöst hat, glaubt sie, mit ihm die Vereinbarung getroffen zu haben, dass er fortan nüchtern bleibt. „All right. From tonight on I won’t cause you anymore trouble“, sagt er daraufhin. Als sie zur Tür schreitet, ruft er sie noch einmal: „Yes, darling?“ – „I just wanted to hear you speak again, that’s all.“ Als sie das Zimmer verlassen und die Tür geschlossen hat, fasst er sich voll innerem Schmerz ins Gesicht (so wie 22 Jahre später James Mason in „A Star Is Born“). Carey entsteigt dem Bett und als er den Raum verlassen hat, liegen die Schatten der Fensterrahmen über ihm wie die Gitterstäbe einer Gefängniszelle oder eines Käfigs. Auf der Suche nach einem Feuerzeug findet er in einer Schreibtischschublade eine Pistole, schließt die Schublade aber wieder. Als er kurz darauf ein gerahmtes Porträt seiner selbst – adrett und selbstbewusst – und im Spiegel darüber sein aktuelles Selbst mit der Suff-Visage sieht, gedeiht in seinem Gesicht das Entsetzen über seinen Niedergang – Cukor unterlegt diese Szene mit einem klaustrophobischen Surren –; daraufhin kehrt Carey zur Schublade zurück, nimmt die Waffe und erschießt sich. Im Unterschied zu den „A Star Is Born“-Epigonen sieht man hier den Suizid, sieht man die Leiche.
Das ist zugleich der Punkt im Film, an dem sich die hässliche Fratze des Starrummels offenbart: Die ominösen Umstände von Careys Tod im Haus der mittlerweile geschiedenen Evans, die einst Careys Schützling war und stets im Verdacht einer Affäre mit ihrem Förderer stand, werden jetzt von der Presse brutal ausgebeutet. Paparazzi belagern ihr Anwesen, Kinos zeigen ihre Filme nicht mehr, die Abgesandte des Fanmagazins beschimpft sie von der Haustür aus. „You are a motion picture star, you belong to the public – they make you and they brake you“, erklärt ihr Chef. Schon zuvor hatte ihr Ehemann Lonny geklagt: „No privacy, no home life“; zwei Szenen später, als ein sturzbetrunkener Carey in ihrem Schlafzimmer steht, ruft Lonny: „I’m going as far away from Hollywood and all its inmates as I can get.“ Hollywood ist für ihn – den Alien – „a world where people are cheap and vulgar without knowing it“.
Das Private am Privatleben gilt in der Hollywoodwelt ja in der Tat nicht viel. Und so zeigt es auch schon „What Price Hollywood?“. In einer Szene will die „awfully important“ Frau vom Fanmagazin (Josephine Whittell) ein Interview über das Liebesleben von Mary Evans führen, das sie gerade in dem Augenblick stört, als sich Mary und Lonny vergnügt auf dem Bett wälzen. Auch die Hochzeit der beiden Promis verkommt zum reinen PR-Stunt: „Little church nothing!“, ruft Saxe, als er von den Heiratsabsichten seines Stars erfährt. „The biggest church in Beverly Hills“ verlangt der Studioboss. „An outstanding wedding, it must be great!“, weist Saxe die Abteilungsleitungen seines Studios an. Aus der Hochzeit macht Saxe in der riesigen Hollywood United Methodist Church, am Fuße der Hollywood Heights gelegen, eine gigantische Marketingaktion, die jegliche Privatsphäre auflöst.
Vor laufender Kamera tritt das Brautpaar vor die am Kirchenausgang versammelte Masse, umringt von Reportern, mühselig beschützt von heillos überforderten Polizisten. Als sich das Brautpaar seinen Weg bahnen will, grapschen promigierige Hände nach dem Schopf der Braut und reißen an deren Schleier und Kleid, sodass sich die Hochzeitsgesellschaft zurück in die Kirche flüchten muss. Saxe triumphiert wie bei einem gelungenen Filmstart: „We broke all the house records for this church! It was terrific!“, ehe er dem sowieso schon völlig entnervten Brautpaar mitteilt, dass sich die Flitterwochen wegen eines Nachdrehs zu Evans’ neuem Film zu verschieben hätten („Darling, release dates are not waiting for honeymoons.“).
Obwohl die verblüffende Nähe von Bennett und Sherman zu ihren Filmfiguren fast das Niveau von Judy Garland als Esther Blodgett in „A Star Is Born“ (1954) oder Gloria Swanson und Erich v. Stroheim in „Sunset Blvd.“ (1950) erreichte, ragte „What Price Hollywood?“ der reinen Hollywoodformalität nach jedoch kaum aus der Mittelmäßigkeit heraus. Adela Rogers St. Johns und Jane Murfin waren bei den 1932er Academy Awards für das Beste Originaldrehbuch nominiert. Ansonsten musste der Film als Box-Office-Niederlage verbucht werden, da er unter Berücksichtigung von Vertrieb und Marketing kaum das Geld einspielte, das RKO für ihn ausgegeben hatte. Auch dass in ihm durchaus feministisch progressiv die Frau als andauernde Retterin des kaputten Mannes fungiert und sich als Alleinerziehende mit Karriere behauptet, verschaffte ihm später nicht die Beachtung, die man diesem vergessenen Werk inzwischen schenken sollte.
Die nachhaltigste Wirkung, die von „What Price Hollywood?“ ausging, war indes eine ganz andere: Der Film machte Selznick im Nachhinein zum Initiator des Quasi-Franchise von „A Star Is Born“, einer regelmäßigen Selbstreflexion der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Nur fünf Jahre später begann diese Serie – abermals mit David O. Selznick im Zentrum des Geschehens.1