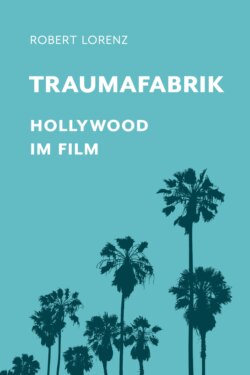Читать книгу Traumafabrik - Robert Lorenz - Страница 7
Sunset Blvd. (1950)
ОглавлениеBoulevard der Dämmerung
Ein Leichnam wird in den fensterlosen Raum geschoben, an den Wänden sind wie in einem Parkhaus bereits ein Dutzend andere Verstorbene abgestellt. Weiße Tücher bedecken sie, um den großen Zeh ein Etikett gehängt, die Zusammensetzung ein Spiegel der Gesellschaft – Kinder und Alte, Weiße und Schwarze. Das Licht geht aus, aber plötzlich scheinen die Toten halbtransparent unter den Abdeckungen hervor. Jemand beginnt zu reden und mit einem Mal tauschen sich die Verstorbenen in der Leichenhalle von Los Angeles über ihre Todesursachen aus. Einer von ihnen ist Joe Gillis, ein Drehbuchschreiber, offensichtlich deutlich vor seiner Zeit verblichen, da ihn der damals Anfang dreißigjährige William Holden verkörpert. Gillis’ Geschichte beginnt damit, wie er den Sunset Boulevard hinabfährt.
Das ist das Intro von „Sunset Blvd.“, das es gar nicht gegeben hat. Denn das Testpublikum zweier Previews brach dabei jedes Mal in schallendes Gelächter aus, was dem im Kern finsteren Drama eine völlig andere Richtung gab; viele hielten das spätere Meisterwerk am Ende für totalen Quatsch – Billy Wilder, der Regisseur und Co-Autor des Films, war am Boden zerstört. So änderte er den Anfang und ließ William Holden per Voiceover aus dem Off – in diesem Fall sogar dem Jenseits – sprechen, während die Leiche seiner Filmfigur in einem Pool treibt und von Polizisten aus dem Wasser gefischt wird. Die Anfangsszene mit der Leiche im Pool geriet dann schnell zum markanten Merkmal des Films und gilt längst als dramaturgischer Coup. An ihr lässt sich auch die Bedeutung der ersten Szene ermessen – denn hier lachte keiner mehr.
Dieses alternative Intro von „Sunset Blvd.“ ist inzwischen legendär: Mit bedrohlichen Orchesterklängen schwenkt die Kamera langsam herab auf einen Bordstein, auf dem in weißer Schrift mit fetten Lettern „Sunset Blvd.“ geschrieben steht. Dann schwebt sie, völlig ohne Schnitt, über den Asphalt, während der Cast eingeblendet wird; sie schwebt rückwärts, als würde man einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit vollführen. Als sie dann wieder aufblickt, erstreckt sich eine Straße, an deren Horizont sich gleißende Scheinwerfer abzeichnen; dann Sirenengeheul, eine Polizeikolonne rast um fünf Uhr morgens den Sunset Boulevard in Los Angeles hinab. Aus dem Off spricht die Stimme eines Mannes; er erzählt von seiner eigenen Ermordung, während die Leiche ebenjenes Mannes im Pool einer Villa treibt (eine raffinierte Einstellung, für die Wilder viel Aufwand betreiben ließ). William Holden, bald darauf eines der berühmtesten Filmgesichter der Fünfziger, später aber auch von den tragischen Gesichtszügen eines schweren Alkoholikers gezeichnet, spricht und spielt diese Figur: Joe Gillis, einen von vielen hundert Drehbuchschreiber:innen, die in L.A. ihr Glück (ver-)suchen.
Es gibt Filme, die sind so klug, so wunderbar, so zeitlos, dass man sich noch lange nach dem Abspann daran erfreut. „Sunset Blvd.“ ist so ein Film: Billy Wilder (1906–2002), der schon bald in den Status eines der größten Regisseure aller Zeiten aufrücken würde, am Ende seiner Karriere ein sechsfacher Oscarpreisträger und unbestrittene Hollywoodinstanz, inszenierte diesen Film mit messerscharfem Zynismus gegenüber dem überdrehten Star-System der Traumfabrik mit ihren ambivalenten Mechanismen, die gleichermaßen schöpferisch wie zerstörerisch wirken. „Sunset Blvd.“, der vom (ultimativen) Ende aus erzählte Film, beschreibt Gillis’ Untergang, wie drei Kugeln in ihn gerieten und seinen toten Körper in den Pool schmetterten.
„Sunset Blvd.“, der vom (ultimativen) Ende aus erzählte Film, beschreibt Gillis’ Untergang, wie drei Kugeln in ihn gerieten und seinen toten Körper in den Pool schmetterten. Schon einmal hatte Wilder einen Film mit der Voiceover-Rückblende aufgebaut, doch ist im ausgekochten Film noir „Double Indemnity“ (1944) der Versicherungsvertreter Walter Neff (Fred MacMurray), wenn auch angeschossen, noch am Leben, als er mit seiner Erzählung beginnt. Und Jahrzehnte später würde Wilder sie bei einer weiteren Begegnung mit den Abgründen der Filmwelt, in „Fedora“ (1978), wiederholen (abermals mit William Holden als Off-Erzähler). In „Sunset Blvd.“ umfasst die Rückblende ein halbes Jahr. Joe Gillis sitzt in einer der oberen Etagen des „Alto Nido“-Appartementhauses im nördlichen Teil der Ivar Avenue, einem Bau im kalifornisch-spanischen Eklektizismus. Billy Wilder und seine beiden Co-Autoren Charles Brackett und D.M. Marshman Jr. haben Gillis als typische Hollywoodexistenz angelegt und nutzen „Sunset Blvd.“, um darin sporadisch das Mysterium des beim fertigen Film stets unsichtbaren Drehbuchschreibers zu konturieren, einer dem Publikum tendenziell eher unbekannten Figur (an einer Stelle lassen Brackett, Marshman Jr. und Wilder ihren Protagonisten sagen: „Audiences don’t know somebody sits down and writes a picture. They think the actors make it up as they go along.“).
Gillis ist ein Journalist aus Ohio, der wie viele andere Presseleute in die große Filmstadt gekommen ist („Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit.“), aber bloß auf der Stelle tritt. Sein Leben besteht aus dem unablässigen Schreiben von Geschichten, „that may sell and very possible will not“. Seit geraumer Zeit ist er keines seiner Skripte mehr an ein Studio losgeworden und nun sitzen ihm Geldeintreiber (Larry J. Blake und Charles Dayton) im Nacken, die sein Plymouth Cabriolet abschleppen wollen – seit Monaten ist Gillis mit den Raten im Rückstand. Sein wohlsituierter Agent (Lloyd Gough), den Gillis auf dem Golfplatz anpumpt, will ihm kein Geld leihen, da doch die besten Stoffe mit leerem Magen entständen; dabei rekurriert er auf die teuren Sündentempel und Genussstätten der Reichen und Schönen: „Once a talent like yours gets into that Mocambo-Romanoff rut, you’re through.“
Bei Paramount – für das Wilder „Sunset Blvd.“ drehte – gewährt einer der Produzenten (Fred Clark) – „a smart producer, with a set of ulcers to prove it“ – Gillis schließlich einen Fünf-Minuten-Pitch. Als die Frau aus der Drehbuchabteilung, Betty Schaefer (Nancy Olson), sein Skript für schlecht befindet, belächelt Gillis sie als eines dieser „message kids“, denen eine Handlung allein nicht genüge.
Auch Betty Schaefer dient neben Gillis als Repräsentantin der Heerscharen in den Drehbuchabteilungen der Studios. Gillis: „She was so like all of us writers when we first hit Hollywood, itching with ambition, planning to get your names up there. ‚Screenplay by‘, ‚Original Story by.‘“ Die 22-jährige Skriptleserin bei Paramount ist quasi im Studio aufgewachsen, wo ihre Eltern gearbeitet haben, der Vater als Elektriker, die Mutter in der Garderobe. Zehn Jahre lang nahm sie Schauspiel-, Sprech- und Tanzunterricht, und als dann bei ihrem Screentest die Nase nicht gefiel, da ließ sie sich für 300 Dollar operieren – aber genommen hat man sie trotzdem nicht.
Betty Schaefer verkörpert damit die kleine Hollywoodexistenz zu Karrierebeginn, als sie sich noch die Miete mit einer Zimmernachbarin teilt und voller Elan an ihrem beruflichen Fortkommen arbeitet. Angeblich hat sie Wilder an seine zweite Ehefrau Audrey angelehnt, deren Mutter in der Columbia-Schneiderei gearbeitet hatte und deren Vater Setbauer war, weshalb sie von Kindesbeinen an den Studiobetrieb verinnerlichte und später unbedingt in der Filmbranche arbeiten wollte (ihr gelangen am Ende einige kleine Auftritte).
Neben der Prekarität des Drehbuchschreibens zeigen Brackett, Marshman Jr. und Wilder auch einen der zentralen Lebensräume dieser Hollywoodspezies: „Schwab’s Pharmacy“ am Sunset Boulevard, eine Art Apotheke mit Tabakladen und Bistro, von den zahllosen Drehbuchleuten, die dort Zuflucht suchten, liebevoll „headquarters“ genannt, ein Ort voller Legenden: Der „The Great Gatsby“-Autor F. Scott Fitzgerald erlitt dort einen Herzinfarkt, Harold Arlen schrieb darin auf einer Serviette die Melodie für „Over the Rainbow“ und Lana Turner sei dort beim Genuss einer Limonade entdeckt worden (was gar nicht stimmte, aber die Legendenkraft des Geschäfts beweist). Und sie zeigen die Machtlosigkeit der Autor:innen über das eigene Material, sobald es erst einmal in Studiohänden ist und die Dreharbeiten beginnen (oder wie der Regisseur John Huston einmal sagte: „when the picture went on the floor, that was the end of the writer“ [John Huston zit. nach Ford, Dan: A Talk with John Huston (1972), in: Long, Robert Emmet (Hg.): John Huston: Interviews, Jackson 2001, S. 21–29, hier S. 26]). An einer Stelle sagt Gillis über seine Arbeit: „Last one I wrote was about Okies in the Dust Bowl. You’d never know it, because when it reached the screen, the whole thing played on a torpedo boat.“ In dieser Überspitzung steckt viel von Wilders eigenem Verdruss ob des Kontrollverlustes über sein Werk, der den Drehbuchautor einst von der Schreibstube auf den Regiestuhl trieb, in der Absicht (und Hoffnung), nun selbst für die originalgetreue Umsetzung seiner Skripte sorgen zu können.
Als ihm dann endgültig sein Geld ausgeht und Gillis über eine Rückkehr nach Ohio, an seinen alten Schreibtisch bei der Dayton Evening Post, nachdenkt, erwischen ihn die Inkassoleute an einer Straßenkreuzung und setzen zur Verfolgung an. Während seiner Fluchtfahrt auf dem Sunset Boulevard platzt Gillis ein Reifen und er biegt flugs in die nächste Einfahrt ein, seine ahnungslosen Verfolger rauschen an ihm vorbei. Am Ende der Auffahrt des fremden Grundstücks steht ein Garagengebäude mit mehreren Stellplätzen, in dem Gillis sein Fahrzeug versteckt. Wie ein entflohener Häftling tastet er sich voran, als beträte er eine andere Wirklichkeit. „It was a great big white elephant of a place. The kind crazy movie people built in the crazy twenties.“ Das Nummernschild der aufgebockten Luxuskarosse, neben der Gillis in der riesigen Garage seinen Wagen abgestellt hat, datiert von 1932. Gillis’ sarkastische Beschreibung entpuppt sich unversehens als Realität. Bei der Erkundung des spektakulären Anwesens trifft er auf die Eigentümerin: Norma Desmond (Gloria Swanson), eine Frau in ihren Fünfzigern, vergessene Stummfilm-Queen, einst der größte Star der Welt. Sie verwechselt ihn mit dem Sargbauer, denn sie trägt gerade ihren Affen zu Grabe – das exotische Tier als Accessoire der Diva; und natürlich eine Allegorie der morbiden Atmosphäre, die in Desmonds egozentrischem Kleinuniversum vorherrscht. Die Hausherrin wünscht einen weißen Sarg mit Seidenpolsterung.
Das ganze Haus der Desmond ist ein narzisstisches Museum ihrer selbst: In extravaganter Pose wirft sie sich auf ihr Seidenplüschsofa, das von lauter kleinen Desmond-Porträts umgeben ist. Ihre Vision, wieder vor die Kamera zurückzukehren, hat sich längst zur größenwahnsinnigen Obsession gesteigert: Besessen von dem Gedanken, erneut die Spitze Hollywoods zu erklimmen und damit einem mutmaßlichen Publikumsbedürfnis nachzukommen, schreibt sie an einem Skript zu dem Film, in dem sie die mythische Salome spielen will und der ihr sensationelles Comeback vollbringen soll. Doch ist ihr das Wort „Comeback“ verhasst, sie bevorzugt „return“.
Als sie erfährt, dass Gillis professioneller Drehbuchautor ist, will sie ihn engagieren, damit er ihr bei der Fertigstellung ihres wahnwitzigen Projekts hilft, das sich in zusammengebundenen Papierstapeln auf ihrem Schreibtisch bereits als langwierige Angelegenheit manifestiert. Der völlig abgebrannte Autor blufft und gibt sich der Desmond gegenüber als viel beschäftigter und selbstverständlich hochpreisiger Mann aus, wissend, dass sie ihn in ihrer Eitelkeit und Not trotzdem anheuern wird. Ihre versteckte Verzweiflung zeigt sich auch daran, dass sie noch am nächsten Tag längst weiß, dass Gillis völlig mittellos ist, da sie eigenmächtig seine Schulden bezahlt und seine Habseligkeiten in ihr Haus beordert hat; zugleich weiß sie in diesem Moment, dass er käuflich und seinerseits von ihr abhängig ist.
Schon in dem Moment, als sich Gillis auf ihren Stuhl gesetzt hat, spätestens aber jetzt, wird er von Norma Desmond und ihrer Villa absorbiert, zum Bestandteil von Desmonds entrückter Parallelwelt. Sie vereinnahmt ihn sofort, wie als Ersatz für den toten Affen, spricht nun auch konsequent von „wir“. Das letzte Quäntchen Autonomie spült schließlich der Dezemberregen hinweg, als es in Gillis’ kleinem Appartement über der Garage durch die Decke tropft und er deshalb in die Villa umzieht – Norma Desmond lässt ihn in das Zimmer ihrer drei Ex-Ehemänner einquartieren. Wie ein Vampir saugt sie sich neuen Lebenselan, will nun den stillgelegten Pool mit Wasser auffüllen lassen und ihr eingemottetes Malibu-Strandhaus wieder in Betrieb nehmen. Gillis lebt jetzt als ihr Schreibknecht und Gigolo – immer den Launen und Allüren der Diva unterworfen, manchmal im maßgeschneiderten Anzug, manchmal in Leoparden-Unterwäsche. In kurzer Badehose klettert er aus dem inzwischen wieder befüllten Pool, sie trocknet ihm den Rücken. Eigenes Geld hat er nicht, sondern steht finanziell komplett in ihrer Abhängigkeit; für jede noch so kleine Erledigung händigt sie ihm Geldscheine aus. Als „a long-term contract with no options“ beschreibt Gillis seine Situation.
Bis zur Ankunft von Joe Gillis hat Norma Desmond das verwunschene Anwesen in tiefer Melancholie zusammen mit ihrem treuen Butler Max (Erich v. Stroheim) bewohnt. Von dem einstigen Glanz des Grundstücks zeugen der von Ratten bevölkerte und mit Laub bedeckte Swimmingpool mit Sprungbrett und drei Einstiegen oder die von Säulenbogen umgebene, nun mit verrottetem Netz längst verfallene Tennisanlage – einst Insignien sagenhaften Reichtums, liegen sie dort nun wie düstere Relikte einer untergegangenen Welt, „out of beat with the rest of the world“, wie Gillis das ganze Anwesen beschreibt. Der Anblick der Villa entfaltet umstandslos einen Lost Place-Charakter, auch die halb verdorrten Palmen im Vorgarten stehen dort wie Allegorien einer verblichenen Grandezza. Norma Desmond ist keineswegs arm – wer weiß schon, wie viel Geld sie zu ihrer Schauspielzeit verdient hat? Aber auf ihrer Psyche lastet ein tiefer Kummer ob des verblassten Starstatus, der hier schwerer wiegt als jeder finanzielle Bankrott.
Ähnlich wie in Robert Aldrichs „What Ever Happened to Baby Jane?“ (1964) ist die Villa ein eigenständiger Charakter des Films, ihr „Casting“ genauso wichtig wie das von Desmond und Gillis. Das reale Gebäude, das für die Außenaufnahmen diente und dessen Interieur man im Studio weitgehend originalgetreu nachbildete, gehörte damals zu den interessantesten Häusern der ganzen Stadt und entfaltete maximales Hollywoodambiente. Erbaut zwischen 1922 und 1925 für eine damals stattliche Geldsumme von dem Geschäftsmann William O. Jenkins (1878–1963), der sein Vermögen ironischerweise in der mexikanischen Revolution gemacht hatte, stand die Villa nach nur einem Jahr wieder leer, ein ganzes Jahrzehnt lang, weshalb das „Jenkins House“ in der Nachbarschaft bald als „Phantom House“ bekannt war. Im Jahr 1936 kaufte es dann ein nochmals reicherer Mann, der Ölmagnat J. Paul Getty (1892–1976). Wiederum 13 Jahre später wurde das Haus an die Paramount vermietet, die den Pool buddelte – das einzige Luxusinsigne, das dem Anwesen bis dahin noch gefehlt hatte. Allein schon der historischer Kontext, dass das Grundstück vom reichsten Mann Mexikos an den reichsten Mann der Welt ging, gebührt dem Charakter der Norma-Desmond’schen Größe und Gigantomanie.
Und wie als Parallele zum Schicksal der Desmond fiel das „Jenkins House“ einem Epochenwechsel zum Opfer. In den 1950er Jahren geriet es zu einer der skandalösen Bausünden von Los Angeles, da man Getty schließlich 1956 die mehrere Jahre lang beantragte Abrissgenehmigung erteilte. An seine Stelle trat das sechsstöckige „Tidewater Building“ (heute: „Harbor Building“, 640 Lorraine Boulevard), ein monumentaler Bau mit einer Fassade aus weißen Marmorplatten auf der Fläche eines ganzen Häuserblocks, der fortan eines der Unternehmen aus Gettys Ölimperium beherbergte. Kurz zuvor war die atmosphärische Kraft des Anwesens allerdings noch für einen weiteren berühmten Hollywoodstreifen abgerufen worden, als die delinquenten Jugendlichen aus „Rebel Without a Cause“ (1955) – einem der bloß drei James-Dean-Filme (zudem mit Natalie Wood und Dennis Hopper) – nachts die Villa erkunden und im leeren Pool unterwegs sind.
Das Haus der Desmond im italienischen Renaissancestil ist allein von seiner Architektur und seiner schieren Größe her extravagant und hollywoodesk. Acht Schlafzimmer, im Keller eine Bowlingbahn, im Innern voller Säulen mit Kapitellen der korinthischen Ordnung; den ursprünglichen Holzboden im Foyer tauschte die Desmond gegen einen edlen Kachelboden aus, damit dort Valentino besser tanzen konnte; die Etagendecke wurde in Portugal gefertigt, hinter einem großen Gemälde verbirgt sich eine Heimkinoleinwand. Das Mobiliar verstärkt die bauliche Opulenz sogar noch: schwere, dunkle Holzmöbel, oft mit dicken Spiralsäulen verziert, vor dem Schreibtisch ein römischer Stuhl, auf dem Gillis einen Skriptauszug des Desmond-Drehbuches liest; ihr Bett ist einer griechischen Triere aus der Antike nachempfunden, ergänzt um eine kleine Engelsfigur am Bug (Dieses Bett hat eine bemerkenswerte Requisitengeschichte und tauchte u. a. 1934 in Howards Hawks’ Screwballklassiker „Twentieth Century“ auf) – von allem viel zu viel, ganz so wie beim Hype um die Hollywoodstars.
Und wer die abgedrehte Statur eines Stummfilmstars aus den Zwanzigern an Haus und Mobiliar noch nicht ermessen kann, für den flechten Wilder, Brackett und Marshman Jr. immer wieder Hinweise auf Norma Desmonds Format ein: Im Studiogebäude der Paramount sei eine ganze Etage ihrer Garderobe gewidmet gewesen; 17.000 Fanbriefe habe sie jede Woche erhalten; ein indischer Maharadscha habe einen ihrer Seidenstrümpfe erbettelt und sich später damit erhängt. In der Garage parkt ihr handgefertigter Isotta-Fraschini mit Leopardenfellbezug und vergoldetem Telefonhörer, mit dem sie dem Fahrer unterwegs ihre Direktiven durchgeben kann. Ihre Star-Gagen hat sie offenbar nicht verprasst, sondern profitabel in Immobilien und Ölquellen angelegt – „I’m richer than all this new Hollywood trash“, sagt sie voller Verachtung für die ihr am Sternenhimmel über der Traumfabrik Nachgefolgten.
Dass „Sunset Blvd.“ in Schwarz-Weiß gedreht ist, entsprach dem damaligen Standard, am Ende der 1940er Jahre. Aber man müsste ihn auch heute noch so drehen; denn jedwede bunte Farbe widerspräche zutiefst dem düsteren, pessimistischen, depressiven Unterton seiner Szenen und natürlich auch dem Stummfilm-Thema. Wilder versetzt sein Publikum in die beklemmende Villa, mitten hinein in die Desmond’sche Obsession. Man kann darin ihre am eigenen Ruhm erkrankte Seele regelrecht greifen. Und obwohl man den Ausgang dieser Manie ja von der ersten Szene an kennt, verfolgt man gebannt den Verlauf dieser vorherbestimmten Tragödie. Gillis und Desmond, der erfolglose Skriptschreiber und der erloschene Stern, gehen eine unheilvolle Symbiose zweier blockierter Menschen ein, der eine am Anfang, die andere am Ende der Karriere. Gillis quartiert sich also in der exzentrisch-morbiden Luxusvilla ein, in der bei leichten Windstößen eine Orgel schauerliche Töne von sich gibt, hunderte von Desmond-Porträts drapiert sind und die Schauspielerin in ihrem Privatkino an mehreren Abenden pro Woche die eigenen Filme abspielen lässt („So much nicer than going out, she’d say.“).
Über diesem Arrangement schwebt ihre Comeback-Absicht wie ein Damoklesschwert. Denn der Profi Gillis ahnt natürlich, dass sich bei Paramount längst niemand mehr für sie interessiert und obendrein ihr Skript von peinlicher Qualität ist. Norma Desmond freilich ist ganz und gar unfähig, sich mit dem Bewusstsein einer glanzvollen Vergangenheit zu begnügen oder die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens zu erkennen, geschweige denn jemals zu akzeptieren. Um jeden Preis will sie, „still sleepwalking along the giddy heights of a lost career“, die einstige Größe zurückerlangen, ja noch steigern. Für ihre Tonfilm-Epigon:innen hat sie aus postpubertärem Selbstschutz nichts als Verachtung übrig („We didn’t need dialogue. We had faces. There just aren’t any faces like that any more. Maybe one, Garbo.“). „I can say anything I want with my eyes!“, lautet ihr Credo. Gleich bei ihrer ersten Begegnung echauffiert sie sich (in theatralischem Furor) gegenüber Gillis über die Filmbranche, die sie – die Größenwahnsinnige – des Größenwahns zeiht, neben dem Bild unbedingt auch noch den Ton bekommen zu müssen: „They took the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentinos! And who have we got now? Some nobodies!“ Worte hätten die Branche stranguliert, „but there’s a microphone right there to catch the last gurgles, and Technicolor to photograph the red, swollen tongue!“ Mit dem Blick auf Norma Desmond lässt sich begreifen, wie gefährlich der Aufstieg zu Glanz und Gloria, zum Selbstzweck verkommen, sein kann.
„Sunset Blvd.“ ist ein Film aus Hollywood über Hollywood. Mit tragikomischem Unterton wirft er einen überaus bitteren, seziererischen Blick auf das Filmbusiness im Allgemeinen, die Pathologien und Neurosen der „Traumfabrik“ im Besonderen – ein „Abgesang“, wie es oft heißt. Man soll sehen, wie verschwenderisch die Stars des frühen Hollywood in ihrem Geld schwelgten und in welch sinnlosen, kruden Luxus sie ihre immensen Gagen steckten. Glück kann man bekanntlich nicht kaufen. Man soll auch sehen, wie sich in den Besitztümern – megalomane Villen, kostspieliges Material für jedes noch so belanglose Accessoire – bereits die Entfernung von der Wirklichkeit andeutet. Vor allem aber soll man die schnelle Vergänglichkeit von Ruhm nachvollziehen, die sich in der stickigen Stratosphäre der Hollywoodstars mit menschlicher Eitelkeit und Geltungssucht zu einem fatalen Cocktail vermischt. Weil die Desmond mit ihrem Karriereende nicht klarkam, mehrere Suizidversuche unternahm, hat Butler Max der Diva eine schützende Scheinwelt errichtet (die sie als Kokon missverstand, für eine Metamorphose zu einem noch viel größeren Star-Leben).
Was Wilder, Brackett und Marshman Jr. hier formulieren, ist eine Verantwortungsutopie, in der Produzent:innen und Regisseur:innen eine Verpflichtung gegenüber den Geschöpfen der Filmindustrie übernehmen: „I made her a star, and I cannot let her be destroyed“, erklärt Max sein Anliegen. Denn spät in der Handlung von „Sunset Blvd.“ entpuppt sich der unscheinbare, mimiklose Butler Max v. Mayerling als Ex-Regisseur, Entdecker der Desmond und deren erster Ehemann, einst neben D.W. Griffith und Cecil B. DeMille eine der großen Regiehoffnungen der damals noch blutjungen Filmbranche. Wegen ihrer „moments of melancholy“, wie der Butler die Selbstmordversuche der Desmond nennt, sind im ganzen Haus die Türschlösser entfernt worden, damit sich kein Raum mehr verriegeln lässt. Norma Desmonds Beschäftigung besteht nun darin, Porträts zu signieren; und sie prahlt mit ihrer Fanpost, die sie – wie Norman Maine 1937 in „A Star Is Born“ – als untrügliches Indiz für das Verlangen des Publikums wertet; doch sind es fingierte Zuschriften, geschrieben vom Butler. Desmonds Scheinwelt ist bedroht, als laut ihrer Astrologin die Sterne günstig stehen und sie daher beschließt, das Skript nun endlich an ihren alten Regisseur Cecil B. DeMille zu senden und sich die einstige Hollywoodikone dann eines Tages tatsächlich zu ihrem alten Studio aufmacht (die reale Paramount, wo zur selben Zeit „Sunset Blvd.“ entstand). In der festen Erwartung, dort wegen ihrer vermeintlich genialen Filmidee – in ihren Augen ein Coup sondergleichen – mit offenen Armen empfangen und auf der Stelle ins Rampenlicht gerückt zu werden, lässt sie sich mit ihrem Isotta-Fraschini majestätisch durch das berühmte „Bronson Gate“ des Studiogeländes chauffieren (in das der Fahrer v. Stroheim angeblich krachte, weil er kein Auto fahren konnte) – eben ganz wie eine Königin, die nach langer Zeit mal wieder eines ihrer Schlösser besucht.
Allein was dort passiert, reicht aus, dem Film einen großen Sehenswert zu verleihen: Am Eingangstor weiß der jüngere Pförtner zunächst nichts mit ihrem Namen anzufangen („Norma who?“), aber sie kennt den älteren, der sie sofort einlässt, unendlich geschmeichelt, da sie seinen Namen nicht vergessen hat. Cecil B. DeMille (1881–1959), Mitbegründer Hollywoods und schon damals eine Regielegende – hier obendrein von sich selbst gespielt –, steckt inmitten der Dreharbeiten zu „Samson and Delilah“ (dem Bibel-Schinken, den DeMille damals im Jahr 1949 tatsächlich gerade für die Paramount drehte).
Die Desmond, die mit dem Film-DeMille ihre großen Leinwandtriumphe gefeiert hat und ihn nun für ihr Comeback begeistern will, stört ihn natürlich bei der Arbeit. Als die Pforte die Crew in der Soundstage über Desmonds nahenden Besuch informiert, durchläuft die Nachricht zunächst die Befehlskette, bis sie irgendwann bei DeMille, dem Regisseur, ankommt. Der reale DeMille, so muss man bei dieser Szene wissen, hat mit der Desmond-Darstellerin Gloria Swanson (1899–1983) ein halbes Dutzend Filme gemacht, die wiederum Swansons große Stummfilmzeit begründeten, mit denen sie zum Star avancierte; im Film begrüßt er die Desmond wie einst die Swanson mit „young fellow“. Ironischerweise gelang Swanson dann ganz im Sinne des Comebackstrebens ihrer Leinwandfigur mit „Sunset Blvd.“ tatsächlich ein großer Erfolg, inklusive einer Oscarnominierung und eines Golden-Globe-Gewinns. DeMilles Karriere neigt sich da gerade dem Ende zu, „Samson and Delilah“ war eine seiner letzten drei Regiearbeiten. Ganz im Geiste seiner Monumentalfilme sorgte DeMille für eines der vermutlich teuersten Close-ups der Filmgeschichte: Als er für einen Retake noch einmal vor der Kamera erschien, ließ er sich dies zusätzlich zu seiner großzügigen Gage noch mit einem Cadillac und weiteren 3.000 Dollar vergüten.
DeMille, damals Ende sechzig, schwant, dass Desmonds Besuch dem „awful script of hers“ gilt. Aber ihr Verdienst reicht noch immer so weit, dass DeMille am Set ein „Hold everything!“ ins Mikrofon durchgibt und seine teuren Dreharbeiten für einen Moment unterbricht. „Thirty million fans have given her the brush“, entgegnet DeMille seinem Assistenten, als der eine platte Ausrede vorschlägt. Ihre Feststellung, „without me, there wouldn’t be any Paramount Studio“, ist vielleicht die einzige Aussage der Desmond im ganzen Film, die ein Fünkchen Wahrheit in sich trägt (sie erinnert zudem an Bette Davis, die nach ihrem Ausstieg bei Warner Bros. gelegentlich auf die Dächer deren Soundstages blickte und sich dachte: „I am responsible for a few of them being built.“ (Davis, Bette: The Lonely Life. An Autobiography, New York 1990 [1962], S. 216)). Bei ihrem letzten Aufeinandertreffen sei Charles Lindbergh gerade in Paris gelandet (1927), scherzt DeMille. Der DeMille-Set bietet heute eine kostbare Momentaufnahme, die einen Einblick in das Filmemachen am Ende der 1940er Jahre in Hollywood gewährt: Man sieht die sperrige Technicolor-Dreistreifenkamera für die Farbaufnahmen, all die Geräte und Kabel, die im Schwarz-Weiß des Films tatsächlich eine industrielle Aura umgibt (später im Film wandeln überdies Schaefer und Gillis in der Zigarettenpause während einer ihrer nächtlichen Skriptsessions durch eine beeindruckende Kulissenstadt).
Als Norma Desmond auf dem Regiestuhl von DeMille ihre Audienz bei dem Regietitanen abwartet, schwebt über ihrem Kopf ein Mikrofon vorüber, das sie voller Verachtung beiseite stößt. Ein alter Beleuchter erkennt sie, stellt sie mit seinem riesigen Scheinwerfer ins Spotlight, das sie wie ein Sonnenbad zu genießen scheint; daraufhin umringen sie bald die älteren Set-Leute und Extras, die sie noch kennen („I thought she was dead.“). Voller Glück über ihre vermeintliche Rückkehr weint sie DeMille gegenüber: „I just want to work again. You don’t know what it means to know that you want me.“ Aber die Anrufe aus dem Paramount-Management, die in der Desmond-Villa zuletzt eingingen und die sie aus Koketterie unbeantwortet ließ, galten nicht ihrem Skript, sondern ihrem alten Fahrzeug, das für eine Produktion als Requisite gemietet werden soll. Aber natürlich sagt ihr das niemand, schon gar nicht Max. Und so verlässt sie das Studiogelände mit der fixen Idee, in Kürze mit DeMille einen Film zu drehen. Eine Armee von Kosmetiker:innen gehen nun im Desmond-Anwesen ein und aus – sie bereitet sich systematisch auf den vermeintlich baldigen Produktionsstart vor, „like an athlete training for the Olympic Games“, „absolutely determined to be ready“.
Nicht nur verzichtet „Sunset Blvd.“ scheinbar en passant auf ein Happy End. Vielmehr wartet der Film mit einem Finale auf, dessen letzte Szenen seither Generationen von Cineast:innen faszinieren. Gillis will aus seinem goldenen Käfig ausbrechen; als er seine Sachen packt und verschwinden will, zurück nach Ohio, da bietet ihm die Desmond alles an, was auch immer er verlange. „I can’t face life without you!“, wimmert sie. Wilder, Brackett und Marshman Jr. nutzen diese Konstellation, um mit ihren Dialogen die ganze Tragödie des Star-Wesens zu sezieren – den Mangel an emotionaler Reife, die Sucht nach Prominenz. Gillis erwidert: „The audience left twenty years ago. Now, face it!“ Und: „Norma, you’re a woman of fifty. Now, grow up!“ Wie als Schlüssel zur Lösung eines Problems, das etliche Hollywoodmenschen aufgerieben, wenn nicht zerstört hat, resümiert Gillis: „There’s nothing tragic about being fifty, not unless you try to be 25!“ Sie wiederum äußert kurz darauf die in diesem Moment geradezu kathartische Feststellung: „You see, this is my life! It always will be! There’s nothing else. Just us and the cameras and those wonderful people out there in the dark.“ Als Gillis mit gepacktem Koffer an der Desmond vorübergeht, flüstert sie mit irrem Blick: „No one ever leaves a star. That’s what makes one a star.“ Und während kurz darauf Joe Gillis’ Leiche im beleuchteten Pool treibt, haucht sie: „Stars are ageless, aren’t they?“, so als wären es ihre letzten Worte. Die in Hollywood allzeit alerten Nachrichtenleute – hier sarkastischerweise von Paramount – treffen ein. Als die Desmond, die auf die Befragung der Kriminalkommissare nicht reagiert, von der Ankunft der Kameras hört, blickt sie auf und denkt, DeMille habe ihren Set vorbereitet. Max stellt sich zwischen das Kamerateam und führt noch ein letztes Mal Regie. „Quiet, everybody! Lights! Are you ready, Norma?“ Im Glauben, ihre Palastszene zu drehen, schreitet sie langsam die Stufen ihrer prachtvollen Treppe hinab.
Das gigantische Moment von „Sunset Blvd.“ liegt freilich nicht in der Story, sondern der Wirklichkeitsnähe des Films: darin, dass seine Darsteller:innen ihren Figuren so ähnlich sind, natürlich zuvorderst in deren Tragik. Zwar war Gloria Swanson im Unterschied zu ihrem Filmcharakter nicht ganz von der Leinwand verschwunden (sie hatte noch in einer Handvoll Tonfilme mitgespielt, wirkte überdies im Fernsehen, Theater und Radio); aber natürlich entsprach sie in vielem der exzentrischen Desmond: Swansons Debütfilm datiert aus dem Jahr 1915 – da war sie wie die Desmond gerade mal 16 Jahre alt, und Desmond wie Swanson arbeiteten für die Paramount. Wie ihr Alter Ego in „Sunset Blvd.“ erlebte sie ihre Hochphase in den Roaring Twenties. Der Weimarer Filmkritiker Ernst Blass schrieb über sie einst: „[…] sprühend, voll glückhafter Schärfen, ein weiblicher Figaro, voll spielender Genialität“ (Blass, Ernst: „in kino veritas. Essays und Kritiken zum Film. Berlin 1924–1933, Berlin 2019, S. 215 [1929 in der Illustrierten Filmzeitung]); „the all-time prototype image of A Movie Star“ (Rogers St. Johns, Adela: The Honeycomb, New York 1969, S. 155) nannte sie die Hollywoodkolumnistin Adela Rogers St. Johns.
Swanson war einer der ersten Filmsuperstars überhaupt, emanzipiert und hedonistisch. Sie verschliss unzählige Ehemänner und Liebhaber, mit ihren prahlerischen Ausgaben definierte sie die Grenzen neureicher Extravaganz. Wie Desmond besaß auch Swanson ein Anwesen von zu damaliger Zeit phänomenalem Ausmaß, das eine 24-Zimmer-Villa mit fünf Badezimmern, einem Fahrstuhl und einer 300-Quadratmeterterrasse umfasste, einst erbaut von dem Einwegrasierklingenerfinder King Gillette (und das nur wenige Schritte vom Sunset Boulevard entfernt lag). Ihr ausschweifender Lebensstil war legendär, von dutzenden Pelzmänteln, horrend teuren Juwelen- und Unterwäschekäufen erzählte man sich, zudem unterhielt sie angeblich einen ganzen Rolls-Royce-Fuhrpark nebst einem Lancia mit Sitzbezügen aus Leopardenfell (wie bei Norma Desmond) – und wenn Swanson einem ihrer Liebhaber im Zorn eins überbriet, dann geschah dies mit einer Magnumflasche Champagner.
Die Realitätsbezüge seines Films treibt Wilder in einer Szene auf die Spitze, als sich in Desmonds Villa einige ihrer Bekannten aus alten Tagen zu einer verrauchten Bridge-Partie einfinden. Die Frau und die beiden Männer, die Gillis „the waxworks“ nennt, sind in Wirklichkeit Titanen der Stummfilmära: Da ist das schwedische Ex-Model Anna Q. Nilsson (1888–1974), 1914 zur schönsten Schauspielerin der Welt gekürt und 1919 als „the ideal American girl“ etikettiert (Ernst Blass titulierte sie als „die eigentliche Schöpferin der Lichtspielkunst“, die „menschlich und unabweisbar durch die Leinwand hindurch“ dringen und „Menschen aufleuchten und vergehen lassen“ könne) (Blass 2019, S. 214 [1929 in der Illustrierten Filmzeitung]); dann H. B. Warner (1875–1958), einst unter der Regie von DeMille in „The King of Kings“ (1927) in der Rolle von Jesus Christus in die Filmhistorie eingegangen; und schließlich der für seine Alkoholeskapaden berüchtigte, aber als genialer Filmemacher unvergessliche Buster Keaton (1895–1966).
Die Härte und die Ironie, die etliche der Beteiligten gegen sich selbst aufbringen, verleihen „Sunset Blvd.“ einen gewaltigen Charakter. Aber sie alle werden übertroffen von Erich v. Stroheim, dem Darsteller des Butlers. Im Wien der kaiserlich-königlichen Donaumonarchie im Jahr 1885 zur Welt gekommen, wanderte v. Stroheim in die USA aus, wurde Schauspieler, drehte 1918 seinen ersten Film und avancierte in den 1920er Jahren zu einem der bekanntesten Filmemacher:innen Hollywoods. Weil er jedoch regelmäßig die Produktionskosten explodieren ließ, in Hollywoodgefilden bald als „$troheim“ firmierte, wollte irgendwann kein Studio mehr mit ihm zusammenarbeiten. Möglicherweise war Stroheim, den Freunde – ungeachtet seines bloß erfundenen Adelstitels – nur „Von“ nannten, aber auch einfach ein Sündenbock Fehlentscheidungen der Studios, jedenfalls: Seine Regiekarriere ging in die Brüche, Stroheim behauptete sich jedoch anschließend vor der Kamera als Schauspieler. Für Wilder hatte er 1943 in „Five Graves to Cairo“ in einer ziemlich genialen Performance den deutschen Generalfeldmarschall Erwin Rommel gespielt, zu einem Zeitpunkt, als der reale Schlachtenlenker wie sein Leinwandpendant noch in Nordafrika kommandierte.
In einer Szene bedient Ex-Regisseur Max v. Mayerling den Projektor von Desmonds Heimkino, um während des üblichen Diven-Zeremoniells einen ihrer früheren Filme zu zeigen – dabei läuft in Wirklichkeit der verrufenste aller Von-Stroheim-Filme, der sowohl die Karriere v. Stroheims beschädigte als auch am Ende der großen Swanson-Zeit stand. Die Szene, die ohne diesen Hintergrund ganz anders, weitaus banaler wirken würde, gewinnt an Brisanz durch die Geschichte, welche die beiden Stummfilmrelikte Swanson und v. Stroheim miteinander verbindet: Gemeinsam hatten sie 1928/29 für die damals astronomische Summe von rund 800.000 Dollar „Queen Kelly“ aufgenommen; noch während der Dreharbeiten sorgte Swanson für v. Stroheims Rausschmiss. Ebendieser Film flackert nun zwei Jahrzehnte später in „Sunset Blvd.“ über die Heimkinoleinwand von Norma Desmond (Swanson), während v. Stroheim als Butler am Projektor steht. Und sogar Hedda Hopper (1885–1966), neben Louella Parsons (1881–1972) eine der beiden berühmt-berüchtigten Klatschreporterinnen der klassischen Hollywoodära, ist sich nicht zu schade, sich selbst zu spielen: Als ein Polizist am Tatort den Gerichtsmediziner verständigen will, wirft ihn die längst in Desmonds Schlafzimmer sitzende Hedda Hopper aus der Leitung – ihr Anruf, bei ihrer Zeitung natürlich, sei wichtiger. Von Stroheim und Hopper sind Beispiele dafür, wie „Sunset Blvd.“ nicht nur Anleihen bei der Realität nimmt, sondern wie hier Fiktion und Wirklichkeit miteinander verwoben werden.
Nicht auszudenken, hätte Wilder seine ursprünglichen Präferenzen für die beiden Hauptrollen genommen. Bevor Wilders Regiekollege George Cukor die Swanson vorschlug, hatte den erloschenen Stern eigentlich der Dreißigerjahre-Star Mae West spielen sollen; als daraus nichts wurde, dachte Wilder erst an die Stummfilmikone Pola Negri und anschließend an Mary Pickford, den Inbegriff des Filmstars und die erste Großverdienerin vor der Kamera. Sie alle wären ebenfalls Inkarnationen des Star-Mythos, den Brackett und Wilder auseinandernehmen wollten, gewesen – aber es wäre doch ein anderer Film geworden. Und das gilt auch mit Blick auf Montgomery Clift, für den eigentlich die Holden-Rolle geschrieben worden war, der aber kurz vor Drehbeginn absagte.
Wilder vermutete, weil Clifts Agent dem Darsteller von dieser Rolle abriet, sie zu verdorben sei; angeblich habe Clift, der gerade mit Olivia de Havilland „The Heiress“ (1949) gedreht hatte, jedoch schlicht keine Lust mehr auf Liebesszenen mit älteren Frauen gehabt; aber vielleicht sagte Clift auch ab, da er damals selbst einer älteren Schauspielerin nahestand und die zu spielende Leinwandbeziehung nicht als Realitätsbezug missverstanden wissen wollte. Jedenfalls trauerte Wilder dieser Casting-Idee noch Jahrzehnte später nach – auch wenn viele sagen, gerade William Holden sei ein Leinwand-Alter-Ego Wilders gewesen, weshalb dieser ihn auch so gern gecastet habe (für einen anderen Wilder-Film, „Stalag 17“ von 1953, gewann Holden den Hauptdarsteller-Oscar, ferner spielte er unter Wilders Regie noch 1954 in „Sabrina“ und 1978 in „Fedora“). Aus dem Register der verfügbaren Paramount-Vertragsschauspieler schien der damals von Star-Ruhm noch unbefleckte Holden jedenfalls für Brackett und Wilder als die geeignetste Clift-Alternative herauszustechen. Und womöglich kitzelte das ungehobene Potenzial, das Wilder in Holden sah, auch den Ehrgeiz des Regisseurs, Holden endlich die gebührende Leinwandgeltung zu verschaffen.
Ein genialer Aspekt von „Sunset Blvd.“, den Swanson unerhört stark umgesetzt hat, besteht in der bizarren Gleichzeitigkeit von Stumm- und Tonfilm-Ära. Swanson spricht zwar, doch verkörpern ihre weit aufgerissenen Augen, ihre übertriebenen Hand- und Kopfbewegungen die vor dem Tonfilm unverzichtbare Kunst, sich ausschließlich über Mimik und Gestik auszudrücken. Ähnlich wie bei der Montage von Real- und Zeichentrickfiguren à la „Mary Poppins“ (1964) treffen hier mit Gloria Swanson und William Holden zwei Schauspielepochen und Hollywoodzeitalter aufeinander. Wie sehr dieser Unterschied wirkt, lässt sich daran ermessen, dass Holden wenigstens fünfzig Jahre später in einem Film des 21. Jahrhunderts nicht annähernd so fremd erscheinen würde wie Swanson in „Sunset Blvd.“, deren Stummfilmzeit damals aber wiederum bloß zwanzig Jahre zurücklag.
Daneben haben Wilder und Brackett (zusammen mit dem hinzugeholten D.M. Marshman Jr.) ihren letzten gemeinsamen Film vollgestopft mit Quintessenzen des Hollywoodlebens. Auf seiner verzweifelten Suche nach einer ausgelassenen Neujahrsparty außerhalb des klaustrophobischen Norma-Desmond-Museums beschreibt Gillis etwa die unteren Hollywoodschichten: „Writers without a job, composers without a publisher, actresses so young they still believe the guys in the casting offices.“ (Auf der Silvesterfeier haben auch die beiden Filmmusikschreiber Ray Evans und Jay Livingston Cameos, als sie inmitten der Partymeute am Klavier sitzen.) Und nach einem weiteren Selbstmordversuch knurrt die Desmond Gillis an: „Great stars have great pride.“
Überhaupt ist „Sunset Blvd.“ ein Meisterwerk geschliffener Drehbuchkultur. Seine wesentlichen Urheber, Billy Wilder und Charles Brackett, galten als ebenso unzertrennliches wie furioses Duo; eine Zeit lang waren sie die bestbezahlten Drehbuchentwickler Hollywoods. Wilder war NS-Flüchtling und alles andere als konservativ, Brackett hingegen ein republikanisch gesinnter Literat aus dem Ostküstenestablishment, kultiviert und fern von den neureichen Attitüden der übrigen Hollywoodelite. Für Brackett und Wilder bedeutete das Drehbuch alles, jedenfalls mehr als Schauspieler:innen und Kulissen. Wie später bei seinem zweiten großen Partner, I.A.L. Diamond, durchwanderte Wilder das Zimmer, während der andere an der Schreibmaschine saß – eine Schaffensgeografie, die Wilder und Brackett für einen kurzen Moment in einer Szene von „Sunset Blvd.“ spiegeln, in der Gilles durch das Büro von der am Schreibtisch tippenden Schaefer marschiert, nachdem er sich nachts aus der Desmond-Villa geschlichen hat. Insofern stand „Sunset Blvd.“ am Ende einer Ära, die 1938 mit der gemeinsamen Drehbucharbeit an der Ernst-Lubitsch-Romcom „Bluebeard’s Eighth Wife“ begonnen hatte – denn Wilder trennte sich nach zwölf Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit von Brackett.
„Sunset Blvd.“ markierte somit den Schlusspunkt einer der damals am meisten beneideten „Ehen“ Hollywoods. Dass sie nach „Sunset Blvd.“ dann getrennte Wege gingen, deutete sich an: Als Wilder im November 1948 seinen Partner Brackett in der Nacht der Präsidentschaftswahlen in derart aufgelöster Stimmung antraf, dass sie ihm noch niedergeschlagener vorkam als seine eigene nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, da war vielleicht noch einmal deutlicher als zuvor die politische Kluft, die zwischen dem liberalen Wilder und dem republikanischen Brackett lag, sichtbar geworden sein – Truman von den Demokraten hatte gewonnen. Insofern war die Beziehung der beiden Männer ohnehin brüchig gewesen.
Zudem war ihr vorheriges Projekt „The Emperor Waltz“ (1948) Wilder hinterher geradezu peinlich gewesen; dass sie bei „Sunset Blvd.“ auf den Dritten im Bunde, Marshman Jr., als frischen Ideengeber vielleicht stärker als sonst angewiesen waren, deutete bereits auf ihre ermüdete Beziehung hin. Wilder stellte die Trennung später oft als Studio-Edikt dar: Paramount habe sich von einer Aufsplittung des Autorengespanns schlicht einen doppelt so großen Drehbuch-Output versprochen. Angesichts ihres enormen Erfolges (das Bing-Crosby-Vehikel „The Emperor Waltz“ hatte immerhin viel Geld eingespielt) wirkt das indes wenig glaubwürdig. Und auch Brackett erzählte später im Privaten, dass ihn Wilders Ankündigung, nach Abschluss der Dreharbeiten getrennte Wege zu gehen, wie ein Schlag getroffen habe, von dem er sich nie wieder erholte. Die Trennung erfolgte daher wohl eher, weil sich Brackett bei „Sunset Blvd.“ noch stärker als sonst gegen etliche Wilder-Ideen gesträubt hatte, die dem reservierten Konservativen offenbar zu weit gingen; noch mühsamer als sonst hatte Wilder anscheinend seinem Partner seine Wünsche aufdrängen müssen. Und so sah Wilder vermutlich den Zeitpunkt gekommen, sich von Brackett loszueisen.
Heute blickt man auf „Sunset Blvd.“ ganz selbstverständlich als Meisterstück eines der besten Drehbuchschreibergespanne der Filmgeschichte zurück; aber damals hieß es bei manchen Kritiker:innen aus New York: „Since ‚Sunset Boulevard‘ contains the germ of a good idea, it’s a pity it was not better written.“ (Hamburger, Philip: Speaking of the Dead, in: The New Yorker, 19.08.1950.) Legendär ist auch die Begebenheit, als Paramount den Film im Studiokino einer Auswahl vergangener und aktueller Hollywoodgranden zeigte, darunter auch dem allseits gefürchteten MGM-Chef L.B. Mayer. Mayer, berüchtigt für sein Temperament, erregte sich nach dem Film über den Regisseur, der geteert, gefedert und aus Hollywood verjagt gehöre, wohl so sehr, dass Wilder ihm zurief: „Go fuck yourself!“ (Billy Wilder zit. nach Eyman, Scott: Lion of Hollywood. The Life and Legend of Louis B. Mayer, New York 2005, S. 432.)
„Sunset Blvd.“ ist ein Film, bei dessen Erwähnung unweigerlich zwei, drei Dialogzeilen immer wieder zitiert werden. Etwa der Schlagabtausch zwischen Gillis und Desmond bei ihrem allerersten Gespräch: „You used to be big!“ – „I am big. It’s the pictures that got small.“ Oder der makabre Schlusspunkt: „All right, Mr. DeMille, I’m ready for my close-up.“ Unvergesslich machen den Film aber die masochistischen Wirklichkeitsbezüge seiner Darsteller:innen. Die trostlose Bridge-Runde, die in Wirklichkeit ein Gipfeltreffen der Beletage des Stummfilmzeitalters ist, Szenen wie der einsame Tanz inmitten des monumentalen Desmond-Domizils in der Silvesternacht oder geniale Einlagen wie Swansons spontane Chaplin-Imitation (ein kleiner Verweis auf ihre Chaplin-Nachahmung 1924 in „Manhandled“) veredeln Billy Wilders zeitlose Demontage des Filmstar-Konzepts und machen „Sunset Blvd.“ nicht nur zum vielleicht besten Film über Hollywood, sondern zu einem der besten Hollywoodfilme überhaupt.