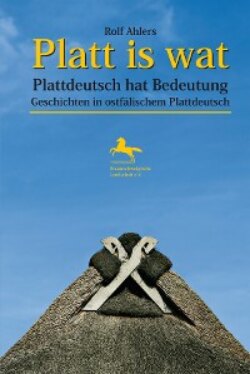Читать книгу Platt is wat - Plattdeutsch hat Bedeutung - Rolf Ahlers - Страница 49
ОглавлениеSchriebet dütlich
Üt ne Ansprake: „..., dass man Ostfälisch ohne jeglichen Apostroph schreiben kann, wogegen es in manchem anderen Text nur so von Apostrophen wimmelt oder auch andere merkwürdige Schreibweisen den Lesefluss und das Verständnis behindern.“
De Apostroph (= Auslassungszeichen) kummt in huchdütsche Texte nich sä ofte vor. De DUDEN wiest üsch:
Der Apostroph kennzeichnet Wörter mit Auslassungen, wenn die verkürzten Wortformen sonst schwer lesbar oder missverständlich wären. „Schlaf nun selig und süß, schau im Traum ‘s (= das) Paradies.“ – Der Apostroph steht bei Wörtern mit längeren Auslassungen im Wortinneren. „D’dorf“ (= Düsseldorf) – Der Apostroph steht zur Kennzeichnung des Genitivs von artikellos gebrauchten Namen, die auf -s, -ss, -ß, -tz, -z, -x enden. „Aristoteles’ Schriften“
As „merkwürdige“ Schriefwiesen häbbe ik allemal weer säwat efunnen: „Uppe Deele stelle sienen Dagstock hen.“ Al beter was: „Up’e Deele stell’e sienen Dagstock hen.“ Noch beter is: „Up de Deele stelle hei sienen Dagstock hen.“ (= Auf den Flur stellte er seinen Handstock hin.)
Hochdeutsch gibt es kein „hastdu“, sondern „hast du“, plattdeutsch fand ich: „haste“, „kannste“, „mosste“, „sollste“, „watte“, „weeste“, „wenne“ usw., von daher ist besser „hast’e“ usw., noch besser ist „hast dü“ usw. – ohne Apostroph!
Hochdeutsch gibt es kein „dassman“, sondern „dass man“, plattdeutsch fand ich: „datten, „hatten“ usw., von daher ist besser „dat’n“ usw., noch besser ist „dat en“ usw. – ohne Apostroph!
Hochdeutsch gibt es kein „ister“, „istsie“, „istdie“, „istder“ sondern „ist er“ usw., plattdeutsch fand ich dafür oft „isse; ebenso fand ich „hatte“, „wenne“ usw., von daher ist besser „is’e“, „hat’e“, „wenn’e“ usw., noch besser und damit deutlicher ist „is hei/is öt“, „hat hei“, „wenn hei“ usw. – ohne Apostroph!
Un noch en poor:
„annet“ (= an das), beter is: „an’t“, noch beter is: „an dat“;
„inne“ (= in die), beter is: „in’e“, noch beter is: „in de“;
„midde“ (= mit der), beter is: „mit’e“, noch beter is: „mit de“;
„uppen“ (= auf einem/einen), beter is: „up’n“, noch beter is: „up en“;
„vonne“ (= von der), beter is: „von’e“, noch beter is: „von de“.
Ohne Apostroph is dat doch veel beter tä lesen un tä varstahn!
Bie „anne“, „inne“ un sä wieer:
„Anne Zuppe sünd Nüdeln anne.“ Richtig is: „An de Zuppe sünd Nüdeln anne.“ (= An der Suppe sind Nudeln dran.)
„Inne Stunne sünd wi weer inne.“ Richtig ist: „In ne Stunne sünd wie weer inne.“ (= In einer Stunde sind wir wieder drin. = In einer Stunde sind wir wieder zu Haus.)
Leiwe Lüe, schriebet – in allen wat ji schriebet – dütlichet Plattdütsch. Damidde uk de Lüe dat lesen un varstahn könnt, de dat Plattdütsche noch swor fallt. – Dat en bien Spreken mal Wöre tähupe trecket, is wat anderet. Up hochdütsch seggt en ja uk „kannste“, „haste“, „machste“ usw. un schrift aber „kannst du“, „hast du“, „machst du“ usw. – Spreken un Schrieben is un blift underschiedlich!
Wohr is: De „Schriftbilder“ von Plattdütsch un Huchdütsch möt wiet hen oberein passen. Je dütlicher wi „Plattdütschen“ schriebet, deste beter kann dat midde den „Lesefluss“ un dat „Verständnis“ bie de Lüe weern, de Plattdüsch – noch – nich könnt.
In en Stipstöriken stund de Ütdruck „brüketsche“, dat meine „brüket ji“ (= braucht ihr)!
Leiwe Lüe, ik bin wohrlich nich dat Mat von alle Dinge, aber: Nistforungüt. (= Nichts für ungut.)