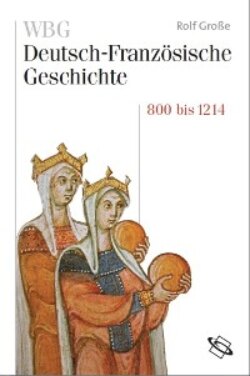Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. I - Rolf Große - Страница 13
Bevölkerung
ОглавлениеDie Vorstellung einer ethnischen Synthese von Romanen und Germanen, die Leopold von Ranke im Frankenreich verwirklicht sah, greift zu kurz54. Denn Karl der Große herrschte, mit einem modernen Begriff gesprochen, über einen Vielvölkerstaat, dessen Bevölkerung in ihrem überwiegenden Teil aus Romanen, Germanen, aber auch Slawen bestand55. Die Grundlage dazu war bereits in der Zeit der Merowinger gelegt worden, doch hatten die Eroberungszüge Karls des Großen diesem Charakeristikum noch stärkere Konturen verliehen. Die Unterwerfung der Langobarden führte zu einer größeren Gewichtung des romanischen Elements, die Kämpfe an der Ostgrenze zu einer Einbeziehung von Slawen und Awaren. Der fränkischen Expansion vermochten sich im Südwesten nur die Basken und im Westen die Bretonen zu widersetzen. Wenngleich Deportationen unterworfener Sachsen in andere Teile des Reichs belegt sind, wurde eine systematische Politik der Frankisierung wohl nicht betrieben, und im Unterschied zum Römischen Reich behielten die einzelnen Teile der Bevölkerung ihre Eigenart bei. Dies gilt natürlich auch für die Sprache, vulgärlateinische, germanische und slawische Dialekte. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass man im größten Teil Galliens Vulgärlatein sprach, im Norden und Osten hingegen vom Germanischen abgeleitete Dialekte.
Wenngleich der Rhein im Laufe der Geschichte nur auf kurzen Strecken als Ostgrenze des regnum Francorum gedient hatte, trennte er doch, etwa wie die Donau, Kulturräume mit unterschiedlichen Traditionen56. Denn die Gebiete westlich beziehungsweise südlich dieser beiden Flüsse hatten zum römischen Imperium gehört. Im Osten lassen sich die auf personaler Grundlage beruhenden Völkerschaften ausmachen, so die Alemannen, Bayern und Sachsen, in gewissem Sinne auch noch die Thüringer, der Westen hingegen ist geprägt von regionalen Einheiten, die allerdings beeinflusst wurden von den Westgoten, Burgundern und Franken, die in der Zeit der Völkerwanderung ins Land gekommen waren. Wenn in den Quellen von den Gothi oder Burgundiones die Rede ist, dann sind die Bewohner einer bestimmten Gegend gemeint, nicht aber die Angehörigen einer Völkerschaft.
Wir können noch einen Schritt darüber hinausgehen und die Gebiete rechts und links des Rheins weiter unterteilen: in die alte Germania magna außerhalb des Limes, die die fränkischen Gebiete südlich der Lippe, Hessen und Thüringen umfasste; in die rechtsrheinischen Regionen im Süden des Limes, und zwar Alemannien, Bayern und Churrätien; und schließlich in Gallien, für das seit der Wende von der Antike zum Mittelalter eine Differenzierung in Nord- und Südgallien üblich wurde. Während sich das Eindringen der Germanen in Südgallien vor allem politisch auswirkte, waren im Norden auch das wirtschaftliche und soziale Gefüge betroffen. Die Senatorenaristokratie und mit ihr die wohlhabenderen Schichten waren hier fast vollständig abgewandert, so dass die fränkische Siedlung in diesen Gebieten, zumindest bis zur Seine, am dichtesten war, während sich Zeugnisse südlich der Loire für sie kaum finden. Dieser Entwicklung entspricht, dass gallorömische Institutionen vor allem in Aquitanien und der Provence bestehen blieben.
Im Unterschied zu den geographischen Angaben ist es schwierig, genauere Aussagen über den Umfang der Bevölkerung zu machen. Die Forschung geht heute davon aus, dass im Karlsreich ungefähr 10 Millionen Menschen lebten. Im Raum Paris und in Nordwestfrankreich dürfte es eine Dichte von 39 bzw. 34 Einwohnern pro km2 gegeben haben57. Zu ihrer gesellschaftlichen Gliederung hat sich Karl selbst geäußert. Überliefert ist seine Aussage, es gebe nur Freie oder Unfreie: non est amplius nisi liber et servus58. Tatsächlich entspricht dies – fast – der Lex Salica, für die der vollberechtigte Franke der Freie (ingenuus, Francus) ist; sie erwähnt zwar noch Halbfreie (liti, leti, lidi), scheint aber den Adligen nicht zu kennen59. Die strikte Scheidung, die Karl der Große artikulierte, spiegelt aber nicht den Alltag wider. Denn die Sozialverfassung jener Zeit ist viel differenzierter und in Anbetracht zahlreicher Freilassungen auch flexibler zu sehen60. Die Gesellschaft der Karolingerzeit war nicht statisch, sondern steten Veränderungen unterworfen. Am besten erfasst sie ein Schichtenmodell, das freie Ober- und Mittelschichten von unfreien Unterschichten absetzt, anders ausgedrückt: Adel, Freie und Unfreie voneinander unterscheidet, wobei sich wiederum innerhalb einer jeden Schicht Gruppen bilden konnten. Was die Freiheit ausmacht, konnte allerdings erst die Scholastik definieren. Vorher kennzeichnete den Freien, dass er eine Reihe von Rechten besaß, die dem Unfreien vorenthalten blieben: Er konnte über sich selbst bestimmen, besaß Bewegungsfreiheit, verfügte über sein Eigentum und kämpfte im Krieg mit dem Schwert. Aber einzelne dieser Rechte konnten auch dem Unfreien verliehen werden, so dass es für den Historiker kaum möglich ist, eine klare Grenze zwischen Freien und Unfreien zu ziehen; man sollte vielmehr von einer Übergangszone ausgehen.
Die Oberschicht bildete sich aus dem seit Ende des 6. Jahrhunderts belegten fränkischen Adel, dessen Angehörige in den Quellen Bezeichnungen wie maiores, meliores, optimates oder sogar principes tragen61. Im 7. Jahrhundert war er mit dem römischen Senatorenadel verschmolzen. Sie versehen die wichtigsten Funktionen, sind zunächst landschaftlich gebunden, erwerben und vererben dann aber im gesamten Reich Besitz, so dass Gerd Tellenbach von einer „Reichsaristokratie“ sprechen konnte62. An der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert ist ihr Besitz weit gestreut, wir dürfen von einer großen Besitzmobilität ausgehen. Die Nähe zum König ist für den Adel ein Weg, das soziale Prestige zu steigern und politischen Einfluss zu gewinnen. Sie trägt mit dazu bei, die Adelsschicht zu differenzieren.
Ein breites Spektrum deckt die freie Mittelschicht ab, die liberi homines63. Nähere Aufschlüsse über sie gewähren uns die Kapitularien, vor allem solche, die den Heeresdienst betreffen. Aus dieser Quellengruppe können wir die Erkenntnis ableiten, dass es innerhalb der Freien eine große Bandbreite gab, die vom Bauern, der nur einen mansus besaß – darunter ist um das Jahr 800 die Wirtschaftseinheit eines Bauern und seiner Familie zu verstehen –, bis zum Inhaber einer Grundherrschaft reichte, die mehr als 1000 Mansen umfassen konnte. Diese Bauern verfügten über Eigenbesitz, Allod. Darüber hinaus gab es auch Freie, die sich in lehnsrechtlicher Abhängigkeit befanden, oder Freie, die über gar kein Land verfügten. Die Reihe lässt sich noch verlängern, etwa um die Aprisionäre, Flüchtlinge aus dem von den Arabern beherrschten Spanien, die Karl der Große in den Grenzregionen zu deren Sicherung ansiedelte. Festzuhalten ist, dass die freien Mittelschichten seit der Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert vermehrt unter Druck gerieten, der von den großen Grundherrschaften ausgelöst wurde, für den aber auch die zunehmenden Militärlasten verantwortlich zu machen sind: Das Merkmal der Freiheit, der Kriegsdienst, wurde zu einem Problem. Aus Not traten viele liberi in die Abhängigkeit eines Mächtigen ein und verloren so ihren freien Stand.
Auch die Gruppe der Unfreien ist durch eine große Differenziertheit charakterisiert64. Sie umfasste den Bauern, der innerhalb einer Grundherrschaft einen Hof bewirtschaftete, aber auch das mindere Gesinde, das uns in den Pertinenzformeln fränkischer Urkunden als mancipia, wie bloßes Zubehör, begegnet und oftmals im Betrieb eines Unfreien arbeiten musste. Als niedrigste Tätigkeit galt die des Knechts eines Schweinehirten. Waren diese Personen schollengebunden, so gab es auch solche, die frei gehandelt und verkauft wurden, also regelrechte Sklaven, die sich zahlenmäßig allerdings kaum fassen lassen. Sie waren vor allem für das Ausland bestimmt, doch lässt sich fränkischen Urkundenformularen entnehmen, dass selbst innerhalb des regnum Francorum Handel mit ihnen getrieben wurde.