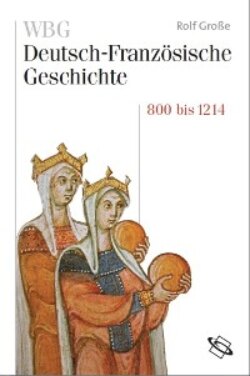Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. I - Rolf Große - Страница 15
Die kulturelle Entwicklung
ОглавлениеUntrennbar mit dem Namen Karls des Großen verbunden ist die sogenannte Karolingische Renaissance77. Dem Kaiser gelang es nicht nur, sein Reich politisch zu formen; die von ihm eingeleitete Bildungsreform vermittelte auch dem Geistesleben wichtige Impulse, die bis heute fortwirken. Es vermag kaum zu überraschen, wenn uns sein Biograph Einhard sehr lebendig schildert, in welchem Maße Karl auch an seiner eigenen Bildung gelegen war78:
„Die edeln Wissenschaften pflegte er mit großer Liebe, die Meister in denselben schätzte er ungemein und erwies ihnen hohe Ehren. In der Grammatik nahm er Unterricht bei dem greisen Diakon Petrus von Pisa, in den übrigen Wissenschaften ließ er sich von Albinus, mit dem Beinamen Alkoin, ebenfalls einem Diakon, unterweisen, einem in allen Fächern gelehrten Mann, der von sächsischem Geschlechte war und aus Britannien stammte. In dessen Gesellschaft wandte er viel Zeit und Mühe auf, um sich in der Rhetorik, Dialektik, vorzüglich aber in der Astronomie zu unterrichten. Er erlernte die Kunst zu rechnen und erforschte mit emsigem Fleiß und großer Wißbegierde den Lauf der Gestirne. Auch zu schreiben versuchte er und pflegte deswegen Tafel und Büchlein im Bett unter dem Kopfkissen bei sich zu führen, um in müßigen Stunden seine Hand an das Nachmachen von Buchstaben zu gewöhnen. Doch hatte er mit seinem verkehrten und zu spät angefangenen Bemühen wenig Erfolg.“
Karls Bildungswillen drückte sich nicht nur in seinem vergeblichen Bemühen, schreiben zu lernen, aus, er sammelte auch eine reiche Hofbibliothek (die nach seinem Tod zum Besten der Armen verkauft wurde) und umgab sich in seiner Aachener Pfalz mit einem ausgewählten Kreis von Gelehrten79. Damit wirkte er traditionsbildend, denn auch seine Nachfolger zogen die geistige Elite in ihre Umgebung. Alkuin, der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit80, stellte den Gelehrtenkreis auf eine Stufe mit der platonischen Akademie in Athen und verlieh damit dem hohen Selbstverständnis des Zirkels Ausdruck. Die Mitglieder dieser Runde, die man etwas übertrieben als „Akademie“ bezeichnet, führten biblische oder antike Pseudonyme: Karl wurde als David bezeichnet, Alkuin als Flaccus, Angilbert als Homer, Hildebald von Köln als Mosesbruder Aaron und Einhard als Beseleel, nach dem alttestamentlichen Erbauer der Stiftshütte. Diesen Gelehrten kam auch die Aufgabe zu, selbst als Lehrer zu fungieren. Denn am Hof gab es eine (wohl mit der Kapelle verbundene) Schule81. Kinder und Enkel des Kaisers wurden in ihr ebenso unterrichtet wie die der hohen Amtsträger, ferner diente sie der Ausbildung des Nachwuchses für Kapelle und Kanzlei. Alkuin etwa war Privatlehrer Karls und seiner Töchter, bevor er sich in Tours ein neues Wirkungsfeld erschloss, ohne die Verbindung zur Herrscherfamilie abreißen zu lassen: Er unterhielt weiterhin brieflichen Kontakt mit Karls Töchtern, die damals im Kloster Chelles lebten, und führte so die Diskussion über theologische Fragen mit ihnen fort. Wir können daraus auf ein hohes Bildungsniveau auch der weiblichen Angehörigen der Königsfamilie schließen.
Wer die Hofschule durchlaufen hatte, dem standen die höchsten Ämter im Reich offen. Das bekannteste Beispiel ist Einhard, der vom Schüler zum engen Vertrauten des Kaisers aufstieg82. Aber Karl ging es nicht nur um die Ausbildung einer Elite. Er wollte das geistige Niveau in seinem Herrschaftsbereich allgemein heben und richtete Kathedral- und Klosterschulen ein, die wohl auch Kinder besuchen durften, die nicht für die geistliche Laufbahn bestimmt waren83. Auf diese Weise entstanden im ganzen Reich Bildungsinseln, die bedeutendsten in Köln, Mainz, Trier, Utrecht, Metz, Fulda, Corvey, Lorsch, Weißenburg, auf der Reichenau, in Sankt Gallen, Regensburg, Salzburg, Lyon, Reims, Orléans, Fleury, Saint-Denis, Saint-Martin in Tours, Corbie, Saint-Wandrille und Saint-Riquier84. Hier wurden Schüler in den septem artes liberales unterrichtet, den „sieben freien Künsten“. Zu ihnen zählen als Trivium Grammatik, Rhetorik und Dialektik, das Quadrivium bilden Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie.
Die Namensgebung der Mitglieder des Kreises um Karl den Großen zeigt, dass man sich an antiken Vorbildern zu orientieren suchte. Bildung beruht nicht zuletzt auf dem Überkommenen und sucht, es zu bewahren. Ihre wichtigste Funktion besteht im Wissen, dem Verständnis und der Vertiefung der christlichen Lehre. Das Christentum ist eine Schriftreligion, seine Grundlage die Heilige Schrift, und bei der Messfeier sind liturgische Texte zu befolgen. Das Latein der vorkarolingischen Epoche war jedoch einem allgemeinen Niedergang verfallen und von Elementen der Volkssprache durchsetzt. Es drohte, sich mit diesen zusammen aufzuspalten. Um zuverlässige theologische Texte zu erhalten, bemühte man sich deshalb unter Karl dem Großen um ein gereinigtes und normiertes Latein. Wenngleich man auch die heidnischen Autoren las, ging der größte Einfluss von der patristischen Literatur aus, vor allem den Kirchenvätern Augustinus, Gregor, Hieronymus, Ambrosius und Leo dem Großen. So formte man eine literarische Hochsprache, die sich von den romanischen Sprachen trennte85. Lateinunterricht wird zum wichtigsten Lehrgegenstand der Schulen, es bildet sich ein Kanon von Schulautoren. Dieses Schriftlatein benutzte man, um die Bibel sprachlich – orthographisch wie grammatisch – zu überarbeiten. In Tours schuf Alkuin einen sprachlich und in seinem Textaufbau gereinigten Bibeltext, während Theodulf von Orléans, ein Westgote, eine „wissenschaftliche“, kommentierte Version anfertigte86. Wir können sogar feststellen, dass sich das Skriptorium von Tours in karolingischer Zeit darauf spezialisierte, seine Bibelversion (wie auch die Vita des hl. Martin) zu verbreiten. Da christliche, aber auch heidnische antike Autoren der sprachlichen Orientierung dienten, wurden ihre Werke in großer Zahl kopiert und sicherten ihre handschriftliche Überlieferung. Bis zum Ende des 9. Jahrhunderts wurden circa siebzig lateinische Autoren und damit der größte Teil der antiken Klassiker abgeschrieben. Hinzu kamen noch lateinische Übersetzungen wichtiger griechischer Texte, etwa von Aristoteles oder Platon, deren Original nur noch wenige verstanden hätten. Es ist also den Karolingern zu verdanken, dass antikes Wissen nicht dem Vergessen anheim fiel. Karl dem Großen kam dabei eine tragende Rolle zu. An theologischen Diskussionen nahm er persönlichen Anteil, stets war er von Gelehrten umgeben. Zu Recht bezeichnet Rosamond McKitterick ihn als „Schirmherrn der Kultur“87. Er soll sogar gezielt nach wichtigen und seltenen Büchern gesucht haben, um sie abschreiben zu lassen. Die Kopien verdanken wir vor allem den Skriptorien nordfranzösischer, rheinischer und alemannischer Klöster. Aber die karolingischen Gelehrten rezipierten nicht nur, sondern waren selber auch wissenschaftlich aktiv, kommentierten die Bibel, diskutierten theologische Probleme, behandelten Themen der Grammatik oder Philosophie und verfassten Kompendien zu vielen Wissensbereichen.
Karl der Große nutzte seine Stellung, um die eigene geistige Neugierde zu befriedigen. Aber sein Interesse für die Wissenschaft resultierte auch und vor allem aus seinem herrscherlichen Selbstverständnis, das ihn dazu verpflichtete, den christlichen Glauben zu festigen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Bezeichnung „Karolingische Renaissance“ nicht ganz zutreffend ist. Denn der Rückgriff auf die Antike war keinesfalls ein Selbstzweck, die „Anstrengungen Karls“ zielten vielmehr „auf eine Reform der christlichen Gesellschaft“88, sie wollten Religion und Glauben auf ein sicheres Fundament stellen. In ihrem Kern war diese Renaissance also religiös motiviert. Deshalb spricht man besser von einem Neubeginn, einer Renovatio.
Das Bemühen, Regeln und Einheitlichkeit zu schaffen, schlug sich auch in der Schrift nieder89. Mit dem Ausgang des Römischen Reiches hatte die gemeinsame Schrifttradition ihr Ende gefunden. Es folgten nun regional geprägte Schriften, die sich bis ins 8. Jahrhundert durch Vielfalt auszeichneten. Minuskel, Unziale und Halbunziale wurden ebenso als Buchschrift verwendet wie die Kursive. Die Handschriften, die Karl für seine Bibliothek sammelte, vermittelten den Gelehrten an seinem Hof einen Überblick über die einzelnen Schriftprovinzen. Von ihnen zeichneten sich die Manuskripte aus Corbie durch eine stilisierte und in Einzelbuchstaben aufgelöste, gut lesbare Minuskel aus, die für eine unter Abt Maurdramnus hergestellte Bibel benutzt wurde und dementsprechend als Maurdramnus-Minuskel bezeichnet wird. Sie dürfte um oder vor 780 entwickelt worden sein; als ihr Kennzeichen gilt das aus der Halbunziale entstandene kleine „a“. Es ist durchaus möglich, dass sich benachbarte Skriptorien an ihr orientierten. Jedenfalls ließen auch Karl der Große und sein Hof dieser Schriftart ihre Förderung zukommen. So entstand allmählich die karolingische Minuskel, eine einfache und regulierte Schrift, die sich durch ihr Vierlinienschema und ihre Gleichmäßigkeit auszeichnet. Die einzelnen Buchstaben stehen isoliert nebeneinander und berühren sich nur hier und da, Abkürzungen sind selten. Seit den letzten Regierungsjahren Karls und besonders unter Ludwig dem Frommen verdrängt diese Minuskel die regionalen Stile. Da der Aachener Hof und sein Skriptorium für die Schreibschulen des Reiches Vorbildfunktion besaß und die kulturellen Zentren untereinander in Kontakt standen, konnte sich diese Schrift im ganzen Reich durchsetzen. In ihr fand das karolingische Imperium „eine gemeinsame graphische Ausdrucksform“90, die einen wesentlichen Beitrag zu seiner politischen, administrativen und kulturellen Integrationskraft leistete. Erst seit dem 12. Jahrhundert wurde die Minuskel von der gotischen Schrift verdrängt. Eine Wiederentdeckung sollte sie aber zur Zeit der Humanisten und der Renaissance erfahren. Da die meisten antiken Autoren durch die Abschriften karolingischer Skriptorien und damit in karolingischer Minuskel überliefert wurden, hielten die Humanisten diese Schrift (zu Unrecht) für die Schrift der Antike und kehrten zu ihr zurück. Durch diesen Irrtum wurde die Minuskel zur Grundlage unserer heutigen Schrift. Sie ist eine der dauerhaftesten kulturellen Leistungen der karolingischen Politik.
12 Karolus Magnus et Leo papa. Ein Paderborner Epos vom Jahre 799. Mit Beiträgen von Helmut BEUMANN, Franz BRUNHÖLZL, Wilhelm WINKELMANN, Paderborn 1966, S. 94f. Die Berechtigung dieser Bezeichnung unterstrich jüngst ERKENS 1999 [82], S. 9 und betonte, dass „noch ein Zeitgenosse der sog. Postmoderne in Karl dem Großen eine Europa prägende Gestalt sehen darf und das hochgestimmte Urteil des mittelalterlichen Dichters nicht verwerfen muss, sondern in beschriebenem Sinne geneigt bleibt, in dem Karolinger tatsächlich einen pater Europae, einen Vater des lateinisch-abendländischen Europa, oder anders ausgedrückt: einen Baumeister Europas zu sehen“.
13 Den besten Überblick zur Frühgeschichte der Franken bieten jetzt PRINZ 2004 [53], S. 286–293 sowie EHLERS 2004 [14], S. 24–39. Vgl. auch EWIG 42001 [21], S. 9–14. – Wenn wir im Folgenden vereinzelt den Begriff „Germanen“ benutzen, so ist uns natürlich bewusst, dass es ein germanisches Volk nicht gegeben hat und gemeingermanische Phänomene selten sind. Statt dessen verwenden wir, wo eben möglich, die Namen der einzelnen Völkerschaften.
14 Die Karte ist abgebildet bei REVERDY 1986 [104], S. 18f.
15 Zur Bezeichnung „Sachsen“ in der Spätantike siehe SPRINGER 2004 [111], S. 32–46.
16 Vgl. EWIG 42001 [21], S. 18–31.
17 Siehe die Karte ebenda, S. 26f.
18 Zur 1500-Jahr-Feier des Gedächtnisses der Taufe fand bereits 1996 ein großes Kolloquium in Reims statt. Auf diesen Tagungsband sei hier eigens verwiesen: ROUCHE 1997 [106].
19 Vgl. EWIG 1965 [84], S. 275–278. Zum Werden des Frankenreichs siehe auch SCHIEFFER 2002 [107], S. 100–104.
20 Die neuesten Ergebnisse zur Erforschung Neustriens finden sich in dem zweibändigen von ATSMA 1989 [115] herausgegebenen Werk.
21 Karls Expansionspolitik wird behandelt in den Biographien des Kaisers von FAVIER 1999 [127], S. 215–259, BECHER 22000 [118], S. 40–74 und HÄGERMANN 2000 [138], S. 200–333. Siehe ferner SCHIEFFER 2002 [107], S. 70–89. Die drei genannten Karlsbiographien sind auch sonst heranzuziehen. Das folgende Zitat bei SCHIEFFER 2005 [108], S. 16.
22 Zur Geographie des karolingischen Imperiums vgl. vor allem die beiden Abhandlungen von EWIG 1965 [84] und SCHLESINGER 1965 [109].
23 Einhard, Leben Karls des Großen, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, neubearb. von Reinhold RAU, Bd. 1, Darmstadt 1987, S. 183–185, Kap. 15.
24 Vgl. SCHULZE 1987 [60], S. 211f. Zur Eroberung des Langobardenreichs und zur Kaiserkrönung siehe jetzt SCHIEFFER 2005 [108], S. 100–110.
25 Zum Kaisertitel siehe CLASSEN 1952 [78].
26 Auch zu diesem Themenkreis finden sich einschlägige Aufsätze in BRAUNFELS 1965 [6], Bd. 1. Zu Spanien sind die Ausführungen von VONES 1993 [113], besonders S. 52–63, grundlegend. Wichtige Hinweise, vor allem zur Entwicklung der Grenzen im Laufe von Mittelalter und Neuzeit, bieten die von DEMANDT 1990 [80], POHL, WOOD, REIMITZ 2001 [102] und ABULAFIA, BEREND 2002 [72] herausgegebenen Sammelbände.
27 Vgl. JANKUHN 1965 [94]. Die neuere Literatur bei SCHIEFFER 2005 [108], S. 67f.
28 Einen Überblick zur Geschichte des Danewerks bietet der Artikel von ANDERSEN 1984 [74].
29 Vgl. HELLMANN 1965 [91] sowie DEÉR 1965 [79], ferner KLEBEL 1928 [96], AUBIN 1934 [75], HARDT 2001 [89] und jetzt SCHIEFFER 2005 [108], S. 63–67.
30 Vgl. WERNER 1995 [645], S. 37.
31 ALEXANDRE 1987 [73].
32 Siehe die Karte bei NELSON 1992 [226], S. 316f.
33 Einen konzisen Überblick zur geographischen Beschaffenheit Frankeichs bietet EHLERS 1987 [16], S. 13f.; siehe auch WERNER 1989 [70], S. 69–77.
34 Zu den geographischen Gegebenheiten der rechtsrheinischen Gebiete vgl. HAVERKAMP, in: PRINZ 2004 [53], S. 49–56.
35 Aus der umfangreichen Literatur zur Verfassung sei hier nur auf die Darstellung von SCHULZE 1987 [60], S. 214–221, DERS. 1992–1998 [154] sowie auf SCHIEFFER, in: SCHIEDER 1976 [54], Bd. 1, S. 560–568 verwiesen. Vgl. jetzt auch SCHIEFFER 2005 [108], S. 114–125.
36 Die jüngste Publikation zur Sakralität ist der von ERKENS 2002 [249] herausgegebene Band. Immer noch lesenwert sind die Beiträge in MAYER 1956 [826]; siehe auch NELSON 1980 [148].
37 SEMMLER 2003 [259 und 260].
38 Kritisch äußerte sich jüngst ERKENS 2004 [125].
39 Zu den Treueidleistungen, die Karl der Große anordnete, siehe BECHER 1993 [117].
40 So SCHIEFFER 2005 [108], S. 117. Zum Pfalzensystem vgl. BRÜHL 1975–1990 [123] sowie BARBIER 1990 [116]. Der Erforschung der deutschen Königspfalzen widmet sich das Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte.
41 Hinkmar von Reims, De ordine palatii (Hincmarus De ordine palatii), hg. und übersetzt von Thomas GROSS, Rudolf SCHIEFFER, München 1980. Vgl. NELSON 1992 [226], S. 43–50.
42 Die karolingische Hofkapelle wurde eingehend behandelt von FLECKENSTEIN 1959 [129], Bd. 1.
43 Vgl. zu ihr BOSHOF 1996 [207], S. 129–134.
44 Einen guten Einblick in diese Quellengattung gewährt das Buch von GANSHOF 1961 [136]. Siehe auch MORDEK 1986 [146].
45 Erste Hinweise zu Benedictus Levita bietet FUHRMANN 1994 [132].
46 Vgl. zu ihnen WERNER 1980 [159], S. 112–122.
47 Ebenda, S. 121–123.
48 Vgl. KASTEN 2001 [143]. Zur regna-Struktur siehe unten, S. 164f.
49 SCHIEFFER 32000 [55], S. 95.
50 Siehe oben, S. 21f.
51 Den besten Einstieg in diese Thematik gewähren nach wie vor die von Eugen EWIG verfassten Kapitel in: JEDIN 1973 [39], Bd. III/1, S. 62–143 sowie SCHIEFFER, in: SCHIEDER 1976 [54], Bd. 1, S. 568–579; vgl. jetzt auch SCHIEFFER 2005 [108], S. 125–132.
52 Zu Bonifatius siehe die klassische Biographie von SCHIEFFER 1954 [323]. Die neuere Literatur ist bei SCHIEFFER 2005 [108], S. 23f., 34–37 verzeichnet.
53 Einhard, Leben Karls des Großen, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, neubearb. von Reinhold RAU, Bd. 1, Darmstadt 1987, S. 207, Kap. 33.
54 VON RANKE 1889 [103], S. 236: „Frankreich und Deutschland bildeten ein einziges Ganzes, in welchem das germanische Element überwog, ohne doch das romanische zu unterjochen.“
55 Zur Bevölkerungsgeschichte ist der von HERRMANN, SPRANDEL 1987 [92] herausgegebene Band zu konsultieren. Vgl. auch die Bemerkungen von SCHULZE 1987 [60], S. 213 und SCHNEIDER 42001 [57], S. 134–137.
56 Zum Folgenden vgl. SCHLESINGER 1965 [109], S. 802–805, HAVERKAMP, in: PRINZ 2004 [53], S. 56–59 und jetzt SCHIEFFER 2005 [108], S. 69–73.
57 So VERHULST 1989 [166], Sp. 723.
58 Zur sozialen Gliederung der Karolingerzeit wie auch den Forschungskontroversen siehe SCHNEIDER 42001 [57], S. 73–84, 137–149. Die Aussage Karls des Großen ist ebenda, S. 75 zitiert. Vgl. SCHIEFFER 2005 [108], S. 93–96.
59 Vgl. Lex Salica, ed. Karl August ECKHARDT, in: MGH Leges nationum Germanicarum, Bd. 4/2, Hannover 1969 (Register).
60 Dieses Problem diskutiert NEHLSEN-VON STRYCK 1987 [147].
61 Zum Adel vgl. IRSIGLER 1969 [142].
62 TELLENBACH 1943 [843].
63 SCHMITT 1977 [153]; SCHNEIDER 42001 [57], S. 78f., 142–145.
64 Wichtige Hinweise bietet RÖSENER 1991 [777]; vgl. auch SCHNEIDER 42001 [57], S. 79f.
65 Zum Stand der Erforschung des römischen Straßensystems vgl., mit zahlreichen Literaturhinweisen, SCHNEIDER 1982 [110]. Siehe ferner ROUCHE 1982 [174] und SZABO 1984 [112].
66 Vgl. HEIMANN 1999 [90], S. 421.
67 Notker, Taten Karls, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, neubearb. von Reinhold RAU, Bd. 3, Darmstadt 1964, S. 366f., Kap. I/30.
68 Zum Unterhalt der Römerstraßen siehe CHEVALLIER 1997 [77], S. 274–291.
69 Beispiele dafür finden sich bei FRAY 1997 [86].
70 CHEVALLIER 1997 [77], S. 303f.
71 Vgl. REVERDY 1986 [104], S. 11–15, KÖNIG 1997 [97] und vor allem CHEVALLIER 1997 [77], S. 200–228.
72 Siehe die Karte bei REVERDY 1986 [104], S. 12.
73 Eine instruktive Einführung bietet PAULI 1980 [99], S. 219–266. Siehe auch den Artikel von PEYER 1980 [101] sowie den Aufsatz von RINGEL 1997 [105].
74 CHEVALLIER 1997 [77], S. 286–288.
75 Eine Übersicht über die wichtigsten Verkehrswege im mittelalterlichen Deutschland gewährte bereits GÖTZ 1888 [168], S. 547–554.
76 Vgl. HEIMANN 1999 [90], S. 418–421.
77 Zahlreiche Beiträge zu diesem Themenkomplex finden sich in BRAUNFELS 31967 [6], Bd. 2. Maßgeblich ist jetzt EHLERS 2002 [188], S. 177–188, DERS. 2004 [14], S. 57–65, ferner MCKITTERICK 1999 [196] und STEVENS [203]. Für einen ersten Überblick siehe SCHIEFFER, in: SCHIEDER 1976 [54], Bd. 1, S. 571–576, SCHULZE 1987 [60], S. 274–296, BRUNHÖLZL 1997 [184], SCHIEFFER 32000 [55], S. 98f. sowie DERS. 2005 [108], S. 132–136. Immer noch lesenswert ist die Studie von FLECKENSTEIN 1953 [189].
78 Einhard, Leben Karls des Großen, in: Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte, neubearb. von Reinhold RAU, Bd. 1, Darmstadt 1987, S. 197, Kap. 25.
79 BISCHOFF 1965 [177]; VON DEN STEINEN 31967 [202].
80 Aus der umfangreichen Literatur zu Alkuin sei auf den Sammelband von HOUWEN, MCDONALD 1998 [190] verwiesen.
81 BRUNHÖLZL 31967 [182].
82 Zu Einhard siehe jetzt SCHEFERS 1997 [199].
83 Das Schulwesen behandelt RICHÉ 21967 [198].
84 Vgl. die Aufzählung bei EHLERS 2002 [188], S. 178 Anm. 3, 181f.
85 Die Charakteristika des Mittellateins werden vorzüglich in dem schmalen Band von LANGOSCH 51988 [191] dargelegt.
86 MCKITTERICK 1999 [196], S. 668f.
87 Ebenda, S. 683.
88 EHLERS 2002 [188], S. 186.
89 Zur Schriftgeschichte vgl. BISCHOFF 32004 [179] und SCHMID 1999 [201].
90 SCHMID 1999 [201], S. 681.