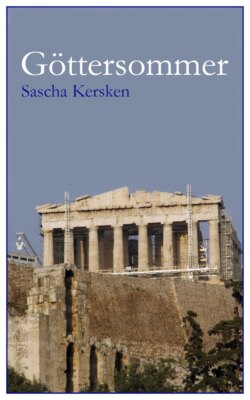Читать книгу Göttersommer - Sascha Kersken - Страница 6
4
ОглавлениеIn zehn Minuten würde die heutige Verhandlungsrunde beginnen. Kostas Mavridis warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel über dem Waschbecken. Er richtete den Kragen seines krawattenlosen Hemds und zog sein Jackett gerade. Er nahm seinen Laptop-Rucksack von einem Kleiderhaken neben der Ausgangstür, hängte ihn sich über eine Schulter und verließ dann die Herrentoilette hinter dem Sitzungssaal. Auf dem Gang standen Verhandlungsteilnehmer in kleinen Grüppchen zusammen. Er nickte manchen knapp zu und ging an anderen vorbei. Seine Kollegin Maria Georgiadou und ihren Assistenten Nikos Periklidis begrüßte er freundlich.
„Das wird genau so ein Reinfall wie gestern“, sagte Maria missmutig.
„Da könntest du Recht haben“, meinte Kostas. „Wenn wir nicht zu allem, was sie uns vorsetzen, Ja und Amen sagen, werden diese Verhandlungen nie enden – oder platzen. Und ich habe absolut keine Lust, Ja oder Amen zu sagen“.
Er sah auf die Uhr. Acht Minuten noch. „Entschuldigt mich bitte.“
Er ging durch die Glastür auf der anderen Seite des Ganges und trat auf den Balkon. Aus der Innentasche seines Jacketts zog er eine Zigarettenschachtel und ein Feuerzeug. Er entnahm der Packung eine Zigarette, steckte sie in den Mund und versuchte, sie anzuzünden, aber sein Feuerzeug funktionierte nicht. Er sah sich unter den wenigen anderen Rauchern um, die sich um die beiden großen Aschenbecher links und rechts der gläsernen Doppeltür gruppierten.
Da war diese Französin von der EZB, die ihn immer an seine strenge Mathematiklehrerin erinnerte – Dupont? Dujardin? Ach nein, Dugard, das war es. Sie hatte in den vergangen Tagen besonders harte Positionen vertreten, war zu keinem Kompromiss bereit und stellte die weitere Kreditvergabe an Griechenland sogar insgesamt in Frage, unabhängig von der Spar- und Reformbereitschaft seiner Delegation. Sie rauchte eine sehr dünne Zigarette mit weißem Filterstück.
„Verzeihung, hätten Sie vielleicht Feuer?“, fragte Kostas sie auf Englisch. Sie hielt ihm wortlos ihr elegantes Metallfeuerzeug entgegen und zündete die Flamme. Kostas zündete seine eigene Zigarette daran an und bedankte sich.
Er nahm einige Züge, drückte die Zigarette dann aus und ging wieder hinein. Die anderen Raucher begannen ebenfalls aufzubrechen. Er durchschritt den Gang und betrat den großen Sitzungssaal. Die Fensterfront, welche die gesamte Seite gegenüber der Eingangstür einnahm, war mit weißen Lamellenvorhängen bedeckt, um die Sonne abzuhalten. Um den großen, ovalen Tisch standen etwa dreißig bequeme Bürosessel, darauf standen in kleinen Gruppen Mineralwasserflaschen, Thermoskannen mit Kaffee und Tee, Tassen, Gläser und etwas Gebäck.
An jedem Platz stand ein Pappaufsteller mit dem Namen eines Verhandlungsteilnehmers – auf der Türseite die griechische Delegation, gegenüber die internationalen Vertreter. Maria Georgiadou war zur Sitzungsleiterin gewählt worden, deshalb befand sich ihr Platz an einem der schmäleren Tischenden. Vor den Namensschildern lagen jeweils ein kleiner Notizblock und ein blauer Kunststoffkugelschreiber, auf dessen Clip „Athens Conference Lounge“ stand – das Kongresszentrum in der Nähe des Omonia-Platzes, in dessen siebter Etage die Verhandlungen stattfanden.
Viele Teilnehmer saßen bereits auf ihren Plätzen, andere betraten den Saal gleich hinter Mavridis. Dieser zog seinen Stuhl zurück, der auf fünf Rollen geschmeidig über den geschmackvollen hellgrauen Teppichboden glitt, stellte den Rucksack vorsichtig auf dem Boden ab und setze sich. Er klickte die Mine des Kugelschreibers heraus und schlug den Notizblock auf. Links oben auf der ersten Seite notierte er das Datum, das er aus der freien Hand sehr akkurat unterstrich. Anschließend holte er seinen etwas in die Jahre gekommen Laptop und das Netzteil aus dem Rucksack, steckte letzteres in die Steckdosenleiste in der Tischmitte und schaltete den Rechner ein.
Der Vibrationsalarm seines lautlos geschalteten Mobiltelefons meldete sich. Er zog es aus der linken Hosentasche, entsperrte es mit einer Wischgeste und gab den Sicherheitscode ein. Eine Textnachricht seiner Frau Christina: „Viel Erfolg, mein Schatz. Fahre zu Irini, komme in 3-4 Tagen zurück. Melde mich, wenn ich da bin. HDL“. Irini war die jüngere Schwester seiner Frau. Sie lebte mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Grundschulalter in Thessaloniki und litt unter Multipler Sklerose. Seit ihre Mutter vor einem Jahr gestorben war, fuhr Christina des Öfteren hin, um ihr zur Hand zu gehen, wenn neue Krankheitsschübe ihr den Alltag erschwerten.
„Fahr vorsichtig und grüß alle! HDL“, textete Kostas zurück. Er sperrte das Telefon wieder und ließ es zurück in seine Hosentasche gleiten. Inzwischen waren die übrigen Verhandlungsteilnehmer eingetroffen. Die Tür wurde geschlossen, und Maria eröffnete die Sitzung. „Guten Morgen“, sagte sie knapp und schaltete den Videoprojektor ein, der den Bildschirminhalt ihres Laptops an der Wand hinter ihr anzeigte: eine schmucklose weiße Seite mit einer englischsprachigen, nummerierten Liste.
„Hier sehen Sie die für heute geplante Tagesordnung“, erklärte Maria. „Das Oberthema am Vormittag sind die besonders von der EU-Kommission“ – sie wies auf die vier Vertreter dieses Gremiums – „geforderten Privatisierungen von Staatsbetrieben in einem Volumen von bis zu fünfzig Milliarden Euro. Nach der Mittagspause wird es eine Rekapitulation der Positionen aller beteiligten Delegationen geben. Haben Sie Fragen oder Anträge zur Tagesordnung?“
Ein blonder Mann in einem eleganten Anzug, der an den vergangenen drei Verhandlungstagen recht unauffällig gewesen war, hob die Hand. Er saß fast genau gegenüber von Kostas; auf seinem Namensschild stand „Norbert Voss, European Commission“.
„Herr Voss?“, rief Maria ihn auf.
„Ich beantrage, dass wir die Tagesordnung heute Nachmittag ändern. Es gibt interessante neue Erkenntnisse – zumindest für mich sind sie neu. Diese möchte ich mit Ihnen allen teilen, und ich werde jemanden als Zeugen mitbringen.“
„Können Sie uns Genaueres dazu sagen?“, fragte Maria.
„Nur so viel“, antwortete Voss, „es gab auch in der Vergangenheit, sagen wir mal, Interaktion zwischen Griechenland und meinem Land. Ich glaube, diese muss man einfach in Betracht ziehen, wenn man die heutige Situation gerecht beurteilen will.“
Seine EU-Kollegen schauten etwas ratlos und ungläubig in seine Richtung. Maria hielt kurz inne und fragte dann: „Wer ist für diese Änderung der Tagesordnung? Ich bitte um Handzeichen.“
Kostas überlegte kurz, denn er konnte sich keinen Reim auf das machen, was Voss sagte. Dann dachte er sich, dass der Freitagnachmittag so nur interessanter werden konnte, und hob die Hand, genau wie alle anderen Teilnehmer der griechischen Delegation. Auch auf der Gegenseite gingen zögerlich erst wenige und dann immer mehr Hände nach oben. Schließlich kam eine knappe Mehrheit zusammen.
„Der Vorschlag ist mit 18 zu 13 Stimmen angenommen“, resümierte Maria.
„Das dürfte interessant werden“, meinte ein leicht ergrauter Brite, der einen Dreiteiler und eine randlose Brille trug. „Dustin R. Graham, International Monetary Fund“ stand auf seinem Schild.
Der Vormittag zog sich hin. Die Privatisierungsdebatte war langweilig, technokratisch, und eigentlich war allen Beteiligten klar, dass fünfzig Milliarden Euro vollkommen unrealistisch waren. Kostas und die anderen Vertreter der griechischen Seite waren ohnehin keine großen Freunde von Privatisierungen, und auch viele Verhandlungsteilnehmer der Gegenseite hielten sich zurück. Besonders auffällig war dies bei Madame Dugard, für die Privatisierungen bis zum Vortag ein Allheilmittel gewesen zu sein schienen.
Kostas selbst wiederholte nur seine bekannte Position: „Wie wir alle wissen, bedeutet Privatisierung für die Kunden praktisch immer schlechteren Service und höhere Preise. Inzwischen sehen manche Länder das ein und versuchen, Privatisierungen rückgängig zu machen. Der neuseeländische Staat hat beispielsweise die privatisierte Eisenbahn zurückgekauft, weil die Investoren trotz hoher Subventionen das Streckennetz verfallen ließen, zahlreiche unrentable Strecken stilllegten und massiv die Fahrpreise erhöhten. Es ist nicht hinzunehmen, einem Volk, dem ohnehin die Löhne und Renten gekürzt werden, auch noch das Staatseigentum wegzunehmen und sie für schlechtere Leistungen mehr zahlen zu lassen. Also, wie ich bereits mehrfach erwähnte: ich bin entschieden gegen Privatisierungen.“
Luc Verheyen, der belgische Vertreter der EU-Kommission, hielt dagegen: „Aber Herr Kollege, mit Verlaub, das sind doch Räuberpistolen! Bloß weil Neuseeland bei der Bahnprivatisierung auf die falschen Firmen gesetzt hat, ist doch nicht das Konzept als solches schlecht. Staaten können Investitionen gar nicht mehr in dem Umfang tätigen, in dem sie für eine moderne Infrastruktur benötigt werden.
Beispielsweise hat nur die in fast ganz Europa durchgeführte Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts zum Auf- und Ausbau schneller Mobilfunkverbindungen, Internetzugänge und Glasfasernetze geführt. Wären die Netze in staatlicher Hand verblieben, dann würden wir noch heute Wählscheibentelefone benutzen und uns mit Akustikkopplern ins Netz einwählen.
Außerdem muss man sich Staatsbetriebe erst mal leisten können. Und ein Land, das so sehr über seine Verhältnisse gelebt hat wie Griechenland, kann das nun einmal nicht. Also verstehe ich nicht, warum wir bei diesem Thema immer wieder eine Grundsatzdiskussion führen müssen. Sie können gar nicht anders, als zu privatisieren – es geht nur noch darum, was am besten privatisiert wird und wie wir den maximalen Profit damit herausholen können.“
Darauf wussten Kostas und die anderen Vertreter Griechenlands nichts mehr zu sagen. Also hörten sie sich wortlos einen trockenen Vortrag von Victoria Hollister an, einer Amerikanerin, die in der Risikobewertung beim IWF arbeitete und die verschiedenen griechischen Staatsbetriebe nach Rentabilität und möglichem Verkaufswert aufschlüsselte. Zusammenfassend sagte sie schließlich: „Die höchsten Erlöse sind unseres Erachtens vom Verkauf der Flughäfen zu erwarten, die zweithöchsten von den Schiffshäfen. Bevor diese keine Käufer gefunden haben, ist der Rest die Mühe nicht wert. Es gibt ernst gemeinte Angebote, sowohl von privaten Investoren als auch von Staatsbetrieben anderer Länder. Letzteres könnte vielleicht ein Kompromiss für nostalgische Europäer sein, die staatliche Infrastrukturbetreiber bevorzugen. Die Infrastruktur wäre dann immer noch staatlich, würde aber eben von einem anderen Staat betrieben.“
So und ähnlich ging es den ganzen Vormittag hin und her, bis Maria schließlich die Mittagspause ansagte. Sie ging mit Kostas, Nikos und dem Rest der griechischen Delegation in ein nahe gelegenes Restaurant. Kostas schlang irgendetwas hinunter und konnte sich hinterher nicht einmal mehr erinnern, was er gegessen hatte.
Wenig später kamen die Verhandlungsteilnehmer wieder im Sitzungssaal zusammen. Nur Norbert Voss, der sich durch die Änderung der Tagesordnung zur Hauptperson des Nachmittags gemacht hatte, fehlte noch. Maria schaute auf das Display ihres Laptops. „Wir geben ihm noch fünf Minuten“, sagte sie, „ansonsten werden wir wieder zur ursprünglich geplanten Tagesordnung zurückkehren.“
Doch etwa drei Minuten später kam Voss herein. In seiner Begleitung befand sich ein alter, langsam und gebückt gehender Mann. Dieser war glatt rasiert und trug einen einfachen, aber sauberen und ordentlichen Anzug. Norbert überließ ihm seinen eigenen Stuhl und stellte sich dahinter. „Bitte entschuldigen Sie die Verspätung“, sagte er. „Darf ich Ihnen unseren Gast vorstellen? Das ist Alexandros Karagiannis. Er ist siebenundsiebzig Jahre alt und möchte uns seine Geschichte erzählen. Darf ich einen unserer griechischen Kollegen bitten, für uns zu dolmetschen?“
Kostas erklärte sich bereit, die Ausführungen von Karagiannis ins Englische zu übersetzen, aber dieser meinte: „Nicht nötig. Ich kann ausreichend Englisch.“
Er begann, zunächst etwas steif und stockend, aber dann immer flüssiger und lebendiger, zu erzählen.
„Im Sommer 1944“, begann er, „wurde mein Heimatdorf von der deutschen Wehrmacht überfallen. Insgesamt etwa hundert Soldaten, mit Maschinengewehren bewaffnet, marschierten in jedes Haus und erschossen so gut wie alle Erwachsenen, aber auch viele Kinder. Selbst Säuglinge in den Armen ihrer Mütter wurden einfach mitermordet.
Ich selbst war damals sechs Jahre alt und beobachtete aus einem Versteck, wie sie in alle Häuser stürmten, ich hörte die Maschinengewehrsalven und die Todesschreie. Wenn ich die Augen schließe oder wenn ich nachts wach liege und nicht schlafen kann, höre ich sie immer noch, immer wieder.
Nachdem die Soldaten wieder weggefahren waren, lief ich zu unserem kleinen Haus. Ich fand meine beiden Eltern tot vor. Meine dreijährige Schwester Anna war zu dem Zeitpunkt glücklicherweise bei unserer Tante im Nachbardorf, sonst hätten sie womöglich auch ihrem jungen, unschuldigen Leben ein Ende gesetzt.“ Bei diesem Satz wischte er sich eine Träne aus dem Gesicht.
„Diese Tante“, fuhr er fort, „hat dann auch mich aufgenommen und sich liebevoll um uns beide gekümmert, obwohl sie selbst drei Kinder hatte und kaum über die Runden kam, denn ihr Mann war in ein deutsches Gefangenenlager verschleppt worden und ist dort schließlich umgekommen.
Bis heute haben meine Schwester und ich und all die anderen Überlebenden nicht einen einzigen Cent Entschädigung von Deutschland erhalten. Es hieß, das Ganze sei im Rahmen der Nachkriegsverhandlungen pauschal abgegolten worden.“
Nach diesem Vortrag herrschte betretenes Schweigen in der Runde. Doch dann räusperte sich Luc Verheyen und sagte: „Das ist gewiss eine tragische und rührende Geschichte. Aber eins verstehe ich nicht: was hat sie mit der heutigen Situation zu tun? Inwiefern sollten Ereignisse, die vor über siebzig Jahren stattfanden, irgendeinen Einfluss auf die jetzigen Probleme Griechenlands haben?“
„Das will ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren“, meldete sich Voss zu Wort, der bisher ruhig zugehört hatte. „Sie alle wissen Bescheid über die Kriegsverbrechen Deutschlands, meines Heimatlandes. Meine Vorfahren haben zwei Weltkriege angezettelt, sie haben unermessliches Leid über die Völker Europas und der Welt gebracht, millionenfachen Genozid und unzählige weitere Gräueltaten verübt. Und doch gab es nach dem zweiten Weltkrieg keine strenge Bestrafung Deutschlands, sondern zumindest im Westteil des Landes Wiederaufbau durch den Marshall-Plan, der zum so genannten Wirtschaftswunder beitrug. Ein ‚Wunder’, das nebenbei gesagt auch durch die verbrecherische Übernahme jüdischer Betriebe – euphemistisch Arisierungen genannt – und die millionenfache Ausbeutung von Zwangsarbeitern möglich gemacht wurde.
Neben dem Marshall-Plan hat Deutschland auf einer Konferenz 1953 einen Schuldenerlass von 50% erhalten; dieser Maßnahme hat unter anderem auch Griechenland zugestimmt. Und nun kommen wir hierhin und verweigern einem Land, das all die genannten Verbrechen nicht begangen hat, sondern im Gegenteil zu dessen Opfern gehörte, eine ähnliche Hilfe.
Bis gestern hielt ich all das auch für richtig. Sehen Sie, ich stamme aus dem Schwabenland und habe gelernt, dass jemand, der Schulden macht, diese eben auch bezahlen muss. Aber angesichts der historischen Ereignisse, als deren Zeuge Herr Karagiannis hier in unserer Mitte sitzt, kann ich nicht länger an dieser Ansicht festhalten.
Hiermit stelle ich einen neuen Antrag: ich fordere einen Schuldenschnitt von 50% für Griechenland ohne Vorbedingungen, und zudem empfehle ich der Regierung meines Landes nachdrücklich, noch einmal eingehend darüber nachzudenken, ob die Reparationen für Griechenland und andere Länder, die Opfer des Nationalsozialismus wurden, wirklich abgegolten sind.“
Sein letzter Satz ging beinahe im entstehenden Tumult unter; alle redeten aufgeregt durcheinander. Schließlich schlug Maria mit der Faust auf den Tisch und sagte sehr laut: „Ruhe bitte! Angesichts dieser ungewöhnlichen Entwicklung vertage ich die Verhandlung hiermit auf kommenden Montag, wie üblich um 10 Uhr morgens. Das dürfte allen Delegationen genügend Zeit geben, sich abzusprechen und ihre Anträge geordnet vorzutragen.“ Damit schaltete sie den Videoprojektor ab, klappte ihren Laptop zu, verstaute ihn in ihrer Tragetasche und verließ den Sitzungssaal.
Die anderen Teilnehmer folgten in Gruppen, in denen weiter laut diskutiert wurde. Besonders Voss schien von seinen EU-Kollegen richtig in die Mangel genommen zu werden, bemerkte Kostas. Den armen Alexandros Karagiannis hatte man einfach sitzen lassen, also ging Kostas um den Tisch herum zu ihm und sagte: „Kann ich Sie vielleicht irgendwohin mitnehmen, Herr Karagiannis?“
„Gern, junger Mann“, antwortete dieser. „Ich arbeite und wohne in einer kleinen Pension in einem Vorort.“