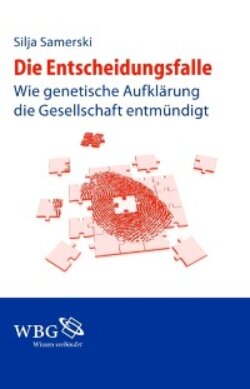Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 17
3.1.1 Der genetische Mensch
ОглавлениеAuf welche Weise Genetiker ihre Zuhörer und Gesprächspartner umdeuten, wenn sie diese über Gene belehren, zeigt das Beispiel einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in Hannover. Der Leiter des hannoverschen Institutes für Humangenetik, Jörg Schmidtke, hat es sich zur Aufgabe gemacht, verzerrte Gen-Vorstellungen in der Öffentlichkeit geradezurücken59. Er ist enttäuscht darüber, dass es bisher nicht gelungen sei, „die Rolle der Gene im menschlichen Leben“ angemessen zu vermitteln. Nun will er seine Mitbürger genetisch aufklären.60
Gleich zu Beginn seiner Rede weist Schmidtke seine Zuhörer darauf hin, dass sie Gegenstand seiner Expertise sind: Er spreche von der „Spezies Mensch, der wir alle angehören“, stellt er klar. Innerhalb dieser Art gebe es nur geringfügige genetische Unterschiede, führt er weiterhin aus. Mit diesen Sätzen steckt er den Rahmen des Zusammentreffens ab. Zunächst einmal vereinnahmt er alle Anwesenden, ob sie wollen oder nicht, zu einem umfassenden, globalen und unentrinnbaren „Wir alle“ als „Spezies Mensch“. Dann schwingt er sich zum Experten über dieses biologische „Wir“ auf, indem er den Menschen zum Genträger erklärt. Seine Zuhörer spricht er nicht als ebenbürtige Gesprächspartner an, sondern als Mitglieder einer biologischen Art, über die er wissenschaftlich autorisierte Erkenntnisse vorzuweisen hat. Die Menschen im Publikum sind zwar Adressaten seiner Ausführungen, aber gleichzeitig auch Objekte seines Fachwissens. Einspruch oder Widerrede des Common Sense haben keinen Platz. Als Genetiker weiß nur er über Genträger Bescheid: also auch über diejenigen, die als Publikum vor ihm sitzen. Eine gemeinsame Gesprächsebene kann es daher nicht geben.
Als Psychogenetiker ist Schmidtke auf der Suche nach „verhaltenssteuernden Genen“. Zu diesem Zweck erforscht er das Paarungsverhalten von Rhesusaffenweibchen. Daher fühlt er sich ermächtigt, seiner Zuhörerschaft – die meisten sind Frauen – die Ursachen für eheliche Untreue zu erläutern. Da er Menschsein bereits als Mitgliedschaft bei der biologischen Spezies Homo sapiens umgedeutet hat, kann er nun in einem Atemzug vom limbischen System, kopulierenden Affenweibchen und ehelicher Treue sprechen. Er weiß zu berichten – schließlich trennen Affenweibchen und Frauen lediglich ein paar Gene –, dass außereheliche Eskapaden des weiblichen Geschlechts vom Serotoninspiegel mitverursacht werden. Als Verfechter von Genen, die nicht determinieren, sondern nur disponieren, will er die Untreuen jedoch nicht einfach entschuldigen. „Gene“, so erläutert er, seien „miteinander vernetzte Informationsträger“, die „manchmal abstürzen“ und „Befehle“ von außen empfangen. Der Mensch sei also nicht das Opfer seiner Gene. Er könne lernen, mit seinen Genen zu leben. Voraussetzung dafür ist jedoch, das ist die Botschaft seines Vortrages, dass sich der Mensch von Genetikern aufklären lässt. Wer sich nicht von seinen Genen an der Nase herumführen lassen will, muss sich seines genetischen Erbes bewusst werden und informiert und aktiv damit umgehen. Statt dem Untreue-Gen nachzugeben, so schlägt Schmidtke salopp vor, könne man Schokolade essen. Sie enthält eine Vorstufe des Serotonins.
Schmidtke ist keine Ausnahme: Humangenetiker sehen sich berufen, ihre Mitbürger über sich selbst zu belehren. Sie deuten Menschen in zweibeinige Genträger um und machen ihnen deutlich, dass sie genetische Aufklärung brauchen. Als Bündel aus DNA, Mutationen, versteckten Informationseinheiten und probabilistischen Genwirkungen können sie über sich selbst nichts mehr wissen. Wer dennoch selbstbestimmt sein will, muss erst vom Genetiker lernen, was dieses „Selbst“ überhaupt ist. „Selbstbestimmung“ kann im Zeitalter der Genetik nicht mehr bedeuten, ohne Bevormundung aus sich selbst heraus zu handeln, sondern setzt voraus, sich von Gen-Experten über sich selbst aufklären zu lassen.