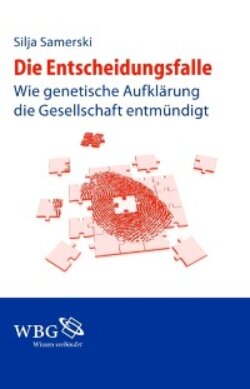Читать книгу Die Entscheidungsfalle - Silja Samerski - Страница 6
Оглавление0 Vorwort
„Selbstbestimmung“, „Mündigkeit“, „informierte Entscheidungen“ – das sind die großen Schlagworte, mit denen heute Politik gemacht wird. In allen Lebenslagen sind Bürger zu selbstbestimmten Entscheidungen aufgerufen, ganz gleich, ob sie soeben arbeitslos wurden, schwanger sind oder ein Genetiker ihnen eine beängstigende Krankheit voraussagt. Ein ganzes Heer von Experten hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu diesen Entscheidungen zu befähigen. Das professionelle Beratungswesen, das Entscheidungen zum Produkt von Dienstleistungen macht, boomt. Verschiedenste Aufklärungs- und Beratungsdienstleistungen haben das Ziel, Bürger zu Freiheit und Autonomie zu erziehen. Menschen brauchen nur den richtigen „Input“, so die Annahme, damit sie in einer erfahrungsfremden und technisierten Welt zurechtkommen können.
Seit Langem wächst meine Skepsis gegenüber dieser professionellen Vereinnahmung des Überlegens und Entscheidens. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass ich mir für meine Dissertation zum ersten Mal über Beratungsgespräche den Kopf zerbrach: Beratungsgespräche, in denen Genetiker schwangere Frauen über mögliche Chromosomenaberrationen und Fehlbildungsrisiken ihrer Leibesfrucht sowie über entsprechende Testangebote belehrten, um sie dann nachdrücklich zur „selbstbestimmten Entscheidung“ aufzufordern. Wie lässt es sich verstehen, so fragte ich mich, dass es sich Genetiker plötzlich zur Aufgabe gemacht haben, Schwangere zur Selbstbestimmung zu befähigen? Und: Was wird Schwangeren dort überhaupt beigebracht? Bis heute dient mir die genetische Beratung, die ja ausdrücklich als Entscheidungshilfe für oder gegen eine genetische Untersuchung konzipiert ist, als paradigmatisches Beispiel für die vielfältigen Formen des Entscheidungsunterrichtes, denen Bürger heute ausgesetzt sind. Ich gehe davon aus, dass Elemente und Versionen der „Entscheidungsfalle“, wie sie die genetische Aufklärung in besonders krasser Weise stellt, auch in ganz anderen Bereichen zu finden sind – ob Kinderwunschberatung, Berufsberatung, Erziehungsberatung oder Sterbehilfeberatung.
Mein Nachdenken über die zunehmende Pflicht zur informierten Entscheidung zehrt bis heute von den zahlreichen Begegnungen und Gesprächen bei Barbara Duden rund um ihren gastlichen Tisch. Dem freundschaftlichen Zusammenhang, der sich dort gebildet hat, verdanke ich inneren Halt und überraschende Einsichten – beides Voraussetzungen dafür, eigene Denkwege gehen zu können. Barbara Duden hat mir dazu verholfen, jene kritische Distanz zu modernen Selbstverständlichkeiten einzunehmen, die das Nachdenken über die Gegenwart erst fruchtbar macht. Durch sie habe ich verstanden, dass Menschen nicht „bei Sinnen bleiben“ können, wenn ihre Selbstwahrnehmung durch wissenschaftliche Abstrakta und bürokratische Kategorien überformt wird. Johannes Beck verdanke ich, dass ich professionelle Beratung als Erziehungsveranstaltung verstehen konnte, als Beispiel für die umfassende Pädagogisierung aller Lebensbereiche. Und Sajay Samuel ließ mich erkennen, dass es sich bei der Anleitung zur abwägenden, risikobezogenen Entscheidung um eine Version des managerial decision-making handelt, also um eine Management-Strategie. Doch auch mit einer ganzen Reihe weiterer Freundinnen und Freunde verbindet mich das fruchtbare Gespräch über die Folgen von Genetik und Pränataldiagnostik, über den Bürger als eigenverantwortlichen Entscheidungsträger, über den erziehungsbedürftigen Menschen und über den Verlust des Common Sense. Ihnen verdanke ich viele Inspirationen und Erkenntnisse und nicht zuletzt den Ansporn, meine Gedanken als Buch aufs Papier zu bringen.
Die Grundlage für dieses Buch hat ein Forschungsprojekt gelegt. Zwei Jahre haben Barbara Duden, Ruth Stützle, Ulrike Müller und ich darüber nachgedacht, was passiert, wenn „Gene“ aus dem Labor in den Alltag freigesetzt werden. Was bedeutet das Wort „Gen“ in der Umgangssprache? Was sagt, suggeriert und fordert es, wenn es im Gespräch zwischen Arzt und Patient, Mutter und Tochter oder beim Schwatz am Gartenzaun auftaucht? Unser Forschungsprojekt, das Barbara Duden leitete und am Institut für Soziologie der Universität Hannover angesiedelt war, trug den Titel: „Das ,Alltags-Gen‘: Die semantischen und praxeologischen Umrisse von ,Gen‘, wenn es in der Alltagssprache eingesetzt wird“ und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.1 Mir bot es die Gelegenheit, weitere genetische Beratungssitzungen zu beobachten und meine Studien zum Zusammenhang zwischen der Verwissenschaftlichung des Alltags und der Pädagogisierung des Entscheidens zu vertiefen.
Den genetischen Beratern, die ich bei ihrer Arbeit beobachten durfte, sowie den Beratungsklienten, die meiner Anwesenheit zustimmten, bin ich zu großem Dank verpflichtet. Ebenso gebührt dem BMBF Dank für die großzügige Förderung. Ein Geschenk waren diejenigen, die mein Manuskript gelesen und es durch ihre klugen Anmerkungen und Kommentare entscheidend verbessert haben: Frank Butzer, Barbara Duden, Friederike Gräff, Marianne Gronemeyer, Ludolf Kuchenbuch, Thomas Lösche, Ansgar Lüttel, Antje Menk, Uwe Pörksen, Matthias Rieger und Gudrun Tolle. Ebenso ein Segen und nicht minder unerlässlich waren diejenigen Freundinnen und Freunde, die uns geholfen haben, den Alltag mit Buchmanuskript und kleinen Kindern zu meistern, insbesondere Michael Lienesch, Johanna Germer, Antje Menk, Ina Sapiatz, Dorothee Torbecke, die Großeltern und das Team der Kindergruppe „Picobello e. V.“.
Widmen möchte ich dieses Buch Ivan Illich und meinen Töchtern Hannah und Alena. Ersterer hat mir die Hoffnung geschenkt und damit auch den Mut, moderne Mythen auseinanderzunehmen. Meinen Kindern verdanke ich den Sinn für das Wesentliche. Auch ihnen möchte ich Hoffnung mit auf den Weg geben.