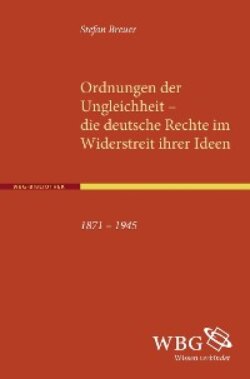Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 17
Dynamisierung des Rassenbegriffs
ОглавлениеUngeachtet dieser Neigung ist freilich insgesamt festzuhalten, daß bei den deutschen Rassenanthropologen die Spannung, in der der Rassenbegriff zur Nation steht, stärker verdeckt blieb als in Frankreich. Während Gobineau in der Nation das Produkt einer Blutmischung und damit der Dekadenz sah, von dem er die schlimmste Tyrannei befürchtete (Gobineau 1902–04, II, 78ff.; Cassirer 1988, 310ff.), erscheint bei Ammon, Woltmann und, wie man noch hinzufügen könnte: Schemann die deutsche Nation als die vergleichsweise am wenigsten degenerierte und der deutsche Staat nachgerade als Hüter der noch verbliebenen rassischen Substanz. Die Zukunft der Menschheit hing nach Schemann, dem Übersetzer Gobineaus, davon ab, ob es „Alldeutschland“, zu dem er nicht nur die „ächten Deutschen aller Lande, sondern auch unsere niederländischen und skandinavischen Brüder“ rechnete, gelingen würde, sich der „Durchsetzung mit niederen Racenelementen“ zu erwehren (in: Gobineau 1902–04, IV, XXXIX) – eine Aufgabe, zu der sich der deutsche Staat und die deutschen Nationalisten verbünden sollten.
Das war eine andere Sicht als diejenige Gobineaus. Aber sie war mit dieser wiederum auch nicht unvereinbar, insofern sie nur andere Konklusionen aus den gleichen Prämissen zog: dem konstanten Rassenbegriff und der These von der „Entropie der Rassen“ (Sieferle 1989, 129). Wenn die einzige kulturschöpferische Ressource der Menschheit im arischen Blut lag und es zugleich keine Aussicht gab, es zu erneuern, dann war es konsequent, mit den gegebenen Beständen zu wirtschaften und alles daran zu setzen, sie zu bewahren; wie es auch konsequent war, zu diesem Zweck an die einzige für diese Aufgabe in Frage kommende Instanz zu appellieren: den Nationalstaat. Diese Auffassung hält sich so sehr im Rahmen des konstanten Rassenbegriffs, daß es irreführend ist, sie als ‘synkretistisch’ zu bezeichnen (so aber: Mühlen 1977, 103ff.).
Seit der Jahrhundertwende begannen sich indes die Voraussetzungen aufzulösen, die diese Konstellation getragen hatten. Maßgeblich hierfür war zum einen die Dynamisierung, die der Rassenbegriff im Gefolge der Darwinschen Revolution erfuhr. Die bis dahin für konstant und unveränderbar gehaltenen Entitäten wurden in einen Fluß von Populationen aufgelöst, die ihre Beschaffenheit im Laufe der Zeit änderten: nicht, indem die Umwelt im Erbgut Variationen und Mutationen stimulierte, wohl aber, indem sie aus einer Population genetisch variierender Organismen die im Verhältnis zu ihren Anforderungen weniger Tüchtigen aussiebte (Sieferle 1989, 63).
Zum andern führten die neuen Erkenntnisse der Vererbungsforschung (Galton, Mendel) zu einer Revision des ‘entropischen’ Modells, die eine wesentlich optimistischere Sicht der Zukunft ermöglichte. Gingen die älteren Vorstellungen der kompakten Vererbung davon aus, daß die fortschreitende Rassenmischung schließlich einen Umschlag der Quantität in Qualität bewirkte, eine Nivellierung nach unten zu einem homogenisierten Durchschnitt, so löste die Theorie der diskreten Vererbung die Erbanlagen gewissermaßen in Mosaiksteine auf, die immer neue Kombinationen eingehen konnten, jedoch ihre ursprüngliche Qualität bewahrten und im dominant-rezessiven Modus weitergaben.
Die Qualität der Rasse konnte damit als eine Eigenschaft der Gene bzw. des Genotypus gedeutet werden, die durch die Rassenmischung und damit durch die Geschichte in ungleich geringerem Maße betroffen wurde als bei Gobineau. Der historische Prozeß betraf nur den Phänotyp. Auf einer tieferen Ebene dagegen waren Reinheit und Reichtum des Ursprungs stets präsent, wie der Nibelungenhort in Fafners Höhle; und es bedurfte nur eines Siegfrieds, um das Ungeheuer zu töten und den Schatz zu gewinnen. Weniger metaphorisch ausgedrückt: Die Mischung war nicht irreversibel, es war und blieb „grundsätzlich möglich, durch geschickte Rekombination wieder ‘reine Typen’ aus einem Merkmalgemisch herauszuzüchten bzw. bestimmte Eigenschaften zu optimieren“ (Sieferle 1989, 157).
Diese neuen Ideen ließen das bis dahin verdeckte Spannungsverhältnis zwischen Rasse und Nation bzw. Rassismus und Nationalismus hervortreten und zwangen zur Stellungnahme. Sehr grob lassen sich zwei Reaktionsmuster ausmachen: eine Auflösung des Spannungsverhältnisses hin zur Seite der Rasse, die nunmehr zum Gegenstand bewußter Auslesepraktiken avancierte; und eine Auflösung hin zur Seite der Nation, indem diese mit der Rasse gleichgesetzt wurde. Ich betrachte zunächst die erste Seite, die unter dem Gesichtspunkt sich steigernder gedanklicher Konsequenz anhand von drei Bewegungen verfolgt werden kann: der rassenhygienischen, der völkischen und der nordischen Bewegung.