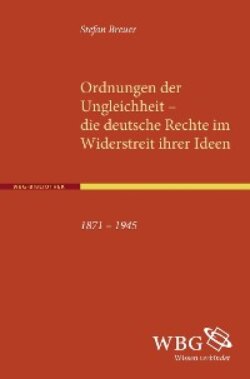Читать книгу Ordnungen der Ungleichheit – die deutsche Rechte im Widerstreit ihrer Ideen 1871 – 1945 - Stefan Breuer - Страница 8
Reiner Chthonismus und Fundamentalismus
ОглавлениеWie sehr die Bedeutung des Chthonismus für die deutsche Rechte überschätzt wird, zeigt sich schon bei einem Blick auf die fundamentalistischen Strömungen, die das Erbe der konservativen Fortschrittskritik angetreten hatten. Schopenhauer, der allerdings wegen seiner kantianischen Erkenntnistheorie nur mit Einschränkungen hier zugerechnet werden kann, sah in der nach Zeit und Raum gegliederten Welt die schlechteste alle möglichen und war schon deshalb jedweder Verklärung der Erde und des Bodens abhold. Richard Wagner erklärte ganz in diesem Sinne Zeit und Raum gar zu „Tyrannen, welche das Erscheinen großer Geister zu völligen Anomalien, ja Sinnwidrigkeiten machen, worüber dann die in Zeit und Raum sich ausstreckende Allgemeinheit, wie zum Vergnügen jener Tyrannen, mit einem gewissen Rechte sich lustig machen darf“3. Leopold Ziegler, von Schopenhauer und Wagner nicht weniger beeinflußt als von Eduard von Hartmann, sprach zwar hin und wieder vom „Erdgeist“, setzte diesen aber durchweg gleich mit Hartmanns Fassung des Hegelschen Weltgeistes: „Der menschliche Wille zur Erkenntnis ist jener selbe Erdgeist, der ‘als ein Maulwurf die Oberflächen dieses Planeten aufwühlte, schon lange ehe er zum menschlichen ‘Selbst’-Bewusstsein entwickelt war, er war schon vor allem Bewusstsein auf die Wege bedacht, die er einstmals zu gehen haben würde“ (Ziegler 1903, 108).
Im nationalreligiösen Fundamentalismus Paul de Lagardes fungieren Erde und Boden als bloßer Arbeitsgegenstand sowie als Objekt strategischer Erwägungen. Wert erhalten sie erst durch die in sie investierte menschliche Arbeit oder durch die Machtspiele der Großstaaten (SDV I, 34f., 42f.). Je gläubiger die Menschen sind, desto mehr werden sie zu „Fremdlingen auf der Erde“ (177), werden sie zu Mitgliedern einer Gemeinde, die göttlichen, nicht physischen Ursprungs ist. Auch die Nationsbildung ändert daran nichts, ist doch das Vaterland nur der irdische Leib der Idee (115ff.,259, 274).
Etwas mehr Eigengewicht kommt der Erde, wie der Natur überhaupt, im George-Kreis zu. Sie wird perzipiert als ein Gefüge von Urkräften, von außermenschlichen Mächten, die einer eigenen Gesetzlichkeit gehorchen und diese auch den Menschen aufnötigen, solange sie noch ‘grundnah’ leben (Thormaehlen 1962, 82). Der Mensch vermag aber in gewisser Weise die Natur zu bannen, ihr seinen Willen aufzuzwingen.4 Dies ist unproblematisch, solange es allein durch das Medium der Magie geschieht, zu der auch die Sprachmagie (und mit ihr: die Dichtung) gerechnet werden muß. Vollzieht sich die Naturbeherrschung indes über Wissenschaft, kann eine Lage eintreten, in der der Mensch wurzellos wird und ins Bodenlose stürzt – eine Gefahr, die George am eindrucksvollsten in Der Mensch und der Drud beschworen hat (GW II, 212):
„DER DRUD
Das tier kennt nicht die scham der mensch nicht dank.
Mit allen künsten lernt ihr nie was euch
Am meisten frommt.. wir aber dienen still.
So hör nur dies: uns tilgend tilgt ihr euch.
Wo unsre zotte streift nur da kommt milch
Wo unser huf nicht hintritt wächst kein halm.
Wär nur dein geist am werk gewesen: längst
wär euer schlag zerstört und all sein tun
Wär euer holz verdorrt und Saatfeld brach ..
Nur durch den zauber bleibt das leben wach.“
Das kann man als Chthonismus deuten. Aber man sollte darüber die Gegengewichte nicht vergessen, die dem bei George die Waage halten. Bei aller Vorliebe für Hirten und Bauern war er doch fest davon überzeugt, daß nur im Dichter, im Genius, der „Urgrund“ Stimme zu werden vermochte (vgl. Wolters 1996, 39). Nicht der Natur als solcher galt seine Verehrung, sondern der kulturell und geschichtlich vermittelten Natur. In den höchsten Regionen der Kunst, hieß es unmißverständlich in den Blättern für die Kunst, verschwinden alle natürlichen Bedingtheiten (Landmann 1965, 68). Und Maximin, der von George inthronisierte Gott, war ein ortloser Gott, eine creatio ex nihilo (Emrich 1979, 126). George mag hin und wieder den Grund gefeiert haben. Der eigentlich von ihm gesuchte und immer wieder bezogene Standort aber war derjenige am Rande des Abgrunds (Gruenter 1969, 151).
Auch im Kreis um Hofmannsthal galt der Vorrang der Kunst unbedingt. Wohl sah es, insbesondere seit dem Ersten Weltkrieg, so aus, als sei in Hofmannsthal im Zusammenhang mit seinem neu entdeckten Patriotismus auch eine Neigung zur Verklärung des Bodens erwacht, machte er doch nun die besondere Qualität der österreichischen Dichtung im Verhältnis zur deutschen an der stärkeren landschaftlichen Bindung fest, die dem österreichischen Wesen, sogar im Geschichtlichen und im Sittlichen, einen naturhaften Zug verleihen sollte (Hofmannsthal 1979, II, 16ff., 60, 374). Entsprechend groß war die Begeisterung, als Hofmannsthal die Literaturgeschichte Josef Nadlers entdeckte, in der er genau diesen Gedanken durchgeführt sah.5 Seit 1918 trat er, im privaten Kreis wie öffentlich, für Nadler ein und steckte namentlich Borchardt mit seinem Enthusiasmus an (Volke 1974; Wyss 1997). Eine Bekehrung zu Nadlers Blut-und-Boden-Determinismus war aber damit nicht verbunden. In seinen nachgelassenen Notizen von 1924–1928 hielt er Nadler vor, festlegen zu wollen, was nicht festzulegen sei. Die Methode, alles Höhere des Menschen aus seinem Niedersten zu entwickeln, sei bedenklich, eine Art Freudianismus, der falsch und entstellend werde, sobald er sich des Individuums bemächtige: „Das höhere Recht des Individuums besteht in der Überwindung der Gebundenheiten“ (1979, III, 150, 639).
Rudolf Borchardt stellte in seiner Würdigung Nadler in eine Reihe mit Karl Otfried Müllers Werk über die Dorer (1824) – eine Schrift, der schon Baeumler die Entdeckung der Lokalmythologie und der chthonischen Religion zugeschrieben hatte (Borchardt 1973, 259ff.; Baeumler 1965, 156). Das eigentlich Chthonische wurde indes von Borchardt eher beiläufig behandelt. Als Nadlers bahnbrechende Leistungen erschienen ihm vielmehr Entdeckungen, die sich auf kulturelle Vorgänge bezogen, wie z.B. die Aufzeigung der Bildungsgeschichte des Mitteldeutschen oder die Lösung des Problems der Romantik (Borchardt 1973, 261). In einer späteren, überwiegend ablehnenden Auseinandersetzung gelangte er zu einer ähnlichen Kritik wie Hofmannsthal. An der Behandlung Goethes etwa würde sich aufzeigen lassen, „daß die Nadlerschen Darstellungsprinzipien die Grenze, die ihnen Goethes geschichtliche Erscheinung – nicht sie allein, aber sie allerdings durchaus – setzt, nur überschreiten können um an ihr zu zerfallen“. Goethe, dieser große Seher, sei eben „nicht nur Sohn seines Volkes, sondern auch Vater seines Volkes“, womit jede wie immer geartete naturhafte Determinierung ausgeschlossen sei (383, 387).
Deutlich mehr in die von Thomas Mann anvisierte Richtung geht dagegen das Denken von Ludwig Klages. In Anknüpfung an das, was er als Bachofens Herzgedanken bezeichnete, pries er „die in sich geschlossene Vollkommenheit des mütterlich umfangenden Chthonismus“, der während der gesamten Vorgeschichte und noch während eines Teils der Geschichte das Leben der Menschheit bestimmt habe, bis er durch den „Einbruch des friedenstörenden Gegenwillens“ – der außerraumzeitlichen Macht des Geistes – zerstört worden sei (Klages 1988, 227). Schon in der griechischen Antike und vollends dann im christlichen Mittelalter habe das „Scheidewasser des Geistes“ den Kontakt „zwischen dem Menschen und den chthonischen Menschen“ gelöst und die Völker „aus dem nährenden Brodem ihrer Haus-, Wald- und Fluridole“ gerissen (1944, 282). Die „chthonische Substanz“ wurde vom „saugenden Transzendentalpunkt“ des wissenschaftlichen Geistes verschlungen und durch bloße „Dinge“ und schließlich nur mehr Zahlen ersetzt, die reine Objektivationen dieses Geistes waren (291). Das aber bedeutete für Klages zugleich die Zerstörung der Welt. Da
„nur in einem eigentümlichen Mittelbereich zwischen der kosmischen und der organischen Welt, im Bereich der anorganischen Vorgänge der Erdoberfläche, die Rechnung hinreichend stimmt, um die Geistesherrschaft auch durchzuführen, während die Welt des organisch Lebendigen als ein beständiges Wunder draußen bleibt, so ist es keineswegs eine zufällige Folgeerscheinung, sondern gehört zum Prozesse selbst als die unmittelbare Bekundung seiner Herkunft aus der Wirklichkeitsfeindschaft des Willens, wenn aus der Mechanik eine Technik herauswuchs, als deren Ziel sich immer deutlicher die Vertilgung unzähliger Tiergeschlechter, ja schließlich aller Lebewesen des Erdballs herausschält“ (Klages 1981, 724).
Klages’ Haltung gegenüber diesem Zerstörungsprozeß war ambivalent. Auf der einen Seite ließ er durchblicken, daß es möglich sei, ihn aufzuhalten oder wenigstens zu verlangsamen. Dabei attestierte er dem germanischen Wesen eine besondere Befähigung dazu, stelle es doch eine geglückte „Mischung aller Erdelemente“ dar, die bis in die „feuerflüssigen Allnebel“ hinabreiche (1944, 250). Entsprechend erschien ihm auch das Dritte Reich als eine aufhaltende Macht, weil es die „Gauverbände“ wiederbelebe, in denen Klages ein chthonisch-symbiotisches Element entdecken wollte (1936, 325). Auf der anderen Seite stand die nicht minder ausgeprägte Überzeugung, der ‘letzte Mohikaner’ zu sein (1981, 768; Schröder 1992, 952, 1105). Heute, da zum erstenmal die Lebengelöstheit und Wirklichkeitsfremdheit des Sachdenkens entlarvt werde, sei es für eine Umkehr „zu spät“ (Klages 1981, 393): „Man kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen den Geist aus dem Leben ausschalten oder ihn unwirksam machen oder in die Botmäßigkeit des Lebens zurückzwingen, geschweige zurückkehren in irgendeine Vergangenheit“ (1423). Auch die Ablehnung allen ‘Tätertums’ und die Präferenz für Kontemplation (Schröder 1992, 1182, 1224) spricht nicht für Regression in einem politischen oder sozialen Sinne, so daß auch von hier aus Thomas Manns These mit einem Fragezeichen zu versehen ist.
Am ehesten entspricht dieser These noch das Werk eines Autors, der von Mann nicht erwähnt wird: Ernst Niekischs Entscheidung. Mit ihm vollzog der Verfasser, der einen wechselvollen Weg vom Räterevolutionär über die rechte Sozialdemokratie bis zum neuen Nationalismus à la Winnig und Jünger hinter sich hatte, einen Schwenk in das Lager der fundamentalistischen Zivilisationskritik, der mit einer Verklärung der Mächte des Bodens und des Blutes einherging. Deutschland, so behauptete Niekisch, sei seiner selbst gewiß und stabil gewesen, solange es nur von Bauern und Helden bewohnt war. Das Land, die Erde, sei ein Überpersönliches gewesen, „das unantastbar durch die Jahrhunderte die menschlichen Geschicke formte und als ein Heilig-Überliefertes ehrfürchtig von den Vätern übernommen, gebietend den Kindern hinterlassen wurde“ (Niekisch 1930a, 9). Erst durch die ständige Verstärkung des politischen Gewichts jener Landesteile des Reiches, in denen römisches Erbe überwog, sei es zu einem Substanzverlust und zu wachsender Verstädterung gekommen, in deren Gefolge das deutsche Wesen ins Individualistische und Materialistische entartet sei. Die „Flucht des deutschen Menschen aus der Lebensgesetzlichkeit seines Raumes“ habe zweimal zur Katastrophe geführt: zuerst zum Untergang des staufischen Kaisertums, dann zum Weltkrieg und zum Versailler Frieden, der den endgültigen Sieg der städtischen Lebensform und des Westens gebracht habe. Mit der vollständigen Unterwerfung unter die moderne Industrie- und Weltwirtschaft sei das Ende der deutschen Geschichte nur noch eine Frage der Zeit: „Auf dem Asphalt moderner Städte, in grauen Mietskasernen, verflüchtigt sich die geheimnisvolle Gewalt von Blut und Boden“ (53, 25, 73, 47, 18f.).
Abhilfe bot in dieser Lage allein ein rigoroser Wechsel in Zeit und Raum. Es galt seit langem abgerissene Fäden wiederaufzunehmen zu der Zeit vor Karl dem Großen und noch weiter zurück, „hinter die Zeit förmlich, in der zuerst sich eines Römers Fuß auf deutsche Erde setzte. Durch unsere Geschichte wurde unser Schicksal verdorben; wir müssen wieder alle die vielen Wege zurückwandern, die sich inzwischen als Sackgassen, als Pfade in Irrgärten und andere Verhängnisse erwiesen haben“ (166). Räumlich galt es, den Schwerpunkt Deutschlands aus den romanisierten Gebieten des Südens und Westens nach Osten zu verlagern, durch Verbindung mit slawischem Bauerntum den Weg zurück zur Scholle zu finden (117f.). Flucht aus der Stadtwelt, Flucht aus der Zivilisation, Flucht aus der Weltwirtschaft: dies war in Niekischs Augen die conditio sine qua non für die Wiedergewinnung des Heiligen und Göttlichen, das das deutsche Wesen ursprünglich ausgezeichnet hatte: „Dem deutschen Volke tut der Mut zu seinem Barbarentum not; seine Stärke ruht in Germaniens Wäldern; je tiefer es sich dorthin zurückzieht, desto mehr findet es sich selbst. Es braucht die Schluchten des Teutoburger Waldes, um den Welschen die Köpfe abschlagen zu können“ (100). Das war eine ‘Entscheidung’, die in der deutschen Rechten begreiflicherweise auf wenig Resonanz stieß. Niekisch selbst schwächte sie auch gleich wieder dahingehend ab, daß dieser Rückzug nicht den Verzicht auf Panzer und Maschinengewehre bedeutete.