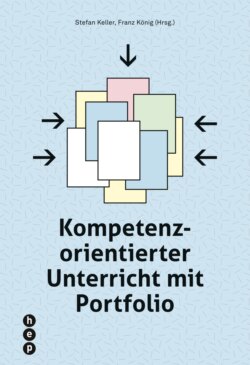Читать книгу Kompetenzorientierter Unterricht mit Portfolio - Franz König, Stefan Keller - Страница 9
3.4 Erweiterte Formen der Leistungsbeurteilung ermöglichen
ОглавлениеMit der Kompetenzorientierung ist – im Rahmen des Bildungsmonitorings – auch die Absicht verbunden, erworbenes Wissen und Können in objektivierbarer Form beschreiben und vergleichen zu können, das heißt, die wünschbare Verbindung von Wissen, Können und Handlungsfähigkeit so herzustellen, dass sie messbar wird. Da bei dieser Form des Bildungsmonitorings immer ein ganzes Bildungssystem einbezogen und große Schülerzahlen erfasst werden müssen, geschieht diese Beurteilung gegenwärtig primär mit standardisierten Leistungstests. Diese sollen ausgewählte Informationen zur Evaluation der Bildungsbemühungen an den Schulen liefern, an transparenten Kompetenzmodellen orientiert sein und testtheoretischen Gütekriterien wie Objektivität oder Reliabilität genügen. Derartige Tests prüfen die Kompetenzen jedoch anhand kleiner, kurzfristig zu bearbeitender Aufgaben und orientieren sich stark an der Realisierung kognitiver Lernziele, sind also tendenziell wissensorientiert. Stärker handlungsorientierte oder problemlösende Wissensformen (also Kompetenz im Sinn von ›Handlungsbefähigung‹) lassen sich mit standardisierten Schulleistungstests weniger gut erfassen.
Gerade beim kompetenzorientierten Unterricht, bei dem junge Menschen über längere Zeiträume selbstständig an offenen Aufträgen arbeiten, sind die Lernerträge jedoch multidimensional und werden von einem Bündel von Maßnahmen und Lernumständen mitbestimmt, die sich gegenseitig ergänzen und kompensieren. Einführung von kompetenzorientierter Leistungsbewertung auf standardisierte Tests würde bedeuten, dass viele der didaktisch wertvollsten Ziele der Kompetenzorientierung ›von hinten‹«, von der Beurteilung her, wieder demontiert und entwertet würden (vgl. Girmes 2004). Warum denn sollten Jugendliche ihr Lernen reflektieren, warum sollten sie personale und soziale Fähigkeiten erwerben, wenn diese in den maßgeblichen Tests gar nicht erfasst und geschätzt werden?
In der aktuellen didaktischen Diskussion herrscht Konsens darüber, dass von der Art der Beurteilungskultur ein starker Effekt auf die Lernkultur ausgeht (vgl. Winter 2004). Wenn die Lernförderung gegenüber der Selektionsabsicht nicht genügend Gewicht erfährt, entsteht zwischen Lern- und Beurteilungskultur eine problematische Lücke, die nachhaltiges Lernen behindern kann. Die ›Macht‹ der Testung kann Lehrkräfte dazu verführen, verstärkt Testaufgaben einzuüben und so zu versuchen, geforderte Kompetenzen ›direkt‹ anzusteuern. Eine solche Engführung der Leistungsbewertung birgt letztlich auch die Gefahr einer Behinderung und Entmutigung innovativer didaktischer Ansätze. Um die Lernenden in ihren aktiven, selbstverantworteten Lernprozessen zu bestärken, müssen auch erweiterte Methoden der Leistungsbeurteilung entwickelt werden: Genauso umfangreich wie die Breite und Vielfalt der erforderlichen Lernsituationen, in denen Kompetenzen entwickelt werden, soll auch die Vielfalt der Beurteilungsanlässe sein, mit denen Kompetenzerwerb für alle Akteurinnen und Akteure nachvollziehbar beurteilt wird (vgl. dazu im Detail die Beiträge von Felix Winter und Franz König, S. 27 ff. und S. 59 ff.).
Die Arbeit mit Portfolios bietet die Möglichkeit, individuelle Ressourcenförderung bei Lernenden und den verstärkten Fokus auf Messbarkeit nicht als Gegensätze zu sehen, sondern als gegenseitige Herausforderung. Tests können gewisse eng definierte Kernfähigkeiten standardisiert und generalisierbar erfassen. Portfolios zeigen ihre Stärke dadurch, dass sie ein breites Spektrum an Leistungen zu dokumentieren vermögen und damit auch diejenigen Kompetenzdimensionen erfassen, die sich einer standardisierten Testung entziehen oder durch diese nur schwer erfasst werden können. Wird das Portfolio als zusätzliches Instrument zur Leistungsbeurteilung eingesetzt, öffnet sich damit auch der Kreis der direkten Leistungsnachweise, die darin dokumentiert sind. Portfolios können Lerndokumente enthalten,
•die über einen längeren Zeitraum entstanden sind;
•die mehrfach überarbeitet wurden und nun in der bestmöglichen Form vorliegen, die der/dem Lernenden im Moment der Beurteilung möglich war;
•die eigenes Interesse oder eigene Initiative der Lernenden unter Beweis stellen und ihre individuellen Talente abbilden (vgl. die Beiträge zum Talentportfolio von Simone Thomann und Beat Schelbert, S. 125 ff. und S. 167 ff.);
•die Lernreflexionen beinhalten, beispielsweise als Begleitbriefe oder Texte zur Selbsteinschätzung.
Allerdings ist die Beurteilung einer Sammlung von unterschiedlich komplexen und vielseitigen Lernendenprodukten in einem Portfolio für Lehrkräfte ein ungewohnter und anspruchsvoller Prozess. Der Einstieg in diesen Prozess erfordert grundsätzliche Überlegungen zu drei elementaren Schritten:
•Die Lehrkraft legt im ersten Schritt das Vorgehen für den Bewertungsprozess fest, mit dem sie der Arbeit einer/eines Lernenden begegnet;
•im zweiten Schritt entwickelt sie nachvollziehbare Kriterien, deren Anwendung zu einer transparenten Bewertung führen;
•schließlich legt sie die Form fest, in der sie die Bewertung ausdrücken und den Betroffenen mitteilen möchte (vgl. Winter 2004, S. 170 ff.).
Besondere Aufmerksamkeit beansprucht dabei der Umgang mit individuellen Kompetenzen der Lernenden auf der einen, und der Beurteilung festgesetzter Standards auf der anderen Seite: Einerseits sollen Portfolios nicht ›irgendetwas‹ dokumentieren, sondern jene ›offiziellen‹ Kompetenzziele nachweisen, die dem schulischen Lernen als Orientierungsgrößen vorgegeben sind und auf jeden Fall erreicht werden sollen. Andererseits sollen an Portfolios nicht nur jene Aspekte interessieren, die sich in der Sprache der Standards ausdrücken lassen. Vielmehr sollen auch persönlich bedeutsame Leistungen beachtet und gewürdigt werden, bei denen sich die Lernenden von anderen unterscheiden und die nicht vergleichbar oder standardisierbar sind (vgl. Sacher 2003, S. 17). Dies bedeutet die Feststellung der im Portfolio dokumentierten Kompetenzen in einem hermeneutischen Prozess, wie er im Beitrag von Felix Winter (S. 27 ff.) im Detail dargestellt ist. Die Praxisbeispiele dieses Buches enthalten zudem jeweils detaillierte Auflistungen von Kompetenzen aus dem Lehrplan 21, die für die Unterrichtseinheiten zentral sind, sowie mögliche Prüfungs- und Präsentationsaufgaben für deren Erfassung.