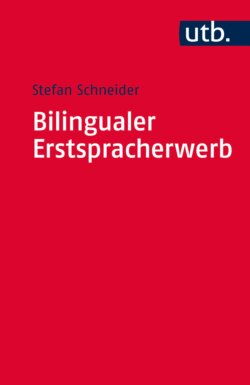Читать книгу Bilingualer Erstspracherwerb - Stefan Schneider - Страница 5
Оглавление1 Einleitung
1.1 Mehrsprachigkeit: ein alltägliches Phänomen
Die Anzahl der von der Weltbevölkerung gesprochenen Sprachen (ca. 7000) übersteigt diejenige der 193 Staaten der Welt um ein Vielfaches. Es ist daher nicht überraschend, wenn in vielen Ländern de facto oder de iure im gesamten Staatsgebiet oder Teilen davon Zwei- oder Mehrsprachigkeit herrscht. In der Republik Südafrika (Afrikaans, Englisch sowie neun offizielle afrikanische Sprachen), im amerikanischen Bundesstaat New Mexico (Englisch, Spanisch), in Singapur (Englisch, Malaysisch, Mandarin, Tamil), in Hongkong (Englisch, Kantonesisch, Mandarin), in der Schweiz (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch), in Südtirol (Deutsch, Italienisch, Ladinisch), um nur einige wenige Beispiele zu nennen, ist es für die Bewohner und Bewohnerinnen eine Selbstverständlichkeit, im alltäglichen Leben mit einer zweiten oder sogar mehreren Sprachen konfrontiert zu sein und diese zum Teil auch zu beherrschen. Als Anekdote kann ich dem hinzufügen, dass ich nach einem Unfall ein paar Tage im Krankenhaus von Görz (Gorizia) in Norditalien verbrachte. Der Patient neben mir, ein sympathischer junger Bauarbeiter aus der Umgebung, bekam oft Besuch von Verwandten und Bekannten. Jedes Mal, wenn neue Besucher kamen, wurde eine andere Sprache gesprochen. Mit der größten Selbstverständlichkeit wechselte der einfache Arbeiter vom Italienischen zum Friaulischen und zum Slowenischen.
Indien ist ein Beispiel für ein Land, in dem Mehrsprachigkeit sowohl auf institutioneller als auch auf individueller Ebene herrscht (Håkansson und Westander 2013, 50 f.). Hindi und Englisch sind die offiziellen Sprachen. Dazu gibt es noch 1600 regionale und lokale Sprachen. Die Zehn-Rupien-Banknote trägt auf der Vorderseite eine Aufschrift auf Hindi und Englisch. Auf der Rückseite werden weitere fünfzehn Sprachen in zehn unterschiedlichen Schriften erwähnt. Die Verfassung aus dem Jahr 1961 schlägt vor, dass jeder Bürger und jede Bürgerin zumindest drei Sprachen beherrschen sollte: eine lokale, eine für ganz Indien und eine für die internationale Kommunikation.
Exakte Zahlen zum weltweiten Ausmaß der Mehrsprachigkeit sind nicht verfügbar, aber nach einer vielfach zitierten Schätzung von Grosjean (1982) sind 50 % der Weltbevölkerung mehrsprachig oder leben zumindest in einer mehrsprachigen Umgebung. Auer und Wei (2007, 1) schätzen sogar, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung zumindest zweisprachig ist. Ein Großteil der Bevölkerung Afrikas ist in der Tat mehrsprachig, Mehrsprachigkeit ist dort die Norm (Wolff 2000, 314–332). Nicht nur in der alltäglichen Kommunikation, auch in vielen Bildungseinrichtungen dieses Kontinents werden mehrere Sprachen gleichzeitig gebraucht. Asien, vor allem das kontinentale und peninsulare Südostasien, ist zum Großteil mehrsprachig (Goddard 2005). Exogamie, also die Eheschließung außerhalb des eigenen Volkes, ist eine gängige Praxis in vielen traditionellen Gesellschaften Afrikas, Asiens und Australiens. Exogamie führt fast immer zu Mehrsprachigkeit (Håkansson und Westander 2013, 49). Auch China, oft als monolinguales mandarinsprachiges Land gesehen, ist zumindest bilingual, da die Mehrheit seiner Einwohner eine der vielen stark voneinander abweichenden Regionalsprachen (Wu, Kantonesisch, Min, usw.) benutzt und die Standardsprache Mandarin zumeist erst später im Leben erlernt (Ansaldo 2009, 88). In Südamerika, wo der Kolonialismus den Übergang zu monolingualen Systemen bewirkt hat, existieren trotzdem noch Gebiete mit mehrsprachiger Bevölkerung.
Einsprachigkeit ist ein Zustand, der im Grunde vor allem für die europäische und nordamerikanische Kultur charakteristisch ist und sogar dort nicht ausnahmslos herrscht. Nach einer Schätzung von De Houwer (2009, 10) werden in 10 % aller Familien West- und Nordeuropas zwei Sprachen gesprochen. Grosjean (2013, 6) erwähnt einen Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2006, wonach 56 % der Einwohner der 25 EU-Staaten eine zweite Sprache so gut sprechen, dass sie in dieser ein Gespräch führen können. Nordamerika ist ebenfalls nicht ausnahmslos einsprachig. Ungefähr 35 % der Bevölkerung Kanadas ist bilingual, in den USA sind es immerhin noch 18–20 %, d. h. in etwa 55 Millionen Einwohner (Grosjean 2013, 6). Die Mehrsprachigkeit ist vor allem in den urbanen Gebieten verbreitet. In der Ausgabe vom 10. September 2011 der Zeitschrift The Economist war zu lesen, dass in der Stadt New York fast so viele Sprachen (800) wie in Papua-Neuguinea gesprochen werden.
Vor diesem Hintergrund sind Auffassungen und Aussagen, die von der Einsprachigkeit eines Staates, eines Landes oder auch einer Gesellschaft ausgehen, unpassend und gelegentlich sogar grotesk. Sie sind nur durch in der Neuzeit entstandene Denkmuster über Standardsprache und Nation erklärbar. Das besonders in Europa und Nordamerika verankerte Konzept eine Nation – eine Sprache ist nicht alt. Noch im Mittelalter herrschte in Europa eine weitreichende Mehrsprachigkeit mit Latein als Hochsprache und daneben vielen Volkssprachen (Baldzuhn und Putzo 2011; Molinelli und Guerini 2013). Ursprünglich im 15. und 16. Jahrhundert aufgekommen, erlebte das Konzept eine Nation – eine Sprache einen Höhepunkt während der historischen Entwicklung der Nationalstaaten. Seine Aktualität muss jedoch hinterfragt werden, vor allem im Lichte der Erkenntnis, dass Einsprachigkeit mit großer Wahrscheinlichkeit einen Ausnahmezustand darstellt (Auer und Wei 2007, 1).
Es ist aufgrund dieser Situation nur zu verständlich, dass auch für Millionen von Kindern eine multilinguale Gesellschaft und das gleichzeitige Erwerben und Verwenden mehrerer Sprachen eine alltägliche Erfahrung darstellen (Ingram 1981, 95; De Groot 2011, 1). Crystal (2003, 69) schätzt, dass zwei Drittel aller Kinder in einer mehrsprachigen Umgebung aufwachsen. Tatsächlich entspricht die einsprachige Umgebung, von der bis vor nicht allzu langer Zeit die Spracherwerbsforschung ausging, nicht den realen Verhältnissen, mit denen Kinder in vielen Teilen der Welt konfrontiert sind. In Deutschland erreichte 2012 die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund 16,3 Millionen, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 20,0 % entspricht. Bei den unter Fünfjährigen liegt der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund inzwischen bei 35,4 % der Bevölkerung (Statistisches Bundesamt 2013, 7 f.). Man kann davon ausgehen, dass die meisten davon in irgendeiner Weise zumindest zweisprachig aufgewachsen sind.
Eine zweisprachige Kindheit kann jedoch nicht nur durch Migration im klassischen Sinne bedingt sein. Die heutige Gesellschaft ist in Ausbildung, Arbeit und Freizeit höchst flexibel und mobil. Mehrsprachigen Familien, die aufgrund von Studien- oder Arbeitsaufenthalten im Ausland, ja sogar nach Urlauben entstanden sind, begegnet man auf Schritt und Tritt. Man denke nur an das bei europäischen Studierenden so populäre Erasmus-Programm, im Zuge dessen diese in einem Land ihrer Wahl ein Semester oder Studienjahr verbringen und das zu zahlreichen Partnerschaften, Ehen und erfolgreichen bilingualen Familien geführt hat.
1.2 Aufbau des Buches und Lesehinweise
Die folgenden Seiten bieten eine erste Annäherung an das faszinierende Gebiet des bilingualen Erstspracherwerbs (engl. bilingual first language acquisition), stellen die wichtigsten Studien vor und erörtern die Hauptfragen, mit denen sich die Forschung auseinandersetzt. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Spracherwerb im Vorschulalter, vor allem in den ersten drei Lebensjahren.
Der Band setzt sich aus drei Teilen unterschiedlicher Länge und Gewichtung zusammen: Die Kapitel 2 und 3 erläutern grundlegende Konzepte, Definitionen, Fragestellungen und Methoden, die Kapitel 4 und 5 bieten einen Forschungsüberblick und die anschließenden Kapitel besprechen ausgewählte Aspekte. Das Buch richtet sich vor allem an Personen, die sich im Laufe ihrer universitären oder beruflichen Ausbildung mit dem bilingualen Erstspracherwerb befassen. Es ist in erster Linie als wissenschaftliche Einführung konzipiert, weshalb es einen recht detaillierten Forschungsüberblick beinhaltet. Solche Forschungsüberblicke sind in Einführungen nicht häufig anzutreffen. Da es in der Forschung zum bilingualen Erstspracherwerb eine verbreitete Praxis ist, auf beispielhafte Fallstudien zu verweisen, ist es von Vorteil, zumindest über diese Schlüsselstudien Bescheid zu wissen. Ihre chronologische Beschreibung liefert zudem einen Überblick über die Entwicklung einer noch jungen Forschungsrichtung. Doch auch Leser und Leserinnen ohne spezielle Fachkenntnisse können von der Lektüre des Buches profitieren. Diesen empfehle ich, den Forschungsüberblick in den Kapiteln 4 und 5 nur bei Bedarf punktuell zu konsultieren.
Obwohl Sprachwissenschaftler, bin ich in diesem Buch bestrebt, den bilingualen Erstspracherwerb nicht aus einer ausschließlich linguistischen Perspektive darzustellen, sondern, wo möglich, aus einem entwicklungspsychologischen, kognitiven, allgemein kommunikativen oder sozialen Blickwinkel zu beleuchten. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten erwiesen, dass eine rein linguistische, vor allem linguistisch-strukturelle Herangehensweise in der Spracherwerbsforschung wenig erhellend ist und teilweise sogar den Blick auf das Wesentliche verstellt.
Leser und Leserinnen mit einer Ausbildung in Sprachwissenschaft werden einige Erläuterungen linguistischer Terminologie als ungenau, zu allgemein oder als einfach unnötig empfinden. Der Zweck der verwendeten Fachtermini besteht einzig und allein darin, Begriffe der frühkindlichen Zwei- und Mehrsprachigkeit einer nicht-linguistischen Leserschaft näher zu bringen.
Wie in Texten zur Kindersprache üblich, wird das Alter der Kinder in Jahren, Monaten (durch Strichpunkt getrennt) und bei Bedarf Tagen (durch Strichpunkt oder Punkt getrennt) angegeben. Die Angabe 2;1;22 bedeutet demnach 2 Jahre, 1 Monat und 22 Tage.
Das Buch enthält am Ende ein Gesamtregister, in dem Namen (auch von Kindern einiger Fallstudien), Schlüsselbegriffe, deutsch- und fremdsprachliche Fachtermini, Sprachen und Abkürzungen enthalten sind.
Obwohl die Mehrsprachigkeit keineswegs eine exotische Ausnahme darstellt, ließ die einseitige Fixierung auf die Monolingualität die Sprachwissenschaft nicht unberührt und führte dazu, dass Untersuchungen zum bi- und multilingualen Erstspracherwerb lange Zeit nicht den Stellenwert einnahmen, den das Ausmaß des Phänomens nahelegen würde. Darüber hinaus wollte man bei der Erforschung des Spracherwerbs, eine der zentralen, noch immer nicht befriedigend gelösten Fragen der Sprachwissenschaft, durch den Faktor Mehrsprachigkeit zu erwartende Komplikationen vermeiden. Fantini (1976, 17) wies darauf hin, dass von den fünfzig in Slobin (1972) erwähnten Langzeituntersuchungen über den Spracherwerb nur drei über zweisprachige Kinder berichten. Hier war in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Veränderung bemerkbar. Der Forschungsbereich ist ungeheuer gewachsen. Die Anzahl der wissenschaftlichen Beiträge ist exponentiell gestiegen. Parallel dazu erschien eine Reihe von Einführungen, Handbüchern, Enzyklopädien sowie Websites und Blogs. Zu den zwei schon seit den 1970er Jahren etablierten Fachzeitschriften Bilingual Research Journal und Journal of Multilingual and Multicultural Development kamen ab den 1990er Jahren noch die Zeitschriften Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, International Journal of Bilingualism und neuerdings Linguistic Approaches to Bilingualism dazu.
Als weiterführende Literatur empfehle ich einige in neueren englischsprachigen Handbüchern enthaltene Zusammenfassungen (De Houwer 1995, 2005; Romaine 1996, 1999; Bhatia und Ritchie 1999; Meisel 2004; Paradis 2007; Serratrice 2013; Yip 2013), die Bände von Hamers und Blanc (2000 [1983]), Romaine (1995), Myers-Scotton (2006) und De Houwer (2009), die deutschsprachigen Beiträge von Tracy und Gawlitzek-Maiwald (2000) und Schneider (2003a), sowie die Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung von Müller et al. (2011). Nicht uninteressant ist außerdem die französischsprachige Einführung von Hagège (1996). Sie alle bieten einen Überblick über die Forschung der letzten Jahre. Für Zusammenfassungen und Besprechungen von früheren Arbeiten verweise ich auf Rūķe-Draviņa (1967), Hatch (1978), McLaughlin (1978, 72–98), Grosjean (1982), Taeschner (1983, 7–16) und Hakuta (1986, 45–72). Der von Li Wei herausgegebene Bilingualism Reader (2007) enthält eine Sammlung zentraler Aufsätze.
In mehrsprachigen Familien stellen sich die Eltern berechtigterweise oft die Frage nach der gelungenen sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder. In den letzten Jahren ist zu diesem Thema eine Anzahl von Einführungen und Ratgebern erschienen. Einige davon möchte ich hier erwähnen, und zwar die englischsprachigen Bücher von Harding und Riley (1986), Arnberg (1987), Cunningham-Andersson und Andersson (1999), Tukuhama-Espinosa (2001), Barron-Hauwaert (2004) und Pearson (2008), sowie die deutschsprachigen Einführungen von Kielhöfer und Jonekeit (1995), Burkhardt Montanari (2002, 2003), Nodari und De Rosa (2003), Leist-Villis (2009) und Triarchi-Herrmann (2012).