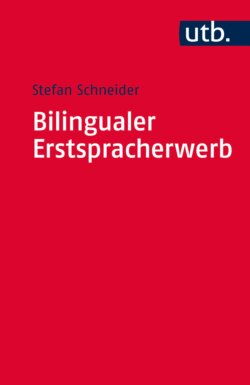Читать книгу Bilingualer Erstspracherwerb - Stefan Schneider - Страница 6
Оглавление2 Grundlegende Konzepte
2.1 Bilingualität, Bilingualismus und Diglossie
Bevor wir uns genauer mit dem Phänomen des bilingualen Erstspracherwerbs auseinandersetzen, ist es hilfreich, drei Termini oder Begriffe zu klären. Die Termini Bilingualität und Bilingualismus (gelegentlich auch Bilinguismus, Müller et al. 2011, 15; Rizzi 2013, 9) bezeichnen im Deutschen sowohl das individuelle Beherrschen zweier Sprachen seit der Kindheit als auch das kollektive Phänomen einer Gesellschaft, die in allen wichtigen kommunikativen Interaktionen zwei Sprachen verwendet. Die Wörter Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit sind ähnlich mehrdeutig. Hamers und Blanc (2000 [1983], 6) unterscheiden jedoch terminologisch das individuelle Phänomen der bilingualité oder bilinguality vom gesellschaftlichen Phänomen des bilingualisme oder bilingualism. Ebenso finden wir in Hélot (2007, 27) die Unterscheidung zwischen dem individuellen Phänomen des Multilingualismus und dem kollektiven Plurilingualismus. Ich greife diesen Vorschlag auf und verwende im vorliegenden Buch Bilingualität für das individuelle und Bilingualismus für das gesellschaftliche Phänomen. Gleichermaßen bezeichne ich daher das individuelle Phänomen der Mehrsprachigkeit mit Multilingualität (oder auch Plurilingualität) und die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit mit Multilingualismus (oder auch Plurilingualismus). Die Bilingualität kann, muss aber keine Voraussetzung für den Bilingualismus sein; ein zweisprachiges Individuum kann genauso gut in einer einsprachigen Gesellschaft leben, so wie umgekehrt in einer bilingualen Gesellschaft in der Regel nicht jedes Mitglied beide Sprachen beherrscht. Im diesem Buch beschäftige ich mich in erster Linie mit der individuellen Bilingualität und weise nur wo nötig auf die gesellschaftliche Erscheinung und die eventuellen Einflüsse eines bilingualen Umfeldes hin.
Ebenfalls eine gesellschaftliche und soziolinguistische Bedeutung besitzt der vom Bilingualismus zu unterscheidende Begriff der Diglossie. Mit diesem auf Ferguson (1959) zurückgehenden Terminus wird eine zweisprachige Situation in einer Gesellschaft bezeichnet, in der eine funktionale Differenzierung zwischen zwei Sprachen oder Varietäten besteht, so dass jeder der beiden ein sozial, thematisch und situationell definierter Anwendungsbereich vorbehalten ist. Häufig steht eine der Sprachen oder Varietäten sozial höher als die andere, es besteht eine Asymmetrie (Bolonyai 2009, 257). Die höher stehende Sprache oder Varietät zeichnet sich durch ein hohes Maß an grammatischer Explizitheit, durch Normierung, formellen Charakter, Schriftlichkeit und schulbasierte Vermittlung aus. Vor allem in der Kreolistik wird die sozial hohe Varietät oder Sprache manchmal Akrolekt und die soziale niedrigere Basilekt bezeichnet (eventuell mit einem dazwischen liegenden Mesolekt). In Fergusons (1959) ursprünglichem Verständnis handelt es sich immer um zwei Varietäten der gleichen Sprache, wie z. B. klassisches Arabisch und ägyptisches Arabisch, Standarddeutsch und Schweizerdeutsch oder Standardfranzösisch und Kreolisch in Haiti. Fishman (1967) weist jedoch darauf hin, dass viele bilinguale Gesellschaften diglossisch sind oder, anders gesagt, auch zwei vollkommen verschiedene Sprachen in einem diglossischen Verhältnis zueinander stehen können. Der sehr reduzierte deutsch-slowenische Bilingualismus im Bundesland Kärnten ist de facto diglossisch, auch wenn Slowenisch eine hoch entwickelte Kultursprache ist, es in Kärnten slowenischsprachige Schulen und Radiosendungen gibt und slowenischsprachige Kärntner in einem beschränkten Rahmen das gesetzliche Recht haben, ihre Anliegen bei den Ämtern auf Slowenisch vorzubringen. Dieses Recht hat allerdings vor allem theoretische und politische Bedeutung. In der Praxis wird Slowenisch in einem engen sozial und lokal definierten Bereich gesprochen, der zumeist aus der Familie, dem Freundeskreis und den oft weit verstreuten Angehörigen der Minderheit besteht. Hinzu kommt noch das Gefälle zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Die slowenischsprachigen Kärntner leben vornehmlich auf dem Land. Wenn sie in die Stadt kommen, wechseln sie oft automatisch ins Deutsche.
2.2 Bilingualität und Multilingualität
Die Situationen frühkindlicher Mehrsprachigkeit sind höchst unterschiedlich. Einige Kriterien ermöglichen jedoch eine erste Differenzierung und Typologie der Fälle. Ein naheliegendes Kriterium ist die Anzahl der involvierten Sprachen. Ein weiteres brauchbares Kriterium ist die Zeit, zu der der Spracherwerb einsetzt. Außerdem kann man die unterschiedlichen kommunikativen Situationen anhand der in der Familie und in ihrem Umfeld üblichen Verteilung der Sprachen unterscheiden.
Im vorhergehenden Abschnitt habe ich von Bi- und Multilingualität und von Bi- und Multilingualismus gesprochen. In Laufe des Buches wird allerdings klar werden, dass mein Augenmerk aufgrund der größeren Verbreitung des Phänomens vornehmlich der frühkindlichen Bilingualität gilt. Die aktuelle Forschungslage trägt ebenfalls dazu bei: Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen zum gleichzeitigen Erwerb von drei oder sogar mehr Sprachen gibt, beschäftigen sich die meisten Studien mit dem Erwerb zweier Sprachen. Ich verfahre deshalb dem heutigen Stand der Dinge entsprechend und berichte primär über die frühkindliche Bilingualität.
Zur Trilingualität oder Dreisprachigkeit kann es schnell kommen; im Grunde sobald zu den zwei Sprachen als dritte der lokale Dialekt einer der beiden Sprachen tritt – eine Situation, die in den schon angesprochenen zweisprachigen Gebieten des Bundeslandes Kärnten keine Seltenheit ist. Auch der Erwerb von drei ganz vollkommen unterschiedlichen Sprachen im Kindesalter ist selbstverständlich möglich, wie die Studien von Murrell (1966), Francescato (1971), Oksaar (1977), De Matteis (1978), Kadar-Hoffmann (1983), Hoffmann (1985, 2001), Navracsics (1985), Mikeš (1990), Stavans (1990, 1992), Faingold (1999), Quay (2001), Cruz-Ferreira (2006), Wang (2008) und Arnaus Gil (2013) dokumentieren. Barnes (2006) enthält einen Überblick über die Forschung zur frühkindlichen Dreisprachigkeit.
Hagège (1996, 259) erwähnt eine Reihe von bekannten zwei- oder mehrsprachigen Schriftstellern. Der in der Donaustadt Ruse in Bulgarien geborene Schriftsteller Elias Canetti (1905–1994) berichtet ebenso in der Autobiografie Die gerettete Zunge (1977) von seiner Kindheit in einer mehrsprachigen Umgebung. Seine Eltern waren sephardisch-jüdischer Herkunft und über die Türkei in Bulgarien eingewandert. Im Elternhaus wurde in vier Sprachen kommuniziert: Judenspanisch, Bulgarisch, Deutsch, später noch Englisch. Diese Seiten sind nicht nur von sprachwissenschaftlichem und psychologischem Interesse, sondern gewähren auch einen geistreich verfassten Einblick in das Leben der multilingualen und multiethnischen altösterreichischen Gesellschaft Südosteuropas.
2.3 Bilingualer Erstspracherwerb und früher Zweitspracherwerb
Das Kriterium der Zeit erlaubt es uns, zwischen dem gleichzeitigen (simultanen) (Sprache X/Sprache Y) und dem sukzessiven (konsekutiven oder sequenziellen) Erwerb mehrerer Sprachen zu unterscheiden (Sprache X → Sprache Y) (McLaughlin 1978). Im ersten Fall ist das Kind von Geburt an regelmäßig mit zwei oder mehreren Sprachen konfrontiert und nur hier kann man streng genommen von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Im zweiten Fall sollte man von frühem Zweitspracherwerb sprechen.
In den Lebenssituationen von vielen sprachlichen Minderheiten ist es in der Regel so, dass die Kinder anfangs mit einer Sprache aufwachsen und erst später im Zuge der ersten außerfamiliären Kontakte, auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder in der Schule, die zweite Sprache erwerben. Grundsätzlich gilt hier das Gleiche wie für den bilingualen Erstspracherwerb: Stimmen die sozialen und kognitiven Voraussetzungen und erhält das Kind ausreichende Zuwendung seitens der erwachsenen Ansprechpartner, kann man davon ausgehen, dass der etwas später einsetzende Erwerb einer zweiten Sprache zu einer gelungenen Zweisprachigkeit führt.
Die in der Theorie klare Unterscheidung zwischen gleichzeitigem und sukzessivem Erwerb ist in der konkreten Anwendung nicht ohne Kompromisse haltbar. Sie läuft auf die Frage hinaus, wie strikt Gleichzeitigkeit zu verstehen ist. Von ihr hängt die Definition des bilingualen Erstspracherwerbs ab. Obgleich er sich der Arbitrarität dieses Kriteriums bewusst ist, schlägt McLaughlin (1978, 9, 73, 99) drei Jahre als Altersgrenze vor. Wenn das Kind bis dahin regelmäßig mit zwei Sprachen Kontakt hatte, könne man das als bilingualen Erstspracherwerb betrachten. Deuchar und Quay (2000, 2) setzen diese Grenze auf ein Jahr herunter. De Houwer (1995, 223) legt sie bei einem Monat fest, wobei allerdings später in De Houwer (2009, 2) ein solches Limit nicht mehr erwähnt wird. Romaine (1999, 252) spricht sich hingegen für eine strikte Interpretation von Gleichzeitigkeit aus: Nur wenn ab der Geburt mit dem Kind zwei Sprachen gesprochen werden, könne man von bilingualem Erstspracherwerb sprechen. Die gleiche Auffassung finden wir bei Müller et al. (2011, 15). Ich definiere in diesem Buch den bilingualen Erstspracherwerb ebenfalls als sofort mit der Geburt beginnenden Kontakt mit zwei Sprachen.
Aber auch diese Definition ist selbstverständlich nicht unproblematisch. Im Grunde genommen müsste man nämlich die Zeit vor der Geburt in die Betrachtung mit einschließen. Bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat ist die Reifung des auditiven Systems des Fötus soweit fortgeschritten, dass Laute über den Körper der Mutter aufgenommen werden. Wie Studien der letzten Jahre gezeigt haben, reagiert das Baby im Mutterleib auf die prosodischen Muster, d. h. auf Tonhöhe, Rhythmus, Pausen und Intensität, der Sprache der Mutter und anderer Personen im Umfeld (Mehler et al. 1988; Szagun 2006, 47 f.; Mampe et al. 2009; Moon, Lagercrantz und Kuhl 2013), d. h. es gibt so etwas wie einen pränatalen Spracherwerb. Wenn ein Kind zur Welt kommt, kann es bereits zwischen der Sprache der Personen in der unmittelbaren Umgebung und anderen Sprachen unterscheiden. Zudem schließt die in diesem Buch verwendete Definition die zugegebenermaßen seltenen Fälle der passiven Bilingualität ein (Yip 2013, 120), bei denen ein Kind zwar zwei Sprachen von Geburt an hört, aber nur eine Sprache aktiv verwendet.
Yip und Matthews (2007, 26) weisen auf eine Gemeinsamkeit des bilingualen Erstspracherwerbs und des frühen Zweitspracherwerbs hin. In beiden Fällen ist der Erwerb der betroffenen Sprachen erst im Gange und noch längst nicht abgeschlossen. Deshalb ist auch in beiden Fällen gegenseitiger Spracheinfluss möglich. Beim Zweitspracherwerb in der Jugend oder im Erwachsenenalter kann man hingegen davon ausgehen, dass die Kompetenzen in der Erstsprache fast voll entwickelt sind. Der Spracheinfluss erfolgt hauptsächlich monodirektional von der Erstsprache zur Zweitsprache.
Zusätzlich wirft die Debatte über den gleichzeitigen und sukzessiven Spracherwerb die Frage auf, inwiefern der Unterschied zwischen der stärkeren und schwächeren Sprache eines bilingualen Kindes demjenigen zwischen der Erstsprache und der frühzeitig erworbenen Zweitsprache gleicht. Zwei Sichtweisen sind in diesem Zusammenhang zu erkennen (Bernardini 2003, 43). Auf der einen Seite wird angenommen, dass die Erwerbsmuster der beiden Sprachen, egal ob stärkere oder schwächere Sprache, denjenigen des jeweiligen monolingualen Erwerbs gleichen. Auf der anderen Seite ist der Standpunkt zu erkennen, dass die Erwerbsmuster der schwächeren Sprache eines bilingualen Kindes tendenziell denjenigen einer früh erworbenen Zweitsprache ähnlich sind. Die Ergebnisse der Studie von Bernardini (2003) scheinen eher für die zweite Annahme zu sprechen.
Bei der Unterscheidung zwischen bilingualem Erstspracherwerb und frühem Zweitspracherwerb berücksichtige ich in diesem Abschnitt bewusst nicht die Sprachkompetenzen, zu denen die beiden Erwerbssituationen führen. Auf der einen Seite kann früher Zweitspracherwerb selbstverständlich zu einer gelungenen Zweisprachigkeit führen. Auf der anderen Seite führt der Kontakt zu zwei Sprachen von Geburt an nicht automatisch zu Zweisprachigkeit. Abgesehen davon können sich aufgrund von veränderten Inputbedingungen die Sprachkompetenzen nicht vollständig entwickeln oder wieder abgebaut werden. Wie ich in Abschnitt 2.6 darstellen werde, kann die später erworbene Zweitsprache die Fähigkeiten in der Erstsprache gefährden (Chumak-Horbatsch 2008). Der unvollständige Erwerb der Erstsprache gepaart mit dem Sprachabbau kann so weit führen, dass die Erstsprache fast vollkommen aufgegeben wird, weshalb man von Sprachsubstitution (z. B. Francis 2011) sprechen kann. Yip (2013, 120) erwähnt als ein anderes Beispiel für Sprachsubstitution den Fall von adoptierten Kindern, die in ihrer neuen Familie mit einer neuen Sprache konfrontiert sind und ihre ursprüngliche Erstsprache aufgeben müssen (Ventureya und Pallier 2004; Footnick 2007; Pallier 2007, 161–165; Gauthier und Genesee 2011).
2.4 Bilinguale Kommunikation in der Familie und in ihrem Umfeld
Neben der Anzahl der involvierten Sprachen und dem Zeitpunkt des Einsetzens des Spracherwerbs dient als ein weiteres Kriterium zur Differenzierung und Charakterisierung frühkindlicher Bilingualität die kommunikative Praxis in der Familie und der umgebenden Gemeinschaft. In der Tat kann die zweisprachige Kommunikation in der Familie und im unmittelbaren Umfeld des Kindes höchst unterschiedlich ablaufen. In vielen Fällen treffen die Eltern bewusst oder unbewusst vorab eine Entscheidung hinsichtlich des sprachlichen Umgangs mit ihren Kindern. Wir können diesbezüglich zumindest sieben Konstellationen oder Sprachverteilungen in der bilingualen Kommunikation unterscheiden (Carpene 1999, 228; Romaine 1999, 253 f.; Barron-Hauwaert 2004, 163–178; De Houwer 2009, 87, 132–145; Müller et al. 2011, 48–52):
1. eine Person → eine Sprache (a): Die Eltern haben unterschiedliche Erstsprachen. Jeder Elternteil wendet sich nur in seiner Erstsprache an das Kind. Eine der beiden Sprachen ist auch diejenige der umgebenden Sprachgemeinschaft.
2. eine Person → eine Sprache (b): Die Eltern haben unterschiedliche Erstsprachen. Jeder Elternteil wendet sich nur in seiner Erstsprache an das Kind. Die Sprache der umgebenden Gemeinschaft ist jedoch verschieden von den Erstsprachen der Eltern. Diese Konstellation führt meist zu Trilingualität.
3. eine Person → eine Sprache (c): Die Eltern haben die gleiche Erstsprache. Diese ist auch die Sprache der umgebenden Gemeinschaft. Ein Elternteil wendet sich jedoch in einer von ihm sehr gut beherrschten Zweitsprache, d. h. in einer Fremdsprache, an das Kind. Diese Konstellation könnte man – wenngleich nicht ganz passend – artifizielle Bilingualität nennen.
4. Familiensprache ≠ Umgebungssprache (a): Die Eltern haben die gleiche Erstsprache. Die Sprache der umgebenden Gemeinschaft ist jedoch eine andere, von der die Eltern nur unzureichende Kenntnisse haben. Die Eltern sprechen mit dem Kind ihre Erstsprache. Das Kind erwirbt die Umgebungssprache durch andere Bezugspersonen.
5. Familiensprache ≠ Umgebungssprache (b): Die Eltern haben unterschiedliche Erstsprachen. Eine der beiden Sprachen ist diejenige der umgebenden Sprachgemeinschaft. Beide Elternteile sprechen mit dem Kind diejenige Sprache, die nicht Umgebungssprache ist.
6. Familiensprache ≠ Umgebungssprache (c): Die Eltern haben die gleiche Erstsprache. Diese ist auch die Sprache der umgebenden Gemeinschaft. Beide Elternteile kommunizieren mit ihrem Kind in einer von ihnen sehr gut beherrschten Zweitsprache. Diese Sprachverteilung ist ebenfalls der artifiziellen Bilingualität zuzuordnen.
7. Andere kontextuelle Verteilung der Sprachen: Die Eltern sind entweder bilingual oder haben unterschiedliche Erstsprachen mit guten Kenntnissen der Sprache des jeweiligen Partners. Die umgebende Sprachgemeinschaft kann ein- oder auch mehrsprachig sein. Die Eltern wenden sich in beiden Sprachen an das Kind, richten sich dabei jedoch weder nach dem Kriterium eine Person → eine Sprache noch nach dem Kriterium Familiensprache ≠ Umgebungssprache, sondern nach anderen kontextuellen Faktoren, wie Situation, Thema, weitere Gesprächspartner und so fort.
Es kann durchaus passieren, dass die implizit oder explizit anfangs festgelegte kommunikative Sprachverteilung modifiziert wird, beispielsweise weil sich im Lauf der Jahre die äußeren Umstände der Familie verändert haben oder weil sich die Verteilung als schwer durchführbar herausgestellt hat. Anzumerken ist außerdem, dass hier ausschließlich von bilingualen Familien die Rede ist. Im Falle der Trilingualität ist die Sprachverteilung selbstverständlich komplexer.
Eltern mögen vielleicht eine bewusste Entscheidung über die Verteilung der Sprachen im Umgang mit ihren Kindern treffen, hinsichtlich der Zweisprachigkeit an sich haben sie jedoch in den wenigsten Fällen eine Wahl. Wenn man von der artifiziellen Bilingualität absieht, ist in den anderen Konstellationen die Zweisprachigkeit im Grunde vorgegeben. Nur spezielle individuelle und gesellschaftliche Umstände, wie beispielsweise starker sozialer Druck seitens eines Elternteils, der Verwandtschaft und der umgebenden Sprachgemeinschaft, können dazu führen, dass in der Konstellation eine Person → eine Sprache (a) der andere Elternteil auf seine Sprache verzichtet. Das kann ein großes Opfer darstellen und unter Umständen bedeuten, dass ein Kind mit der Verwandtschaft dieses Elternteils gar nicht kommunizieren kann.
Alle oben beschriebenen Konstellationen haben gemeinsam, dass jeder Sprache ein bestimmtes Anwendungsgebiet zugeordnet wird. Es handelt sich daher um eine Trennung des Inputs nach Personen oder sprachlichen Bereichen. Die Trennung nach Person oder nach Familien- und Umgebungssprache erscheint auf den ersten Blick eindeutiger. In der alltäglichen Kommunikation kommt es jedoch häufig zu einer anderen kontextuellen Verteilung der Sprachen, da eine vollkommene Inputtrennung nach Person oder nach Familien- und Umgebungssprache im Grunde unmöglich ist. Die letzte der oben beschriebenen Sprachverteilungen ist daher in der Praxis sehr verbreitet. Fest steht, dass beide Konstellationen, eine Person → eine Sprache und Familiensprache ≠ Umgebungssprache, Vor- und Nachteile besitzen. Wenn zu rigide angewandt, haben beide den Nachteil, dass sie eine gewisse Künstlichkeit in der Kommunikation erzeugen. In größeren Familien, die neben Eltern und Kindern noch nahe Verwandte umfassen, kommt es vor, dass sich nicht alle Mitglieder an solche kommunikative Regeln halten können oder wollen.
Zur Beschreibung des Sprachverhaltens von bilingualen Erwachsenen verwendet Grosjean (2008) den Begriff des language mode (Grosjean 2013, 14–17). Er ist zum Teil für die alltägliche Kommunikation von bilingualen Kindern ebenfalls passend (Yip 2013, 125 f.). Das sprachliche Verhalten bewegt sich zwischen zwei Extremen, dem monolingualen Modus und dem bilingualen Modus. In jeder Situation gibt es eine durch kontextuelle Faktoren bestimmte Basissprache. Wenn das Kind mit Sprechern und Sprecherinnen nur einer Sprache interagiert, befindet es sich im monolingualen Modus. Eine Sprache ist voll aktiviert, die andere hingegen nur minimal. In Präsenz von Sprechern und Sprecherinnen beider Sprachen werden beide Sprachen aktiviert, das Kind befindet sich im bilingualen Modus. Zwischen diesen beiden Modi gibt es je nach Situation verschiedene Abstufungen. Wichtig ist, dass im monolingualen Modus eine der beiden Sprachen kognitiv unterdrückt wird. Das könnte ein Grund sein, warum bei Experimenten, in denen die kognitive Inhibition von Interferenzen getestet wird, bilinguale Kinder und Jugendliche bessere Ergebnisse erzielen als monolinguale Vergleichspersonen (Abschnitt 9.3).
Die auf den französischen Sprachwissenschaftler Maurice Grammont (1866–1946) zurückgehende Sprachverteilung eine Person → eine Sprache hat eine lange Tradition, wird jedoch in den letzten Jahren immer wieder in Frage gestellt (Lippert 2010, 65–82). Ein gewichtiger Nachteil der Konstellation ist, dass diejenige Sprache, die nicht Umgebungssprache ist, im Hinblick auf die Häufigkeit und Intensität des sprachlichen Inputs zu kurz kommen kann, besonders wenn sie von einem Elternteil gesprochen wird, der in der Familie weniger präsent ist. Yamamoto (2001) untersucht die Kommunikation in englisch-japanischsprachigen Familien, die in Japan leben. In den Familien von 46 Kindern sprachen die Eltern gemäß der Strategie eine Person → eine Sprache; acht dieser Kinder erwarben kein Englisch. In den Familien von 54 Kindern wurden die Sprachen nicht streng nach Elternteil getrennt. Jeder Elternteil sprach in beiden Sprachen zu seinem Kind und wechselte die Sprache je nach Situation und Kontext. Nur vier dieser Kinder erwarben kein Englisch. Lipperts (2010) Untersuchung der Strategie eine Person → eine Sprache bei elf in Rom lebenden deutsch-italienischsprachigen Familien zeigt die Schwierigkeiten beim Erhalt des Deutschen und den graduellen Übergang der Kinder zur Einsprachigkeit.
Ungünstig ist bei dieser Verteilung der Sprachen ebenfalls, dass die Familienmitglieder in Situationen, in denen sie alle beisammen sind, etwa beim gemeinsamen Abendessen, zu einem dauernden Wechseln der Sprachen gezwungen sind. Die rigide Sprachtrennung nach der Strategie eine Person → eine Sprache kann gelegentlich zu einem künstlichen Verhalten der Eltern führen, besonders wenn diese auch in zwiespältigen Situationen auf der Trennung der Sprachen bestehen. Wenn einer der beiden Elternteile nicht beide Sprachen beherrscht, kann die unflexible Anwendung dieser Strategie außerdem dazu führen, dass dieser Elternteil in vielen Situationen von der Konversation ausgeschlossen ist (De Houwer 2009, 314).
Es kann vorkommen, dass Kinder anfangs die Künstlichkeit der Sprachverteilung nach Person nicht durchschauen und dadurch zu falschen Rückschlüssen hinsichtlich des kommunikativen Verhaltens verleitet werden. Berühmt ist folgende Frage, die Leopolds Tochter Hildegard im Alter von vier Jahren an ihre Mutter richtete (Leopold 1949b, 59):
(1) Mother, do all fathers speak German? ‚Mama, sprechen alle Väter deutsch?‘
Ebenfalls bemerkenswert ist der von Tracy (2007, 7) geschilderte Fall eines Jungen namens Malte, der bilingual aufwuchs. Sein Vater sprach mit ihm Deutsch, seine Mutter vorwiegend, aber nicht ausschließlich, Englisch. Er selbst verstand beide Sprachen ausgezeichnet, wollte jedoch nie Englisch sprechen und antwortete seiner Mutter daher immer auf Deutsch. Bei Tonbandaufnahmen kam zufällig heraus, dass er bereit war, Englisch zu sprechen, wenn er bei Rollenspielen für eine weibliche Puppe sprechen sollte. Er war der Meinung, nur Frauen sprächen Englisch.
Die konkrete Sprachverteilung stellt immer einen Mittelweg dar zwischen der vollkommenen Trennung nach Person auf der einen Seite und Fehlen einer solchen Trennung auf der anderen. Hélot (2007, 74) erwähnt, dass die Hälfte der von ihr in Irland untersuchten bilingualen Eltern, die bewusst die Sprachverteilung eine Person → eine Sprache gewählt haben, erklärt, diese Regelung nicht systematisch einzuhalten. Vielen bilingualen Personen fällt es in der Tat schwer, monolingual zu agieren. Andere Untersuchungen über bilinguale Erwachsene haben gezeigt, dass nicht Sprachtrennung, sondern Sprachmischung der Normalfall ist, obwohl viele Erwachsene sich derer nicht bewusst sind oder diese sogar zu vermeiden suchen (Goodz 1989, 1994; Lanza 1997). Hélot (2007, 64) berichtet von einer Mutter, die erklärte, nach der Strategie eine Person → eine Sprache vorzugehen und ausschließlich Französisch mit ihrem Kind zu sprechen. Im Laufe der Audioaufnahmen stellte sich allerdings heraus, dass diese regelmäßig englische Wörter in ihren Äußerungen verwendete. Die Erklärung der Mutter reflektierte mehr ihr Wunschdenken als die Realität (Chumak-Horbatsch 2008, 18 f.). In der bilingualen Kommunikation ist es nahezu unmöglich, eine der beiden Sprachen aus dem Repertoire zu verbannen (Cruz-Ferreira 2006, 237–243).
Die Fokussierung auf die strikte Sprachtrennung nach Person übersieht außerdem die Lage in vielen nicht-westlichen Gesellschaften, in denen eine kontextuelle Sprachverteilung nach Situation, Thema, weiteren Gesprächspartnern und so fort als vollkommen natürlich angesehen wird. In Indien ist Mehrsprachigkeit nicht nur weitverbreitet, sondern wird von der Gesellschaft begrüßt und durch bildungspolitische Maßnahmen des Staates unterstützt. Nairs (1991) Studie schildert eindrucksvoll die Umgebung eines indischen Kindes. Neben den Eltern lebten in dem großen Haus die Großeltern, ein Onkel, eine Tante sowie das Hauspersonal. Der Vater sprach Bengali, die Mutter Malayalam, beide hatten in Großbritannien einen Teil ihrer Ausbildung absolviert und kommunizierten untereinander auf Hindi und Englisch. Weitere im Haus verwendete Sprachen waren Punjabi und Oriya, wobei sich die Sprecher und Sprecherinnen häufig gemischtsprachiger Äußerungen bedienten. Das hauptsächlich Hindi und Englisch sprechende Kind verbringt die meiste Zeit mit der Großmutter, in dessen Zimmer es auch schläft. Trotz dieser für westliche Begriffe bedenklichen Situation stellte sich heraus, dass die Entwicklung beider Sprachen bei dem Kind ähnlich derjenigen von monolingualen Kindern war. Yip und Matthews (2007, 11, 258) beschreiben die Rolle des Hauspersonals beim Spracherwerb und unterstreichen ebenfalls, dass in asiatischen Gesellschaften die durch Verwandte und Hauspersonal erweiterte Familie zur Tradition gehört und dadurch die Sprachverteilung ganz anders gestaltet sein kann.
Die Konstellation Familiensprache ≠ Umgebungssprache kann ihrerseits zur Folge haben, dass das Kind mit der Umgebungssprache erst verspätet in Kontakt kommt. Zudem kann bei dieser Konstellation die Gefahr bestehen, dass die Umgebungssprache einen erheblichen Druck auf die Sprache der gesamten Familie ausübt. Auf lange Sicht erscheint es in der Tat unmöglich, in der Kommunikation innerhalb der Familie die Umgebungssprache gänzlich zu vermeiden oder ein Kind von der Umgebungssprache fernzuhalten. Der autobiografische Roman von Hugo Hamilton The speckled people (2003) beschreibt das bilinguale und dann trilinguale Heranwachsen des Autors im Dublin der 1950er Jahre. Die Mutter war Deutsche und hatte einen irischen Ingenieur geheiratet. Der Vater, ein militanter irischer Nationalist, bestand darauf, dass seine Kinder Deutsch und Gälisch sprechen sollten. Das Englische verbot er ihnen. Nur beim Spielen mit anderen Kindern außerhalb des Hauses hatten sie Gelegenheit, Englisch zu erwerben. Doch auch dieses strenge und unnachgiebige Verbot konnte nicht verhindern, dass das Englische seinen Weg in die Familie fand und Hugo Hamilton zu einem bekannten, auf Englisch schreibenden Schriftsteller wurde.
In der alltäglichen Praxis bilingualer Familien trifft man die Konstellation Familiensprache ≠ Umgebungssprache seltener an als die Verwendung beider Sprachen innerhalb des Familienverbandes, sei sie nun gemischt oder nach Personen getrennt. Deprez (1994) untersucht die Kommunikationsbedingungen in 532 bilingualen Familien, die in Frankreich leben und neben Französisch eine zweite Sprache verwenden: In 14,33 % der Familien wird nur Französisch, in 8,33 % wird nur die zweite Sprache, in allen anderen Familien werden beide Sprachen gesprochen. Dies wird von Hélot (2007, 66 f.) bestätigt: Drei Viertel der von ihr befragten Familien wendeten die Strategie eine Person → eine Sprache an. Die Mehrzahl der 93 von Barron-Hauwaert (2004, 180) befragten Familien mehrsprachiger Kinder wendet die Strategie eine Person → eine Sprache an.
Vor allem dann, wenn es darum geht, eine Minderheitensprache an die nächste Generation weiterzugeben, wäre allerdings die Verteilung Familiensprache – Umgebungssprache wirksamer. Dies kann man zumindest aus De Houwers (2007) Befragung von 1778 bilingualen Familien in Belgien schließen. In den Familien wurde Niederländisch und eine von 73 anderen Sprachen gesprochen (Arabisch, Englisch, Französisch, Türkisch, usw.). Das Ziel der Befragung war herauszufinden, wie erfolgreich diese 73 Sprachen (Sprache X) jeweils an die Kinder weitergegeben wurden. Dabei wurde zwischen fünf Sprachverteilungen im Input der Eltern unterschieden (2007, 419): 1. Beide Elternteile sprechen nur die Sprache X; 2. ein Elternteil spricht nur die Sprache X, der andere die Sprache X und Niederländisch; 3. beide Elternteile sprechen die Sprache X und Niederländisch; 4. ein Elternteil spricht nur die Sprache X, der andere nur Niederländisch; 5. ein Elternteil spricht die Sprache X und Niederländisch, der andere nur Niederländisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein Kind in der Familie die Sprache X erwirbt, nahm von der ersten zur fünften Sprachverteilung deutlich ab (2007, 419): In der ersten Sprachverteilung lag sie bei 96,92 %, in der der zweiten bei 93,42 %, in der dritten bei 79,18 %, in der vierten bei 74,24 % und in der fünften nur noch bei 35,70 %. Zumindest im Hinblick auf die Weitergabe der Sprache, die nicht Umgebungssprache ist, war demnach die Strategie eine Person → eine Sprache (Sprachverteilung 4) weniger erfolgreich als die Strategie Familiensprache – Umgebungssprache (Sprachverteilung 1).
Die Beispiele von Studien zum bilingualen Erstspracherwerb, die ich in den Kapiteln 4 und 5 besprechen werde, betreffen zum Großteil die Konstellation eine Person → eine Sprache. Der 1961 in Paris geborene Sänger und Musiker Manu Chao ist hingegen ein beeindruckendes Beispiel für die erfolgreiche Anwendung des Prinzips Familiensprache ≠ Umgebungssprache. Seine Eltern, ein galicischer Journalist und eine baskische Künstlerin, waren wegen des Regimes von General Franco nach Frankreich emigriert. In der Familie, die ein bedeutender Treffpunkt lateinamerikanischer Intellektueller, Schriftsteller und Musiker war, wurde konsequent Spanisch gesprochen. Außerhalb der Familie, auf den Straßen der Pariser Vororte, wo Manu Chao und sein jüngerer Bruder ihre späteren Bandmitglieder kennenlernten, fand die Kommunikation natürlich auf Französisch statt. Manu Chao beherrscht heute beide Sprachen fließend. An seinen in ganz unterschiedlichen Sprachen verfassten Songs kann man darüber hinaus sein reges Interesse für die sprachliche Vielfalt erkennen.
2.5 Artifizielle Bilingualität
Zwei der im vorhergehenden Abschnitt besprochenen Konstellationen möchte ich getrennt behandeln, da sie heutzutage eine nicht zu unterschätzende Verbreitung haben, jedoch in der Forschung bislang wenig berücksichtigt wurden. Es handelt sich um die artifizielle Bilingualität, also um eine kommunikative Konstellation, in der sich die Eltern – beide oder nur ein Elternteil – konsequent in einer von ihnen sehr gut beherrschten Zweitsprache an das Kind richten. In der Regel ist das eine prestigeträchtige und international einsetzbare Sprache. In dem gerade beschriebenen Szenario sind die Erstsprache der Eltern und die Umgebungssprache identisch, und die Eltern verwenden eine damit nicht in Zusammenhang stehende Zweitsprache. Man sollte jedoch daneben Fälle berücksichtigen, in denen die Umgebungssprache für die Eltern eine Zweitsprache darstellt, die sie sehr gut beherrschen. Wir finden solche Fälle beispielsweise in Südtirol, wo gelegentlich italienischsprachige Eltern die Entscheidung treffen, mit ihren Kindern Deutsch zu sprechen.
Es handelt sich um eine Konstellation, die bei Eltern, Linguisten und Linguistinnen oft Skepsis weckt und zweifelsohne die Gefahr der Unnatürlichkeit in sich birgt. Sie findet allerdings in der heutigen Zeit immer mehr Verbreitung. Genaue Angaben darüber gibt es nur wenige: 435 der insgesamt 6236 von Akinci, De Ruiter und Sanagustin (2004) erfassten französischen Schüler und Schülerinnen erklärten, zu Hause Englisch zu sprechen, obwohl sie und ihre Eltern in den meisten Fällen in Frankreich geboren waren. Wahrscheinlich ist die Situation in anderen europäischen und außereuropäischen Staaten vergleichbar. Die Konstellation darf daher nicht unterschätzt werden. Sie wirft zweifelsohne eine Reihe von Fragen auf, nicht zuletzt diejenige, ob nicht-erstsprachlicher Input ebenfalls zu einer gelungenen Bilingualität führen kann.
Saunders (1982, 1988) beschreibt detailliert die ersten dreizehn Jahre seines eigenen Experiments mit der artifiziellen Bilingualität. Die Familie lebt zuerst in Hobart, der Hauptstadt der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien, und später in Melbourne und Sydney. Beide Elternteile sind englischer Muttersprache, der Vater, George Saunders, hat Germanistik studiert und spricht fließend Deutsch, die Mutter hat nur mäßige Deutschkenntnisse. Sie haben zwei Söhne, Thomas und Frank, und eine Tochter namens Katrina. George Saunders sieht einen Vorteil in der Tatsache, dass Deutsch nicht seine Erstsprache ist: Er ist mit dem Deutschen emotionell nicht so verbunden und toleriert daher leichter Fehler und Unregelmäßigkeiten seiner Kinder. Die Frage nach der Erstsprache des Vaters hat die Kinder übrigens nie besonders interessiert. Für sie ist es einfach eine Tatsache, dass der Vater Deutsch spricht.
In der Familie herrscht die kommunikative Konstellation eine Person → eine Sprache; der Vater spricht Deutsch, die Mutter Englisch, die Eltern sprechen miteinander Englisch und die Kinder untereinander auch Englisch. Für die Kinder bleibt der Vater jahrelang der einzige deutschsprachige Gesprächspartner. Ganz selten haben sie Kontakt mit anderen deutsch-englischsprachigen Personen und nie mit monolingualen Sprechern und Sprecherinnen des Deutschen. 1984, im elften Jahr des Experiments, verbringt die Familie sechs Monate in Deutschland. Erst da haben die Kinder zum ersten Mal Kontakt mit monolingualen Sprechern und Sprecherinnen des Deutschen.
Wie bei anderen bilingualen Kindern kommt es aufgrund der Konstellation eine Person → eine Sprache zu bemerkenswerten Rückschlüssen der Kinder: Frank äußert beispielsweise im Alter von 4;5 folgende Meinung (Saunders 1988, 82):
(2) Mummies don’t speak deutsch. ‚Mamas sprechen nicht deutsch.‘
Da das Deutsche des Vaters für die Kinder den Standard darstellt, sind sie anfangs über andere Varietäten des Deutschen erstaunt, die sie beispielsweise bei Filmen oder im Fernsehen hören (Saunders 1988, 137).
Im Unterschied zu Werner F. Leopold spricht der Vater in der Gegenwart von monolingualen englischsprachigen Kindern zuerst deutsch dann englisch mit seinen Kindern. Er ist der Meinung, dass die alleinige Verwendung des Englischen in solchen Situationen den deutschsprachigen Input zu drastisch reduzieren würde und außerdem den Kindern den falschen Eindruck vermitteln könnte, das Deutsche sollte man in der Öffentlichkeit vermeiden (Saunders 1988, 107). In der Tat haben die Kinder nie Scheu, in der Öffentlichkeit, beispielsweise im Kindergarten oder vor Schulkameraden, deutsch zu sprechen. Genauso wenig Scheu haben sie dann in Deutschland, mit ihrer Mutter öffentlich englisch zu sprechen. Interessanterweise betrachten die Kinder Deutsch zumindest eine Zeitlang als ihre eigene Sprache. Frank, der zweite Sohn, betrachtet es sogar fast als sein Eigentum (Saunders 1988, 136).
Die monolingualen Freunde der Kinder, Verwandte, Lehrer und Lehrerinnen und die monolinguale Umgebung im Allgemeinen stehen der Bilingualität in der Familie positiv gegenüber. Sie sind neugierig und wollen manchmal sogar die deutsche Übersetzung einer Äußerung hören (Saunders 1988, 106). Gelegentlich versuchen sie sogar, selbst ein paar deutsche Wörter zu sagen (Saunders 1988, 117). Ein paar Schwierigkeiten haben die Kinder dennoch zu überwinden (Saunders 1988, 119 f.). Es gibt zudem bei den beiden Söhnen eine je fünfmonatige Phase im Alter von 3;5 bzw. im Alter von 2;7, in der sie wenig Lust zeigen, mit ihrem Vater deutsch zu sprechen.
Wie das Experiment von Saunders (1982, 1988) zeigt, können Kinder auch in einer solchen kommunikativen Situation erfolgreich bilingual aufwachsen. Sicher ist jedoch, dass diese Art der Bilingualität von den Eltern neben exzellenten Sprachfähigkeiten ein nicht alltägliches Maß an Konstanz, Kohärenz und Einsatz erfordert. Um beispielsweise seine Kinder die deutsche Rechtschreibung zu lehren, übte der Vater mit ihnen vier- bis fünfmal pro Woche.
2.6 Semilingualität, unvollständiger Spracherwerb und Sprachabbau
Die in diesen Abschnitt zur Sprache kommenden Konzepte und Termini betreffen vor allem den Zweitspracherwerb, tauchen jedoch oft auch in Diskussionen über den bilingualen Erstspracherwerb auf.
Der Spracherwerb ist bei Schuleintritt in seinen Kernbereichen weit fortgeschritten, aber hinsichtlich Grammatik, Wortschatz und vor allem Lesen und Schreiben noch lange nicht abgeschlossen. Die Sprachkompetenzen müssen in der Schule zumindest bis zum Alter der Pubertät weiterentwickelt werden. Lesen und Schreiben sind elementare Fähigkeiten, die zur Entwicklung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten beitragen und erst eine sprachliche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Beim Erwerb der Lese- und Schreibkompetenzen wird nicht nur eine bestimmte Sprache mit ihrer Schrift, sondern Sprache und Schrift als solche werden erworben.
Bei Kindern, die sprachlichen Minderheiten angehören, passiert es jedoch häufig, dass die Weiterentwicklung der Erstsprache bei Schuleintritt abrupt unterbrochen wird und die Alphabetisierung in der gerade erst im Aufbau befindlichen Zweitsprache stattfindet. Das Ergebnis sind meistens geringere sprachliche, aber auch geringere allgemeine kognitive Fähigkeiten sowohl in der Erstsprache als auch in der Zweitsprache. Dieses zweifache sprachliche Defizit wurde in der Vergangenheit mit den in der skandinavischen Linguistik entwickelten Begriffen Semilingualismus oder doppelter Semilingualismus (Hansegård 1968; Skutnabb-Kangas und Toukomaa 1976; Toukomaa und Skutnabb-Kangas 1977) charakterisiert. In diesem Buch ziehe ich, im Sinne der gehandhabten terminologischen Praxis, die Bezeichnung Semilingualität vor. Zwei der in Abschnitt 3.2 besprochenen Hypothesen, die Schwellenhypothese und die Interdependenzhypothese (Toukomaa und Skutnabb-Kangas 1977; Cummins 1979), stehen mit diesem Begriff in Zusammenhang.
Wie Romaine (1995, 261–265) erklärt, ist der Begriff allerdings umstritten und wird von Forschern wie Tove Skutnabb-Kangas und Jim Cummins abgelehnt, da er primär in Zusammenhang mit ethnischen Minderheiten verwendet wurde und eine politische Bedeutung mit pejorativer Konnotation annahm. Die Semilingualität ist in der Tat in erster Linie auf politische und soziale, weniger auf individuelle oder kognitive Gründe zurückzuführen. Denken wir hier zum Beispiel an die Kinder lateinamerikanischer Einwanderer in den USA. Besonders in den 1960er und 1970er Jahren waren diese Kinder von Anfang an mit einem mehrheitssprachlichen Schulunterricht konfrontiert, obwohl ihre erstsprachlichen Kompetenzen noch nicht zur Genüge entwickelt waren. Diese Art des Spracherwerbs und -unterrichts wird manchmal Submersion genannt.
In einer Situation wie der gerade beschriebenen, in der die Erstsprache eine Minderheitensprache ist, können Faktoren wie der Druck der mehrheitlich anderssprachigen Umwelt, der assimilatorische Unterricht in der im wahrsten Sinne des Wortes dominanten Sprache und das geringe soziale Prestige der Minderheit und ihrer Sprache und Kultur die Fähigkeiten in der Erstsprache ernsthaft gefährden (Chumak-Horbatsch 2008; Bolonyai 2009). Lambert (1974) schlug diesbezüglich die Unterscheidung zwischen subtraktiver und additiver Bilingualität vor und wies auf die entscheidende Rolle der sozialen Gegebenheiten hin. Die Bilingualität dieser Kinder ist gefährdet, am Ende des Prozesses steht in vielen Fällen die Monolingualität, weshalb manche Autoren in diesem Zusammenhang auch von Sprachsubstitution (z. B. Francis 2011) sprechen.
Statt von Semilingualität wird in der heutigen Literatur zumeist von unvollständigem Spracherwerb und Sprachabbau gesprochen (Bolonyai 2009; Köpke und Schmid 2013). Chilla, Rothweiler und Babur (2013, 66 f.) verwenden auch den Terminus Sprachverlust. Die Begriffe unterscheiden sich insofern von demjenigen der Semilingualität, als sie sich lediglich auf den Zustand der Erstsprache beziehen. Aufgrund eines stark reduzierten Inputs können die Kompetenzen in der Erstsprache ernsthaft in Frage gestellt werden. Wenn diese Reduktion des Inputs vor der Pubertät eintritt, nimmt man an, dass der Erwerb der Erstsprache nicht abgeschlossen und daher unvollständig ist. Tritt eine starke und lang anhaltende Reduktion des Inputs im Erwachsenenalter ein, wird davon ausgegangen, dass eine schon vollständig erworbene Erstsprache allmählich wieder abgebaut wird. Der Abbau einer Sprache kann auch ein kollektives Phänomen sein und eine Sprache in einer mehrsprachigen Gesellschaft betreffen. Ich beziehe mich hier jedoch auf das individuelle Phänomen, bei dem durch reduzierten Input die Kompetenzen in der Erstsprache vermindert werden und im Extremfall sogar verloren gehen. In der englischsprachigen Literatur hat sich dafür der Terminus first language attrition (Kaufman und Aronoff 1991; Francis 2005; Schmid und Köpke 2013) durchgesetzt, den man mit dem deutschen Erstsprachabbau wiedergeben kann. Beide Phänomene, unvollständiger Erwerb und Sprachabbau, können gelegentlich auch im bilingualen Erstspracherwerb vorkommen. Allerdings ist hier die in der Theorie klare Trennlinie zwischen unvollständigem Erwerb und Sprachabbau nicht einfach zu ziehen (Bolonyai 2009, 256; Köpke und Schmid 2013, 17 f.). Die Entwicklung der Kompetenzen in einer der beiden Sprachen kann durch stark verminderten Input unterbrochen werden. Genauso gut ist vorstellbar, dass bestimmte schon voll entwickelte Kompetenzen wieder abgebaut werden.
Der unvollständige Erwerb und der Sprachabbau manifestieren sich durch generelle Unsicherheit beim Sprachgebrauch, Wortfindungsprobleme, Häsitationsphenomene und durch verstärkten Einfluss der anderen Sprache. Zudem sind sie von Sprachmischung begleitet. Es muss jedoch unterstrichen werden, dass das Gegenteil nicht zutrifft (Bolonyai 2009, 253; Anstatt und Rubcov 2012, 75): Die Sprachmischung weist weder automatisch auf unvollständigen Erwerb und Sprachabbau hin noch führt sie automatisch zu unvollständigem Erwerb und Sprachabbau. Die Sprachmischung hat keine inhärent negative Wirkung auf eine der beiden Sprachen.
2.7 Verschiedene ‚Sprachen‘
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit Muttersprache die Sprache bezeichnet, die man als Kind von den Eltern erwirbt und während eines Großteils der Kindheit verwendet, in der man sich spontan ausdrücken kann, in der man denkt und sich zu Hause fühlt. Bilinguale Kinder haben in diesem Sinn also zwei Muttersprachen, aber natürlich nicht zwei Mütter. Muttersprache kann jedoch noch etwas anderes bedeuten und zwar einfach die Sprache der Mutter. Im Kontext des bilingualen Erstspracherwerbs kommt nur diese zweite Bedeutung zum Tragen. Muttersprache steht hier im Gegensatz zu Vatersprache und bezeichnet vor allem in einer Familie, in der die Konstellation eine Person → eine Sprache herrscht, einfach die Sprache, die die Mutter mit dem Kind spricht. Im Laufe dieses Buches werde ich für die anfangs erwähnte Bedeutung den Terminus Erstsprache verwenden und daher vom bilingualen, doppelten oder zweifachen Erstspracherwerb sprechen.
Bei der Besprechung der bilingualen Kommunikation in der Familie und in ihrem Umfeld habe ich bereits den Begriff der Umgebungssprache eingeführt und ihn der Familiensprache gegenüber gestellt. Die Umgebungssprache ist in der Regel die Sprache der nationalen, regionalen oder auch lokalen Gemeinschaft, in dem das zweisprachige Kind aufwächst. Selbstverständlich kann die Situation komplexer sein als hier beschrieben. Die Umgebungssprache kann auf die lokale Gemeinschaft beschränkt und die nationale Sprache eine andere sein. Die Umgebungssprache gewinnt mit zunehmendem Alter, sobald die Kinder Spielkameraden kennen lernen, den Kindergarten oder die Schule besuchen, an Bedeutung, so dass sie oft zur starken Sprache wird.
Meist ist die Schulsprache die Sprache der jeweiligen lokalen Bevölkerung, das heißt Schulsprache und Umgebungssprache sind gleich. Es gibt allerdings zahlreiche Fälle, in denen das nicht so ist. In Algerien findet der Unterricht, auch in den berbersprachigen Gebieten, während der ersten neun Jahre der Grundschule auf Arabisch statt. In den Gymnasien und auf der Universität wird jedoch auf Französisch unterrichtet. Eine vergleichbare Situation finden wir in den anderen Staaten des Maghreb sowie in Westafrika. Welche Sprache als Schulsprache anerkannt wird, ist oft Thema politischer Auseinandersetzungen und kann im Extremfall als politisches Druckmittel dienen. Im Kosovo wurde in der Zeit der Regierung von Slobodan Milošević an den Universitäten das Albanische zugunsten des Serbischen abgeschafft, obwohl die weit überwiegende Bevölkerungsmehrheit albanischsprachig war.
Die Zählsprache ist bei mehrsprachigen Individuen nicht unbedingt die starke Sprache, sondern die Sprache, in der sie Zählen und Rechnen gelernt haben, d. h. im Regelfall die Schulsprache. Zählen und Rechen sind stark fixierte und automatisierte, über die Sprache im Gedächtnis gespeicherte Operationen, die sprachlichen Verschiebungen widerstehen und sich auch in einer schwach gewordenen Sprache halten können. Jeder Leser und jede Leserin, der oder die längere Zeit im Ausland verbracht und sich Telefonnummern in einer Fremdsprache gemerkt hat, kann diese Fixierung und Automatisierung einer einmal gelernten Zahlenkombination an sich selbst beobachten: Auch nach mehreren Jahren erfolgt das Ins-Gedächtnis-rufen der Telefonnummer leichter und spontaner in der Form, in der sie damals zuerst memorisiert wurde. Überhaupt stehen Sprache und autobiografisches Gedächtnis in engem Zusammenhang (Pavlenko 2011, 243 f., 2014, 191–194; De Groot 2013, 186–89). Marian und Neisser (2000) zeigen mit einem Experiment, dass sich Personen an vergangene Ereignisse besser sprachlich zurückerinnern können, wenn das in derjenigen Sprache passiert, in der sich das Ereignis tatsächlich abspielte.
Mehrsprachige werden oft gefragt, in welcher Sprache sie träumen. Eine Traumsprache im eigentlichen Sinne gibt es jedoch nicht. Mehrsprachige träumen nicht nur in einer Sprache. Im Traum sind die Sprachen so verteilt wie im täglichen Leben, und Personen, die im realen Leben eine andere Sprache sprechen, erscheinen dem mehrsprachigen Individuum im Traum ebenfalls so (Rūķe-Draviņa 1967, 38 f.). Deshalb ist es durchaus möglich, dass man sogar in einer Fremdsprache träumt oder, genauer gesagt, im Traum mit Personen in einer Fremdsprache kommuniziert.
In Bezug auf Kinder ist natürlich auch die Frage nach der Spielsprache von Bedeutung. Diese variiert je nach Spielpartner und -partnerin. Bis zu einem bestimmten Alter scheinen Kinder weniger Wert auf eine korrekte sprachliche Form zu legen, sie sind also in gewisser Hinsicht toleranter. Für sie zählt in erster Linie die effektive Kommunikation während des Spiels (Leopold 1949b, 99, 118). Aus diesem Grund stellt Spielen die ideale Erwerbsumgebung für bilinguale Kinder dar. Hinzu kommt, dass der spielerische Kontakt mit Gleichaltrigen die Einstellung und Motivation bezüglich der jeweiligen Sprache besonders günstig beeinflusst. Aufgrund seines großen Stellenwertes bei Kindern sollte das Spiel in der schwachen Sprache so stark wie möglich gefördert werden.
Da bilinguale Kinder zwei Sprachen beherrschen, taucht gelegentlich die Frage auf, ob und wie gut sie zu übersetzen vermögen. Sicher sind sie, wie alle Kinder, keine professionellen Dolmetscher oder Übersetzer, jedoch bringen sie wichtige Voraussetzungen dafür mit. Fest steht, dass Übersetzungen für sie noch keinen besonderen Stellenwert einnehmen. Spontane Übersetzungen einzelner Wörter können trotzdem verhältnismäßig früh vorkommen. Die von Cruz-Ferreira (2006, 81–86) angeführten Beispiele beginnen im Alter von 1;5. Im Alter von 1;8 sagte Emma, meine ältere deutsch-italienischsprachige Tochter, zu mir zuerst ape und nach einer kurzen Pause Biene; einen Monat später übersetzte sie Wal mit balena. Ob es sich hier wirklich um Übersetzungen handelt oder eher um Anpassungsversuche an die Sprache des Gesprächspartners, ist in diesem Stadium schwer zu sagen. In einem späteren Alter übersetzen bilinguale Kinder ganze Äußerungen. Die Übersetzungen sind zumeist der Situation angemessen, aber selten wörtlich (Leopold 1949b, 105). Deshalb sollte man besser von Übertragungen sprechen. Ronjat (1913, 81 ff.) beschreibt sehr schön, wie sein Sohn Louis im Alter von 2;2 französischsprachige Anweisungen der Verwandten an die deutschsprachige Köchin weitergibt. Louis scheint sogar Gefallen daran zu finden, dem Vater auf Französisch die deutschsprachigen Äußerungen der Mutter zu verdeutlichen. Im Alter von 11;6, während eines Urlaubs in Sardinien, verfasste meine Tochter Emma ein mit Zeichnungen und Texten ausgestattetes Tagebuch und entschied ganz von selbst, dieses durchgehend zweisprachig zu gestalten. Bilinguale Kinder mögen es allerdings gar nicht, wenn ihre beiden Sprachen von Erwachsenen auf die Probe oder zur Schau gestellt werden. Bei solchen Gelegenheiten übersetzen sie nur ungern.