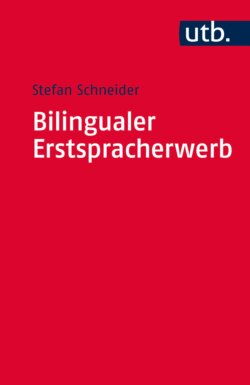Читать книгу Bilingualer Erstspracherwerb - Stefan Schneider - Страница 8
Оглавление4 Forschungsüberblick: frühe Studien
4.1 Ronjat (1913)
Anfang des 20. Jahrhunderts entstehen die ersten Studien zur Kindersprache und zum Spracherwerb. Der Sprachwissenschaftler Maurice Grammont (1866–1946) fasst 1902 in einem Aufsatz seine Beobachtungen zur Kindersprache zusammen (Grammont 1902). Das ein paar Jahre später erschienene Buch des Ehepaares Clara (1877–1948) und William (1871–1938) Stern über die Kindersprache (Stern und Stern 1907) stellt einen Höhepunkt in der damaligen Spracherwerbsforschung dar. Nicht lange danach, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, erwacht dann das wissenschaftliche Interesse für die frühkindliche Mehrsprachigkeit. Linguisten, Mediziner, Psychologen und Soziologen machen sich zum ersten Mal Gedanken über den Erwerb zweier oder mehrerer Sprachen im Kindesalter und die daraus resultierende frühkindliche Mehrsprachigkeit. Die erste diesbezügliche Studie verdanken wir dem französischen Sprachwissenschaftler und Romanisten Jules Ronjat (1864–1925), der im Jahr 1913 seine Beobachtungen zur Entwicklung seines zweisprachig aufwachsenden Sohnes Louis veröffentlicht. Jules Ronjat bezieht sich in seinem Buch auf Grammont (1902) und Stern und Stern (1907) und vergleicht seine Daten mit denjenigen aus dem monolingualen Erstspracherwerb. Die Studie ist in vieler Hinsicht innovativ und bahnbrechend; sie stellt unter anderem die erste ausführliche Beschreibung des Versuchs dar, ein Kind gemäß der Erwerbskonstellation eine Person → eine Sprache zu erziehen. Interessant ist die Studie noch heute, weil in ihr viele der Themen und Fragestellungen zur Sprache kommen, die in der heutigen Forschung eine zentrale Rolle spielen.
Gleich nach der Einleitung, in einem mit Méthode suivie pour apprendre les deux langues betitelten Kapitel, schreibt Jules Ronjat, er habe kurz nach dem 30. Juli 1908, dem Tag der Geburt seines Sohnes, von seinem Kollegen Maurice Grammont einen Brief mit der folgenden Empfehlung erhalten:
Il n’y a rien à lui apprendre ou à lui enseigner. Il suffit que lorsqu’on a quelque chose à lui dire on le lui dise dans l’une des langues qu’on veut qu’il sache. Mais voici le point important : que chaque langue soit représentée par une personne différente. Que vous par exemple vous lui parliez toujours français, sa mère allemand. N’intervertissez jamais les rôles. De cette façon, quand il commencera à parler, il parlera deux langues sans s’en douter et sans avoir fait aucun effort spécial pour les apprendre. (Ronjat 1913, 3)
‚Es gibt nichts, was man ihm beibringen oder ihn lehren müsste. Es genügt, dass man, wenn man ihm etwas sagen möchte, ihm das in einer der Sprachen sagt, die er erwerben soll. Der wichtige Punkt ist jedoch: Jede Sprache sollte durch eine unterschiedliche Person vertreten sein. Sie zum Beispiel sollten mit ihm immer Französisch sprechen, seine Mutter Deutsch. Tauschen Sie nie die Rollen. Auf diese Weise wird er, wenn er zu sprechen beginnt, die Sprachen sprechen, ohne einen Zweifel zu haben und ohne eine spezielle Anstrengung zu ihrem Erwerb gemacht zu haben.‘
Jules Ronjat befolgt diesen Ratschlag. Die Familie lebt in Vienne (an der Rhône südlich von Lyon). Der Vater spricht Französisch mit dem Sohn, die Mutter Deutsch. Wenn die ganze Familie beisammen ist, zum Beispiel bei Tisch, unterhält man sich auf Deutsch, außer es sind Personen anwesend, die des Deutschen nicht mächtig sind. Wendet sich Louis bei solchen Gelegenheiten an seinen Vater, tut er dies immer auf Französisch. Einmal verwendet Jules Ronjat bei Tisch das deutsche Wort Approbation mit einer deutschen Aussprache. Louis kennt es nicht und fragt seinen Vater Qu’est-ce que c’est, approbation? ‚Was ist das, Approbation?‘ mit der korrekten französischen Aussprache (Ronjat 1913, 73).
Die Familie ist verhältnismäßig wohlhabend und kann sich Hauspersonal leisten. Louis wird teils von deutschsprachigen teils von französischsprachigen Kindermädchen betreut und wächst zu einem fließenden Sprecher beider Sprachen heran. In einem Brief vom 27. Oktober 1923 berichtet Jules Ronjat, dass sein Sohn beide Sprachen gleichermaßen in der alltäglichen Konversation verwendet; in technischen Belangen zieht er allerdings Französisch vor, während er als Literatursprache Deutsch bevorzugt (Vildomec 1971, 25).
Der dem Buch zu Grunde liegende Untersuchungszeitraum umfasst die ersten 52 Lebensmonate des Kindes. Zumindest in dieser Zeit genießt Louis ebenso viel Input auf Deutsch wie auf Französisch. Dies wird von Ronjat (1913, 7–10) genau dokumentiert. Die Familie hat neben den Kindermädchen auch noch deutschsprachige Köchinnen. Außerdem bekommt sie regelmäßige Verwandtenbesuche aus Deutschland. Zu den Anfängen der Sprache seines Sohnes schreibt Ronjat (1913, 75):
Du 13e au 16e mois il n’a presque que des mots du vocabulaire commun issus d’onomatopées ou donnés en Ammensprache. Mais dès le 16e se manifestent nettement l’existence des deux collections et leur usage distinct [...].
‚Vom 13. bis zum 16. Monat hat er fast nur Wörter des gemeinsamen Wortschatzes, die von Onomatopöien oder der Ammensprache herrühren. Aber ab dem 16. Monat zeigt sich deutlich das Bestehen zweier Wortsammlungen und ihre getrennte Verwendung.‘
Obgleich sowohl der Vater als auch die Mutter beide Sprachen beherrschen, wird es Louis erst um den 28. Lebensmonat klar, dass er sich an seine Eltern und an bestimmte andere Personen in beiden Sprachen wenden kann. Ungefähr mit drei Jahren entwickelt sich bei ihm das Bewusstsein, zwei Sprachen zu sprechen, und bald danach kann er diese auch benennen. Insgesamt gesehen kann Jules Ronjat bei seinem Sohn keine Anzeichen für eine Behinderung der intellektuellen Fähigkeiten durch die Bilingualität feststellen und versucht in seinem Buch, ein damals gängiges Vorurteil zu entkräften. Ich werde noch auf diese in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitete Meinung zu sprechen kommen, dass sich die Bilingualität negativ auf die intellektuelle Entwicklung auswirken könnte. Die intellektuellen und kognitiven Auswirkungen der Bilingualität stellen noch heute ein zentrales Thema der Forschung dar.
Bei der Analyse der von seinem Sohn beherrschten Laute unterstreicht Ronjat (1913, 12, 14, 16, 36) an mehreren Stellen, dass dieser von Anfang an über zwei separate Lautsysteme verfügt. Der Zeitpunkt, an dem zwei getrennte Sprachsysteme erkennbar sind, wird später in der Psycholinguistik ebenfalls eine intensiv diskutierte Frage darstellen. Für eine länger anhaltende, stabile Übertragung von Lauten der einen Sprache auf die andere kann Jules Ronjat keine Indizien finden. Louis besitzt in beiden Sprachen eine mit monolingualen Kindern vergleichbare Aussprache. Ronjat (1913, 57 ff.) stellt sich auch die Frage, ob sein Sohn im Vergleich zu monolingualen Kindern etwas später eine korrekte Aussprache erworben habe, und kommt zu dem Schluss, dass die leichte, ca. fünfmonatige Verspätung wahrscheinlich individueller Natur ist und nicht auf die Bilingualität zugeführt werden kann. In der Tat ist man heute der Ansicht, dass sowohl im monolingualen als auch im bilingualen Erstspracherwerb eine erhebliche Variation bezüglich der Zeit besteht, in der Kinder zu sprechen beginnen (Meisel 2004, 95).
Bezüglich Wortschatz und Syntax kann Ronjat (1913, 36) ebenfalls keine konstanten Unregelmäßigkeiten feststellen:
On verra [...] que les emprunts authentiques de langue à langue en matière de vocabulaire et de syntaxe se réduisent en somme à peu de chose et n’affectent pas la correction générale du langage, que de bonne heure notre sujet a pu s’exprimer très convenablement dans les deux langues à peu près comme le fait dans une seule la moyenne des enfants monoglottes (nés dans des milieux cultivés) dont les parents s’occupent assidüment, et que de très bonne heure il a pu faire, non certes des traductions, mais d’exactes transmissions de messages d’une langue dans l’autre.
‚Man wird sehen [...], dass sich insgesamt die wirklichen Entlehnungen von einer Sprache in die andere, die den Wortschatz und die Syntax betreffen, auf wenig beschränken und nicht die allgemeine Korrektheit der Sprache beeinträchtigen, dass unser Subjekt früh lernte, sich in beiden Sprachen sehr passend auszudrücken, ungefähr so wie es in einer Sprache die (in einem kultivierten Milieu geborenen) monolingualen Kinder tun, mit denen sich die Eltern gewissenhaft beschäftigen, und dass er sehr früh, sicherlich keine Übersetzungen, aber doch genaue Übertragungen von Mitteilungen von einer in die andere Sprache machen konnte.‘
Natürlich verwendet Louis gelegentlich in einem französischen Satz ein deutsches Wort und vice versa, aber ab dem 43. Lebensmonat werden solche Erscheinungen sehr selten (Ronjat 1913, 60). Manchmal behilft sich Louis mit zwar interessanten, aber zielsprachlich falschen Lehnübersetzungen: z. B. tuyau statt chambre à air für ‚Fahrradschlauch‘ oder Moos statt Schaum für ‚Schaum‘.
4.2 Leopold (1939–1949)
Die nächste wichtige Arbeit nach Ronjat (1913) ist die über die Grenzen des bilingualen Erstspracherwerbs hinaus bekannte Studie Werner F. Leopolds (1896–1984) über die zweisprachige Entwicklung seiner Töchter Hildegard und Karla, wobei das Hauptgewicht auf den Betrachtungen zur ersten Tochter liegt. Werner F. Leopold war 1925 in die Vereinigten Staaten emigriert, hatte dort eine deutschstämmige Amerikanerin geheiratet und notierte ab der achten Woche nach der Geburt Hildegards im Jahre 1930 systematisch seine Beobachtungen. Zwischen 1939 und 1949 veröffentlichte er diese in einem vierbändigen Werk, das als ein Meilenstein nicht nur der Bilingualitätsforschung, sondern auch der Psycholinguistik im Allgemeinen angesehen werden kann. Einige wichtige Aspekte seiner Untersuchung werden in Leopold (1953, 1954) zusammengefasst. Werner F. Leopold war, wie Jules Ronjat, Sprachwissenschaftler. Im Vorwort des ersten Bandes dankt er dem bekannten amerikanischen Linguisten Leonard Bloomfield (1887–1949) für die Durchsicht des Manuskriptes.
Die Familie lebt in der Stadt Evanston im Bundesstaat Illinois. Auch bei ihr herrscht in der Kommunikation mit dem Kind der Grundsatz eine Person → eine Sprache: Werner F. Leopold spricht Deutsch mit Hildegard, seine Frau Marguerite Englisch. Im Gespräch miteinander verwenden die Ehepartner interessanterweise ihre jeweilige Erstsprache. Zweimal, von Juni bis September 1931 und von Juni 1935 bis Januar 1936, hält sich die Familie in Deutschland auf. Wie sich Leopold (1939, 13) erinnert, wechselte die Mutter während des ersten Aufenthaltes in Deutschland in ihrer Kommunikation mit Hildegard zum Deutschen. 1936 kommt die zweite Tochter, Karla, zur Welt. Auch sie wird bilingual erzogen.
Die Studie zeichnet sich durch außergewöhnliche Genauigkeit und großen Reichtum an Daten aus. Die Qualität der Aufzeichnungen ist so hervorragend, dass sie in den nachfolgenden Jahrzehnten wiederholt zu Vergleichszwecken herangezogen wurden. Von Hildegards achter Lebenswoche bis zu ihrem sechsten Lebensjahr führte Werner F. Leopold akribisch Tagebuch über die sprachliche Entwicklung. Insbesondere registrierte er fast alle Wörter, die Hildegard bis zu ihrem zweiten Lebensjahr produzierte. Der erste Band des Werkes enthält auf mehr als hundert Seiten den gesamten Wortschatz Hildegards, gefolgt von einer Chronologie der dort vermerkten Wörter. Aufgrund der damit verbundenen Arbeitsanstrengung nimmt Leopold (1949b, 136) allerdings von systematischen Aufzeichnungen über die zweite Tochter Abstand. Alle vier Bände enthalten jedoch zahlreiche Anmerkungen, Vergleiche und Fußnoten bezüglich der Daten von Karla. Die Einträge und Angaben betreffen vor allem Hildegards bilinguale Entwicklung bis Ende 1936. Die Einträge ab dem Jahr 1937 umfassen nur noch wenige Seiten. Der letzte Tagebucheintrag stammt aus dem Jahr 1946.
Der Wortschatz Hildegards bleibt bis zur Mitte des zweiten Lebensjahres verhältnismäßig ausgewogen (Leopold 1939, 161). Die Anzahl der aktiven deutschen und englischen Wörter ist bis 1;5 in etwa gleich, die Anzahl der neu erworbenen Wörter ist bis 1;3 in den beiden Sprachen ebenfalls vergleichbar. Danach wächst das englische Lexikon allerdings sprunghaft. Das Mädchen erwirbt monatlich fast dreimal so viele englische als deutsche Wörter, und die englischen Wörter zeichnen sich durch eine größere Permanenz aus, so dass der Wortschatz um 1;11 viermal so viele aktive englische als rein deutsche Wörter enthält.
Der zweite Band (Leopold 1947) ist dem Lautsystem gewidmet. Leopold (1947) geht von Jakobsons (1969 [1941]) Konstanten in der Reihenfolge des Lauterwerbs aus und weist nach, dass diese mit Ausnahme von Details von seinen Daten bestätigt werden. Auch Leopold (1947) ist der Meinung, dass sich das Lautsystem nach phonologischen statt nach phonetischen Kriterien entwickelt. Im Unterschied zur Phonetik, die die konkreten Eigenschaften der Laute untersucht, beschäftigt sich die Phonologie mit der Stellung und Funktion der Laute im System einzelner Sprachen. Eines ihrer zentralen Aufgabengebiete besteht in der Ermittlung der Phoneme, d. h. der kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer Sprache. Die Sprachen der Welt enthalten zusammen etwa 600 Konsonanten und 200 Vokale. Jede Sprache hat ein für sie charakteristisches Inventar von Konsonanten und Vokalen, die in diesem Fall Phoneme genannt werden. Bilinguale Kinder stehen vor der Aufgabe, im Laufe ihres Spracherwerbs zwei Phoneminventare erwerben zu müssen, im Falle von Hildegard die Inventare des Deutschen und Englischen. Aufgrund der phonologischen Nähe der beiden Sprachen tritt in den ersten beiden Jahren keine Phonemkollision ein. Die Phoneme, die nur für eine der Sprachen charakteristisch sind, werden erst später erworben. Leopold (1954, 25) kann in dieser Zeit nur wenige lautliche Erscheinungen ausmachen, die auf die Bilingualität seiner Tochter zurückzuführen sind. Die festgestellten Lautvereinfachungen und -ersetzungen sind zumeist auch im monolingualen Erwerb nachweisbar.
Im dritten Band wird Hildegards Grammatikentwicklung während der ersten beiden Lebensjahre besprochen. Leopold (1949a, 179) hebt an mehreren Stellen hervor, dass Hildegard ein hybrides, aus Elementen beider Sprachen bestehendes System aufgebaut hat:
The fact, repeatedly emphasized, that Hildegard did not yet try to keep the two language instruments apart, but built a hybrid system out of elements of both, is brought out in spotlight illumination by certain instances, in which she replaced a word presented in one language by a word from the other in her own, immediately following reaction. This was, of course, always a word which happened to be current in her own speech. Passively she realized that she was faced with two languages, which contained interchangeable words of identical reference. This must be considered a preparatory stage for active bilingualism of a later time.
‚Die wiederholt unterstrichene Tatsache, dass Hildegard noch nicht versuchte, die beiden Sprachwerkzeuge zu trennen, sondern ein hybrides System aus Elementen beider aufbaute, tritt in bestimmten Fällen ans Tageslicht, in denen sie ein in einer Sprache präsentiertes Wort in ihrer unmittelbar darauf folgenden Reaktion durch eines der anderen ersetzte. Das war natürlich immer ein Wort, das in ihrem Sprechen gerade geläufig war. Passiv war sie sich bewusst, mit zwei Sprachen konfrontiert zu sein, die austauschbare Wörter mit identischer Bedeutung enthalten. Das muss als Vorbereitungsstadium für eine spätere aktive Bilingualität betrachtet werden.‘
Vielleicht noch deutlicher wird das in Leopold (1954, 24) formuliert:
[...] infants exposed to two languages from the beginning do not learn bilingually at first, but weld the double representation into one unified speech system.
‚Kinder, die von Anfang an mit zwei Sprachen konfrontiert sind, lernen zuerst nicht zweisprachig, sondern fügen die doppelte Repräsentation zu einem einzigen System zusammen.‘
In einer anderen Passage unterstreicht Leopold (1949a, 181) noch einmal den hybriden Charakter von Hildegards Wortschatz und Äußerungen:
As long as she got along with a vocabulary drawn from both languages, she had no hesitation to combine items from both in single statements of more than a word.
‚Solange sie mit einem aus beiden Sprachen gespeisten Wortschatz auskam, zögerte sie nicht, Elemente aus beiden in einzelnen Mehrwortäußerungen zu kombinieren.‘
Leopold (1949a, 186) ist der Meinung, dass man in diesem Stadium noch gar nicht von zwei verschiedenen Sprachen sprechen könne. Hier können wir einen wesentlichen Unterschied zu Ronjats (1913), freilich weniger detaillierten, Beobachtungen erkennen: Dieser geht davon aus, dass sein Sohn Louis von Beginn an zwei getrennte Sprachsysteme aufbaut.
Erst nach dem zweiten Jahr erkennt Hildegard, dass sie es mit zwei verschiedenen Sprachen zu tun hat. Kurz nach ihrem zweiten Geburtstag benennt sie zum ersten Mal eine der beiden Sprachen – Deutsch – mit ihrem Namen, während sie vorher nur implizit mit I say oder you say oder mit How does Mama say it? darauf verwies (Leopold 1954, 28).
Werner F. Leopold weist auch darauf hin, dass Zweisprachige früher zwischen einem Ausdruck, d. h. einer Folge von Lauten, und der damit transportierten Bedeutung unterscheiden können. Hildegard erkannte sehr schnell, dass Wörter nichts anderes als arbiträre Etiketten sind, die nur auf Bedeutungen hinweisen und diese nicht selbst darstellen: „Bilingualism, however, helps to break down the intimate association between form and content“ (Leopold 1949a, 182). ‚Zweisprachigkeit hilft jedoch, die enge Verbindung zwischen Form und Inhalt aufzulösen.‘
Das Wissen um diese fundamentale Eigenschaft von sprachlichen Zeichen ist ein Aspekt des metalinguistischen Bewusstseins. Wie wir sehen werden, ist die Frage des metalinguistischen Bewusstseins in der heutigen Forschung zum bilingualen Erstspracherwerb hochaktuell. Mit der oben erwähnten Beobachtung deckt sich auch die folgende bemerkenswerte Feststellung Leopolds (1949a, 187 f.):
Hildegard never clung to words, as monolingual children are often reported to do. She did not insist on the exact wording of fairy tales. She often reproduced even memorized materials with substitution of other words [...].
‚Hildegard hielt nie an Wörtern fest, wie das von einsprachigen Kindern oft erzählt wird. Sie bestand nicht auf der exakten Formulierung von Märchen. Oft ersetzte sie Wörter sogar beim Wiedererzählen von auswendig gelernten Passagen.‘
Die losere Verbindung zwischen Ausdruck und Bedeutung begünstigt die Aktivierung von Synonymen und Paraphrasen und führt dadurch zu einer gesteigerten Originalität von Hildegards Sprache. Damit widerspricht Werner F. Leopold einem damals verbreiteten Vorurteil bezüglich der geringeren sprachlichen Kreativität bilingualer Individuen.
Werner F. Leopold ist sich klar darüber, dass der deutschsprachige Input zu gering ist, um eine ausgewogene Zweisprachigkeit sicher zu stellen. Wie Leopold (1953, 13) betont, unterscheidet sich Hildegards Sprachkompetenz erheblich von der nahezu perfekten Bilingualität von Jules Ronjats Sohn. Mehrmals weist er auf Hildegards mangelhaftes Deutsch hin, gibt jedoch zu bedenken, dass die monolingualen gleichaltrigen Kinder, mit denen sie während des siebenmonatigen Deutschlandaufenthalts spielt, ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten bei den Artikeln und Suffixen an den Tag legen (Leopold 1945b, 100, 102, 109, 110, 114, 118). Überdies zeigt Hildegard auch im Deutschen bei regelmäßigem Input erstaunliche Fortschritte. Gegen Ende des Aufenthalts in Deutschland entspricht ihr Deutsch in etwa ihrem Englisch vor der Abreise nach Europa. Auf alle Fälle wird ihr Englisch durch den deutschen Einfluss nicht beeinträchtigt und entwickelt sich ungestört:
Nothing in the later development indicates that her learning of English was impeded by the interference of German, although there is no doubt that her German suffered permanently from the overpowering influence of English, even during the seven months in Germany (Leopold 1949a, 187).
‚Nichts in der späteren Entwicklung weist darauf hin, dass ihr Erwerb des Englischen durch die Interferenz des Deutschen behindert wurde, obwohl es keinen Zweifel gibt, dass ihr Deutsch permanent unter dem erdrückenden Einfluss des Englischen litt, sogar während der sieben Monate in Deutschland.‘
Leopold (1949b, 99) hebt hervor, dass fünf Jahre alte Kinder die Sprache in erster Linie als Mittel zur Kommunikation sehen und deshalb noch wenig Wert auf korrekte sprachliche Form legen. Während des siebenmonatigen Aufenthaltes in Deutschland fällt Hildegards fehlerhaftes Deutsch weder ihr selbst noch ihren Spielkameraden besonders auf (Leopold 1949b, 118).
Obgleich die Familie in Evanston Kontakt zu deutschsprachigen Freunden und Bekannten hatte, blieb Werner F. Leopold jahrelang der primäre deutschsprachige Gesprächspartner seiner Töchter. Aufgrund der fast vollkommen einsprachigen Umgebung und der für die Bilingualität allgemein ungünstigen Umstände war seine Aufgabe nicht leicht. Abgesehen von den verbreiteten Vorurteilen gegenüber der Zweisprachigkeit (Abschnitt 10.1) stand das Beibehalten und Pflegen der Sprache des Herkunftslandes im Gegensatz zur damals in den Vereinigten Staaten vorherrschenden Ideologie des melting pot. Durch direkten und indirekten Druck, deutsche Kinderlieder, Gutenachtgeschichten, Bücher und durch intensives Engagement versucht Werner F. Leopold, den geringeren Input des Deutschen ein wenig zu kompensieren. Diese angestrengten Bemühungen des Vaters bleiben Hildegard nicht verborgen und führen gelegentlich zu Verwunderung und auch Widerständen. Leopold (1949b, 41) berichtet zum Beispiel von folgendem Gespräch mit Hildegard im Alter von 3;2:
(1) Tochter: Papa!
Vater: Ja, Hildegard?
Tochter: Papa, why do you have those words? ‚Papa, warum hast du diese Wörter?‘
Vater: Weil ich deutsch spreche.
Tochter: But Papa, that isn’t nice. ‚Aber Papa, das ist nicht nett.‘
Ein Jahr danach fragt sie ihre Mutter (Leopold 1949b, 59):
(2) Mother, do all fathers speak German? ‚Mama, sprechen alle Väter deutsch?‘
Im Alter von sieben Jahren ist Hildegard manchmal stolz auf ihre Zweisprachigkeit (Leopold 1949b, 144), später, als vierzehnjährige Teenagerin auf der Suche nach Unabhängigkeit von ihrem Vater und seiner Sprache, fordert sie hingegen (Leopold 1949b, 153):
(3) Oh, Papa, don’t speak German in the street. ‚Oh, Papa, sprich nicht deutsch auf der Straße.‘
In vielen Aspekten war Werner F. Leopold seiner Zeit voraus. Zeitgenössische Forscher und Forscherinnen waren überzeugt, dass sich die frühkindliche Zweisprachigkeit negativ auf die Intelligenz auswirkt. Leopold (1947, vii, viii) bespricht die schulischen und intellektuellen Leistungen seiner Töchter im Alter von sieben bis zwölf Jahren und kann kein Anzeichen einer Beeinträchtigung feststellen. Verschiedene, in der Schule absolvierte Tests weisen vielmehr in die gegenteilige Richtung, was Werner F. Leopold zur Aussage bewegt, die frühkindliche Bilingualität beeinflusse die intellektuellen Fähigkeiten des Kindes vorteilhaft. In der Tat erwiesen sich Karla (Leopold 1949b, 164) und in geringerem Maße Hildegard (Leopold 1949a, 187) in Bezug auf ihre sprachlichen Fähigkeiten in ihrer schulischen Laufbahn als überdurchschnittlich begabt. Die spätere psycholinguistische Forschung bestätigte Werner F. Leopolds damalige Ansicht.
4.3 Weitere Studien
Ronjat (1913) und Leopold (1939–1949) werden in so gut wie jedem Forschungsüberblick genannt. Im selben Zeitraum wurde jedoch eine ganze Reihe von weiteren Untersuchungen veröffentlicht; die meisten davon sind in der Aufstellung von Rūķe-Draviņa (1967, 10 f.) enthalten. Auflistungen und Besprechungen, die Studien aus dieser Zeit miteinbeziehen, sind ferner in Hatch (1978, 3–5), McLaughlin (1978, 74–82, 87), Taeschner (1983, 7–16), Hakuta (1986, 45–72), Schneider (2003a, 48) und Barron-Hauwaert (2004, 198 f.) zu finden. Teilweise handelt es sich um Studien, die hinsichtlich der untersuchten Sprachen bemerkenswert sind (z. B. Serbisch, Chinesisch, Litauisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Russisch, Bulgarisch, Finnisch). Zwei dieser Arbeiten möchte ich im Folgenden kurz vorstellen.
4.3.1 Pavlovitch (1920)
Milivoïe Pavlovitch (oder Pavlović) studierte Sprachwissenschaft, zuerst in Belgrad, anschließend 1917–1918 in Paris bei dem bekannten Linguisten Antoine Meillet (1866–1936). 1920 veröffentlichte er ein Buch, das eine systematische Beobachtung der zuerst einsprachigen, dann ab dem 14. Monat zweisprachigen Entwicklung seines Sohnes Douchan in den ersten zwei Lebensjahren enthält. Pavlovitch (1920) beruft sich wiederholt auf Ronjat (1913) und vergleicht genau die sprachlichen Fortschritte seines Sohnes mit denjenigen von Jules Ronjats Sohn. Allerdings dominiert bei Pavlovitch (1920) die genaue Beschreibung des Erwerbs des Serbischen, während dem Erwerb des Französischen nur wenig Raum gewidmet ist. Das ist insofern verständlich, als es zur damaligen Zeit noch keine Untersuchungen zum Erwerb des Serbischen gab. Obwohl das Buch insgesamt eine bemerkenswerte und vor allem frühe Studie darstellt, ist es für die Forschung zum bilingualen Erstspracherwerb aus diesem Grund viel weniger relevant als Ronjat (1913).
Milivoïe Pavlovitch und seine Frau lebten in Frankreich und sprachen Serbisch mit ihrem Sohn, Französisch hörte Douchan von Freunden und Gästen der Familie. Es handelt sich hier also um eine Erwerbssituation des Typs Familiensprache ≠ Umgebungssprache. Im Falle von Milivoïe Pavlovitchs Sohn muss man außerdem von einem zeitverzögerten oder sukzessiven Erstspracherwerb sprechen. Erst ab dem 14. Monat hört Douchan fast so viel Französisch wie Serbisch und beginnt recht schnell, französische Wörter zu erwerben. Bis zum 22. Monat überwiegt zahlenmäßig noch der serbische Wortschatz, Pavlovitch (1920, 176) meint, ähnlich wie Ronjat (1913), dass „l’acquisition des éléments d’une langue n’a pas retardé le développement de l’autre“ ‚der Erwerb von Elementen einer Sprache hat die Entwicklung der anderen nicht aufgehalten‘ und dass Douchan über Kompetenzen „d’un enfant indigène“ ‚eines einheimischen Kindes‘ verfüge. Er unterstreicht ausdrücklich, dass man aufgrund vieler Indizien auf die Existenz von zwei Sprachsystemen schließen muss. Ab Ende des zweiten Lebensjahres kann sich Douchan in seinem Sprachverhalten auf die Sprache der Gesprächspartner und -partnerinnen einstellen. Pavlovitch (1920, 177) kann bei Douchan kaum Anzeichen einer hybriden Sprache erkennen: „Quant aux hybridités, elles sont assez rares; les phrases françaises admettent très peu de mots serbes [...]. ‚Hybride Phänomene sind recht selten; die französischen Sätze lassen sehr wenige serbische Wörter zu [...].‘ Er verweist jedoch auf einen von ihm untersuchten Fall eines französisch und serbisch erwerbenden Mädchens, dessen Sprache stark hybrid und gemischt war.
4.3.2 Smith (1931, 1935)
Die kurzen Aufsätze von Madorah E. Smith (Smith 1931, 1935) können sich hinsichtlich Ausmaß und Detailtreue selbstverständlich nicht mit den beiden herausragenden, in diesem Kapitel besprochenen Arbeiten messen; sie sind gleichwohl in bestimmten Aspekten erwähnenswert. Es werden darin insgesamt acht bilinguale Kinder der gleichen Familie besprochen. Die beiden involvierten Sprachen sind das Englische und das Chinesische. Es handelt sich demnach um die erste Untersuchung zur englisch-chinesischen Bilingualität. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Forschung zum bilingualen Erstspracherwerb leider auch noch heute auf einige wenige in Europa und Amerika gesprochene indoeuropäische Sprachen fokussiert ist. Nicht-indoeuropäische Sprachen und außereuropäische Sprachen bleiben zum Großteil ausgeblendet (Yip und Matthews 2007, 3). Außerdem ist die Autorin nicht selbst Mitglied der Familie, sondern interpretiert die ausführlichen Aufzeichnungen der Mutter von der Geburt des ersten Kindes bis zur Rückkehr in die Vereinigten Staaten. Die Eltern sind in China als Missionare tätig. Sie und ihre ausländischen Bekannten sprechen vornehmlich Englisch, wechseln jedoch gelegentlich zum Chinesischen, die chinesischen Kindermädchen und das übrige Hauspersonal sprechen nur chinesisch mit den Kindern. Besonders die jüngeren Kinder haben wenig Kontakt zur Mutter und werden hauptsächlich vom chinesischen Hauspersonal betreut. Die Autorin beurteilt die frühkindliche Bilingualität nicht unbedingt positiv (Hakuta 1986, 59–65). Der Erwerb von zwei Sprachen im Vorschulalter führe zu Verwirrung. Bilinguale Kinder besäßen einen geringeren Wortschatz als monolinguale Kinder in der jeweiligen Sprache. Bilinguale Kinder begännen zwar nicht später zu sprechen als monolinguale, hätten jedoch in Bezug auf sprachliche Korrektheit mehr Probleme als monolinguale. Außerdem meint sie, dass der häufige Sprachwechsel der Eltern besonders den jüngeren Kindern Schwierigkeiten bei der Trennung der beiden Sprachen bereiten könnte.