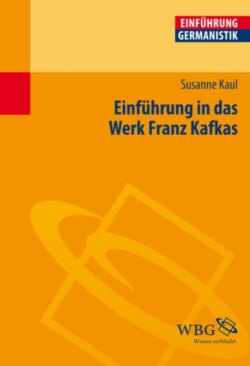Читать книгу Einführung in das Werk Franz Kafkas - Susanne Kaul - Страница 11
1. Prag, Judentum, Kindheit und Beruf
ОглавлениеWie sah es in Prag am Ende des 19. Jahrhunderts aus und welchen Einfluss hatte das soziale Geschehen auf Kafka?
Prag um 1900
Die Tschechen kämpften im Zuge der aufkommenden tschechischen Nationalbewegung um die Unabhängigkeit Böhmens von der Herrschaft der Deutschen. Die der Ober- und Mittelschicht angehörenden Deutschen waren in der Minderheit und die weitgehend zur Unterschicht gehörenden Tschechen arbeiteten daran, ihre kulturelle Identität und Sprache öffentlich gegen die Vormacht der höher angesehenen deutschen Kultur und Sprache durchzusetzen. Gesellschaftlicher Aufstieg, Kultur und Bildung waren also im Umkreis der Deutschen zu suchen. Daher versuchte sich auch Kafkas Vater, der als tschechisch und jiddisch sprechender Jude nach Prag gekommen war, als Freund der Deutschen hervorzutun. Prag war mehrfach gespalten, in Bezug auf den sozialen Stand (deutsche Oberschicht versus tschechische Unterschicht), nationale Gegensätze (die Tschechen setzten ihre Sprache und Kultur in der Öffentlichkeit gegen die deutsche durch) und den Antisemitismus. (Siehe hierzu Zimmermann 2008, 167 und Wagenbach 1993, 14.)
Als Jude in Prag
Die Prager Juden gehörten zumeist dem gehobenen Mittelstand an und arbeiteten hauptsächlich im freiberuflichen kaufmännischen Bereich wie Kafkas Vater. Im öffentlichen Dienst waren sie normalerweise nicht tätig und wurden nicht verbeamtet. Kafkas Position als Beamter bei der staatlichen Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt war eine Ausnahme, die durch private Beziehungen zustande kam. Da im Zuge der nationaltschechischen Entwicklung auch eine antisemitische Stimmung aufkam, lag es nahe, dass sich viele Juden kulturell eher an deutschnationalen und christlichen Gemeinschaften orientierten, wenn sie nicht auswanderten. Der schleichende Druck zur Anpassung hat möglicherweise die Konstellationen und Atmosphären der Macht- und Ohnmachtsverhältnisse in Kafkas Texten geprägt. Kulturell und sprachlich zählte Kafka zu den Deutschen, lernte aber auch Tschechisch in der Schule und sprach mit den Dienstboten zu Hause teilweise Tschechisch. Kafka hat fast sein ganzes Leben in Prag verbracht, abgesehen von kleinen Reisen. Zu einem Umzug nach Berlin kam es erst kurz vor seinem Tod: Kaum ein halbes Jahr lebte er dort mit Dora Diamant, bevor er ins Sanatorium in Wien eingewiesen wurde.
Familiäre Herkunft
Kafkas Vater, Hermann Kafka, wird 1852 in der südböhmischen Provinz geboren. Sein Vater war Fleischhauer. Dieser Umstand fließt möglicherweise in die Erzählung über den Hungerkünstler ein, dessen Wächter als Fleischhauer bezeichnet werden. Ansonsten scheint der Großvater, im Gegensatz zum Vater, kaum eine Rolle in Kafkas Leben zu spielen. Der Vater siedelt im Anschluss an den Militärdienst nach Prag über und gründet nach der Heirat mit Julie Löwy 1882 eine Existenz als Galanteriewarenhändler. Er verkauft Stoffe, Kurzwaren, Regenschirme, Modeartikel und dergleichen. Der soziale Aufstieg und geschäftliche Erfolg sind seinem Ehrgeiz, vor allem aber dem Vermögen der Gattin zu verdanken. Julie Löwy wird 1856 in der Nähe von Prag geboren und kommt aus einer Familie, die dem gebildeten deutsch-jüdischen Bürgertum angehört. Die Herkunft der Eltern ist also sehr ungleich. Diese Verschiedenheit spiegelt die sozialen Gegensätze, die am Ende des 19. Jahrhunderts in Prag zusammentreffen und zuweilen vereinigt werden. Von der Mutter stammt demnach das kulturelle Milieu Kafkas, vom Vater der Name. Das tschechische Wort „kavka“ bedeutet „Dohle“: Eine Dohle wird daher als Geschäftsemblem auf dem Briefkopf des Unternehmens verwendet. Der väterlichen Linie entstammen auch die Vorbilder für den Verschollenen, denn ein Cousin Kafkas, Otto Kafka, war früh nach Amerika ausgewandert und hat in New York ein Unternehmen gegründet, in das er seinen 14 Jahre jüngeren Bruder Franz, der ihm als 16-Jähriger folgte, aufnahm. Der Protagonist Karl Roßmann und sein amerikanischer Onkel sind hier wieder zu erkennen.
Geschwister
Franz Kafka wird am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Im Abstand von jeweils zwei Jahren kommen zwei Brüder hinzu, die beide an Kinderkrankheiten sterben. Es folgen drei Schwestern: Gabriele (Elli), Valerie (Valli) und Ottilie (Ottla). Ottla ist die jüngste und ihm die liebste der Schwestern, weil sie die am wenigsten angepasste ist. Sie rebelliert gegen den Vater und entwickelt somit eine Fähigkeit, die ihm selbst fehlt. Kafka liest seinen Schwestern vor und versorgt sie mit Literatur. Er schreibt kleine Theaterstücke, die sie bei Geburtstagen aufführen und stellt sogar – mit einer Unbefangenheit, die sonst niemand von ihm kennt – Kinoszenen im Badezimmer nach (vgl. Alt 2005, 59). Durch seinen frühen Tod 1924 ist ihm das Schicksal der Schwestern in den Gaskammern von Auschwitz erspart geblieben.
Frühe Kindheit
Die Eindrücke der frühen Kindheit sind von „kinderauszehrender Luft“ (OB, 347) erfüllt: ein herrischer Vater, der das Kind Franz mit Befehlen und Ansprüchen zu zerstampfen droht, sowie eine zurückgezogene Mutter, die beide die meiste Zeit im Geschäft verbringen und abends daheim Karten spielen. Ferner gibt es eine Köchin, die Kafkas vermeintliche Unartigkeiten immer beim Lehrer zu verpetzen droht, das ,Fräulein‘ für alles (Marie Werner, die später sogar die Eltern pflegt und bis zu deren Tod bei ihnen wohnt) und eine den großbürgerlichen Ambitionen der Eltern entsprechende belgische Gouvernante für die Hausaufgabenbetreuung und den Musikunterricht. Von allen Personen, die das Kind umgeben, ist der Vater die wirkungsmächtigste, so dass Peter-André Alt seine fast 800 Seiten umfassende Kafka-Biografie mit Recht „Der ewige Sohn“ genannt hat. Der Vater ist also ein Kapitel für sich. Zur Kennzeichnung der frühen Kindheit sei hier nur die Begebenheit aus dem berühmten Brief an den Vater zitiert, die Kafka besonders traumatisiert hat:
Ich winselte einmal in der Nacht immerfort um Wasser, gewiß nicht aus Durst, sondern wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten. Nachdem einige starke Drohungen nicht geholfen hatten, nahmst Du mich aus dem Bett, trugst mich auf die Pawlatsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein Weilchen im Hemd stehn. Ich will nicht sagen, daß das unrichtig war, vielleicht war damals die Nachtruhe auf andere Weise wirklich nicht zu verschaffen, ich will aber damit Deine Erziehungsmittel und ihre Wirkung auf mich charakterisieren. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich hatte einen inneren Schaden davon. Das für mich Selbstverständliche des sinnlosen Ums-Wasser-Bittens und das außerordentlich Schreckliche des Hinausgetragenwerdens konnte ich meiner Natur nach niemals in die richtige Verbindung bringen. Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, daß der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen konnte und daß ich also ein solches Nichts für ihn war. Das war damals ein kleiner Anfang nur, aber dieses mich oft beherrschende Gefühl der Nichtigkeit (ein in anderer Hinsicht allerdings auch edles und fruchtbares Gefühl) stammt vielfach von Deinem Einfluß. (7, 14 f.)
Volksschule 1889 – 1893
Von 1889 bis 1893 besucht Kafka die Deutsche Volks- und Bürgerschule am Fleischmarkt in Prag. Versagensängste beherrschen ihn: Er fürchtet, er werde niemals durch die erste Volksschulklasse kommen. Die Machtverhältnisse in der Familie setzen sich hier fort durch die Autorität der Lehrer und die Furcht des Schulkindes, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Dabei ist Kafka ein guter und geschätzter Schüler, so dass die Bedrohung, die vermeintlich von der Schule ausgeht, in ähnlicher Weise als Erzeugnis einer überzogenen Wahrnehmung gedeutet werden muss wie die Ängstigung durch den Vater. Das geht sogar so weit, dass, wie Alt berichtet, das weniger strenge Auftreten einiger Lehrer als besonders heimtückische Strategie der Herrschaftsausübung gilt: „Wo immer sich die Schule als angstfreie Zone – durch Zuwendung der Lehrer oder gute Leistungen des Schülers – hätte ausweisen können, wurden die entlastenden Indizien in Symbole einer perfiden Bestrafungstaktik umgedeutet.“ (Alt 2005, 67 f.) Schuld daran ist unter anderem die Köchin, die Kafka immer droht, ihn bei den Lehrern anzuschwärzen, wenn er nicht tut, was sie will, oder aber seine von existenzieller Angst erfüllte Phantasie, aus der auch seine Texte geschöpft sind.
Gymnasium 1893 – 1901
Von 1893 bis 1901 besucht Kafka das deutschsprachige Staats-Gymnasium in der Prager Altstadt. In diesen acht Jahren beschäftigt er sich viel mit Weltliteratur, unternimmt auch selbst erste Schreibversuche und schließt Freundschaften, die für sein Leben von großer Bedeutung sind, beispielsweise zu Hugo Bergmann, der ihn in die Welt des Zionismus einführt, und zu Oskar Pollak, mit dem er über Kunst, Philosophie und über seine eigenen Manuskripte spricht.
Studium 1901 – 1906
Da Kafka ausgemustert worden ist, kann er sich 1901 nach der Reifeprüfung sofort an der Karls-Universität einschreiben. Zwei Wochen studiert er Chemie und wechselt dann zur juristischen Fakultät, weil ihm die Laborarbeit nicht liegt. Im Brief an den Vater schreibt er darüber: „Ich studierte also Jus. Das bedeutete, daß ich mich in den paar Monaten vor den Prüfungen unter reichlicher Mitnahme der Nerven geistig förmlich von Holzmehl nährte, das mir überdies schon von tausend Mäulern vorgekaut war.“ (7, 51) Da ihn die trockene Rechtswissenschaft nicht befriedigt, besucht er zwischenzeitlich Veranstaltungen in Germanistik und Philosophie. 1906 schließt er das Studium mit einer Promotion als „Dr. iur. Advokatur“ ab. Seinem eigentlichen geistigen Interesse kommt er im Café Louvre nach, einem Forum, in dem über Literatur und Philosophie gesprochen wird. Dort lernt er auch Max Brod kennen.
Beamtenlaufbahn
Nach seiner Ausbildung zum Rechtsanwalt macht Kafka eine Lehre in der Anwaltskanzlei von Richard Löwy (welcher nicht mit Kafkas Onkel zu verwechseln ist, der ein Bekleidungsgeschäft betrieb). Für ein Jahr ist er sodann Angestellter auf Probe an verschiedenen Gerichten in Prag. 1907 wird er auf Vermittlung seines Onkels Alfred Löwy, der als Direktor der spanischen Eisenbahngesellschaft recht einflussreich ist, bei der Versicherung Assicurazioni Generali eingestellt. Der Büroalltag ist ihm zu mühsam, monoton und vor allem zu lang, da er ihm keine Zeit zum Schreiben lässt. 1908 kündigt er schon und wechselt zur Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt, wo er sich mit den Folgen von Arbeitsunfällen, beispielsweise aufgrund mangelhaft gewarteter Maschinen, befassen muss. (Möglicherweise stammt daher der Einfall, den Offizier in der Strafkolonie durch die von ihm beklagte mangelnde Wartung der Hinrichtungsmaschine einen plötzlichen Tod ohne die ersehnte Erleuchtung in der sechsten Stunde sterben zu lassen.) Bei der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt wird Kafka regelmäßig befördert, gut bezahlt und genießt hohes Ansehen. Dennoch meldet er sich oft krank. Seine gesundheitliche Disposition ist nicht besonders gut. Der Hauptgrund ist aber der, dass er eigentlich schreiben will und das Doppelleben als Beamter und Schriftsteller ihn krank macht.
Doppelleben
Kafka verwirklicht keine Karriere als freier Schriftsteller, obwohl er sich eigentlich dazu berufen fühlt, oder besser gesagt: obwohl er sich mit dem Schreiben vollständig identifiziert, während das normale, offizielle Leben in der Familie und im Büro nur aus Störfaktoren besteht. An Felice Bauer schreibt er am 1. November 1912:
Meine Lebensweise ist nur auf das Schreiben hin eingerichtet und wenn sie Veränderungen erfährt so nur deshalb, um möglicher Weise dem Schreiben besser zu entsprechen, denn die Zeit ist kurz, die Kräfte sind klein, das Bureau ist ein Schrecken, die Wohnung ist laut und man muß sich mit Kunststücken durchzuwinden suchen, wenn es mit einem schönen geraden Leben nicht geht. (FB, 66 f.)
Das Beamtendasein gibt existenzielle Sicherheit. Eine Eheschließung hätte diesen bürgerlich geraden Weg gefestigt, aber Kafka sieht das Schreiben darin zu sehr bedroht. Manchmal schreibt er ganze Nächte hindurch, so dass es ihm schon aus diesen äußerlichen Gründen unmöglich schien, beides zu vereinen. Da die Büroarbeit zu viele Stunden und Energie für das Schreiben wegnimmt, leidet Kafka geistig an diesem Doppelleben und gesundheitlich an der dadurch verursachten Schlaflosigkeit.
Liebe zur Literatur
Bereits als Schüler interessiert Kafka sich besonders für Literatur. Er schreibt sogar selbst schon erste Texte in dieser Zeit, aber von diesen Manuskripten ist kaum etwas erhalten geblieben. Vom Vater wird seine literarische Befähigung gering geschätzt. Mit einigen seiner Mitschüler, später mit Studienfreunden und Mitgliedern des Café Louvre-Zirkels tauscht er sich aber über Literatur (auch die selbst produzierte) und Philosophie aus. Einer seiner Lieblingsautoren ist Kleist, besonders die Erzählung Michael Kohlhaas schätzt er sehr. Hervorgehoben werden müssen auch Franz Grillparzer, Gustave Flaubert, Søren Kierkegaard, Hugo von Hofmannsthal und Robert Walser. Er liest auch Charles Dickens sehr gern, owohl er ihm stilistisch stellenweise zu schwülstig ist, und lässt sich für seinen Amerikaroman von David Copperfield inspirieren (vgl. 11, 168 f.).
Judentum
Kafka interessiert sich auch für die Schriften des Judentums, er liest unter anderem im Talmud, beschäftigt sich mit jüdischer Mystik und mit Martin Buber, dessen religiöse Vorträge er in Prag hörte und dessen Übersetzungen der chassidischen Erzählungen er kannte. Außerdem richtet er seinen Blick aufs jiddische Theater. Zwar hat Kafka nie eindringlich die Kabbala studiert, aber eine Ähnlichkeit zu seinen eigenen Texten ist zuweilen zu erkennen; beispielsweise Vor dem Gesetz und Die fünfzigste Pforte leben vom Motiv des Aufschubs und einer transzendenten Bodenlosigkeit, für die der Chassidismus im Unterschied zu Kafka die Rettung im Glauben vorsieht. (Siehe Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1996, S. 185.)
Felice Bauer
Kafkas Interesse für das Judentum erzeugt in ihm auch den Wunsch, nach Palästina zu reisen. Aus der mit Felice Bauer verabredeten Palästinareise ist aber nie etwas geworden. Gleichwohl ist es bemerkenswert: Am 13. August 1912 kommt es zur ersten Begegnung zwischen den beiden im Elternhaus Max Brods, und sofort an diesem Abend wird die besagte Verabredung getroffen. Es entsteht ein außergewöhnlich intensiver Briefkontakt: Allein von September bis Dezember 1912 schreibt Kafka fast 90 Briefe an Felice. Das Briefeschreiben ist ihm offenbar die liebste Weise, Felice zu begegnen, denn die leibhaftigen Treffen sind zumeist eine Enttäuschung, so dass auch aus diesem Grund die beiden Versuche einer Eheschließung im Zeitraum von fünf Jahren scheitern.
Julie Wohryzek
1919 lernt Kafka während eines Kuraufenthalts in Schelesen die acht Jahre jüngere Tschechin Julie Wohryzek kennen, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt und lungenkrank ist. Anders als das schriftliche Verhältnis zu Felice ist dieses von spontaner Heiterkeit und unkomplizierter Sinnlichkeit erfüllt. Die Eheschließung wird von Kafkas Vater verhindert, der das Verhältnis als sozialen Abstieg in die Unterschicht bewertet hat.
Milena Pollak
Milena Pollak (geborene Jesenská) tritt an Kafka heran, weil sie den Heizer ins Tschechische übersetzen will. 1920 treffen sie sich im Café Arco in Prag. Künstlercafés und die Welt der Literatur sind ihr durch ihre publizistische Arbeit vertraut. Da die dreizehn Jahre jüngere Frau bereits seit zwei Jahren verheiratet gewesen ist, muss die sich anbahnende Affäre geheim gehalten werden. Kafka besucht sie in Wien, wo es zu einer intimen Begegnung kommt, und nimmt diese Episode zum Anlass, sich von Julie Wohryzek zu trennen. Das Liebesverhältnis dauert insgesamt etwa ein halbes Jahr. Es ist im Vergleich zum Schriftverkehr mit Felice ein weniger umfangreicher, jedoch ebenso lesenswerter Briefwechsel daraus hervorgegangen.
Dora Diamant
Im letzten Jahr seines Lebens ist Dora Diamant die Frau an Kafkas Seite. Er lernt die 25-Jährige 1923 bei einem Erholungsaufenthalt in Müritz an der Ostsee kennen. Die beiden ziehen zusammen nach Berlin. Am Ende seines Lebens gelingt es Kafka, Prag zu verlassen und mit einer Frau sein Leben zu teilen. Der Kafka-Biograf Peter-André Alt resümiert:
Felice Bauer hatte zu ertragen, daß ihr Kafka ein Rätsel blieb, Milena Pollak mußte hinnehmen, daß er den endgültigen Schritt zu ihr nicht wagte. Beide scheiterten, weil sie den Sohn zum Ehemann zu bekehren und dabei – ohne es zu wissen – seine Identität zu zerstören suchten. Mit Dora Diamant teilt Kafka dagegen sein Leben frei von der Angst, seine Freiheit zu verspielen. An der Schwelle des Todes durfte die Furcht vor dem Selbstverlust in der Bindung nicht mehr zählen, weil die letzten Schritte in der Wüste fern von Kanaan bevorstanden. (Alt 2005, 642)
Krankheit und Tod
Im August 1917 erleidet Kafka einen Lungenblutsturz: Das Blut läuft ihm minutenlang aus der Kehle. Es wird eine Tuberkulose beider Lungenspitzen diagnostiziert. Während sein Vater die kalte, feuchte Wohnung im Schönborn-Palais im Verdacht hat, vermutet Kafka selbst, dass seine dauerhafte Überlastung und Schlaflosigkeit die Ursache der zerrütteten Gesundheit sind. So wird die psychosomatische Krankheit zur Metapher:
Mich beschäftigte nur die Sorge um mich, diese aber in verschiedenster Weise. Etwa als Sorge um meine Gesundheit; es fieng leicht an, hier und dort ergab sich eine kleine Befürchtung wegen der Verdauung, des Haarausfalls, einer Rückgratsverkrümmung u. s. w., das steigerte sich in unzählbaren Abstufungen, schließlich endete es mit einer wirklichen Krankheit. Was war das alles? Nicht eigentlich körperliche Krankheit […] und damit war der Weg zu aller Hypochondrie frei, bis dann unter der übermenschlichen Anstrengung des Heiraten-Wollens (darüber spreche ich noch) das Blut aus der Lunge kam […]. (7, 48 f.)
1924 kommt es zum völligen Zusammenbruch. Anfang April wird Kafka ins Sanatorium Wienerwald in Niederösterreich aufgenommen, weil die Lungentuberkulose auf seinen Kehlkopf übergegriffen hat: Er ist stumm und wiegt nur noch 43 kg. Er verständigt sich mit Dora Diamant und seinem Freund Robert Klopstock, der Mediziner ist und ihn bis zum Schluss begleitet, durch Notizzettel. Am 2. Juni 1924 stirbt Kafka an Tuberkulose. Klopstock hilft ihm auf seinen dringenden Wunsch hin mit Opiaten in den Tod (vgl. Stach 2008, 615).
Biografik
Umfassende Biografien zu Kafka gibt es in Deutschland erst im 21. Jahrhundert. Die Kafka-Biografik beginnt 1937 mit Max Brods Erinnerungen und findet einen vorläufigen Abschluss in Peter-André Alts bereits erwähnter Biografie, die mehr als eine Lebensdarstellung ist, weil sie Leben und Werk als Einheit betrachtet und entsprechend interpretatorisch in Beziehung setzt. Christian Klein unterteilt die Biografik in drei Phasen und resümiert diese wie folgt:
War für die Anfänge vor allem die Abkehr vom Klischee des lebensfeindlichen respektive mystifizierenden Autors entscheidend, wird in der zweiten Phase die Außenseiter-Position Kafkas betont. Zerrissen in seiner Identität, habe er Suspendierung im Schreiben gefunden, die Literatur wird zum Lebenszweck. In der dritten Phase schließlich wird vor allem der Konstruktionscharakter von Kafkas Vita betont: Das Leben folgt literarischen respektive kulturhistorischen Topoi, Schreiben wird zur Identität stiftenden Tätigkeit. (Klein 2008, 34)