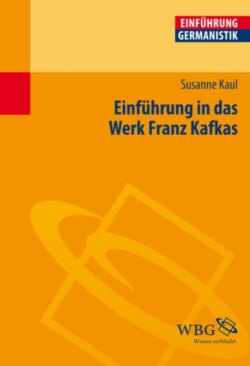Читать книгу Einführung in das Werk Franz Kafkas - Susanne Kaul - Страница 14
4. Schreiben als Existenzaufgabe
Оглавление„Der Roman bin ich“
Das Schreiben ist Kafkas Element, sein Leben hat kein höheres Ziel und alle anderen Ziele, vor allem die Ehe, stellen eine Rivalität dazu dar. Die Briefe an Felice sind ein dialogisch erweitertes Tagebuch, das nicht nur aus Liebe zur Frau geführt wird, sondern vor allem aus Liebe zur Literatur, das heißt aus Liebe zur Reflexion, zur Imagination und zum Schöpfen aus der Sprache. Sie dienen auch indirekt der Literatur, denn mit den Briefen an Felice hebt die erste große Schaffensphase Kafkas an. Sie handeln sogar oft ausdrücklich vom Schreiben, begonnen mit den Umständen des Briefschreibens auf der Schreibmaschine, über eigene und fremde Literatur, bis hin zur ausschlaggebenden Bedeutung des Schreibens für sein Leben. Das Schreiben gibt wahrhaftig den Ausschlag: Sein „Wellengang“ bestimmt Kafka so sehr, dass letztlich auch die Liebe zu Felice daher rührt, wie er gesteht (FB, 66). Im selben Brief vom 1. Oktober 1912 benennt er die Bedeutung des Schreibens wie folgt: „Mein Leben besteht und bestand im Grunde von jeher aus Versuchen zu schreiben und meist aus mißlungenen. Schrieb ich aber nicht, dann lag ich auch schon auf dem Boden, wert hinausgekehrt zu werden.“ (FB, 65) Die Diagnose des eigenen Scheiterns und der eigenen Nichtigkeit ist ein Thema für sich; diese Bemerkung zeigt davon abgesehen, wie sehr Kafka seine Identität mit dem Schreiben verbindet. Im Kontext dieses Zitats steht die Bemühung, Felice zu erklären, wie sehr seine Lebensweise aufs Schreiben eingestellt ist. Um sie aber nicht damit zu beleidigen, dass sie in der zweiten Reihe steht, zeigt er ihr, in welcher Weise sie in sein Schreiben eingeht: Beispielsweise habe sie in einem Kapitel des Verschollenen ihre Spuren hinterlassen mit dem, was sie in ihren Briefen erzählt hat über sich und ihre Mutter, die einmal verärgert war, als sie zu spät heimkam (vgl. FB, 66). Kafka hält sich durchs Schreiben am Leben, gleichzeitig verzehrt es sein Leben, weil er so sehr darunter leidet, wenn er nichts Rechtes zustande bringt. Da er sich mit dem Schreiben identifiziert, bedeutet schlecht zu schreiben ein knappes Überleben und nicht zu schreiben die völlige Sinn- und Wertlosigkeit seines Lebens. Das Schreiben aufzugeben hieße, sich selbst aufzugeben. Daher ist das Schreiben die Hauptaufgabe seines Existierens. Zugleich gibt er mit dem Schreiben das Existieren auf. Er zieht den Briefverkehr dem realen menschlichen Verkehr vor sowie die Schriftstellerexistenz der Existenz als Ehemann und Beamter, er führt ein Doppelleben, das ihn in seiner seelischen und körperlichen Gesundheit zerreißt. Das Schreiben ist jedoch nicht bloß eine Leidenschaft, denn eine solche kann ja aufgegeben werden. Von Kafka bliebe dann aber nichts übrig, denn er ,ist‘ sein Schreiben: „Der Roman bin ich, meine Geschichten sind ich“ (FB, 226).
Einsamkeit des Schreibens
Das Schreiben ist etwas so Exklusives, dass es nicht vereinbart werden kann mit den Geschäften des Tages, mit den normalen Dingen des Lebens, mit Geselligkeit, nicht einmal mit der Vereinigung in der Liebe. Kafka sucht nach Bildern, die die extreme Ruhe und Isolierung zum Ausdruck bringen, die er sich für sein Schreiben wünscht. An Felice schreibt er zur Warnung vor seiner Eheunfähigkeit:
Mein Verhältnis zum Schreiben und mein Verhältnis zu den Menschen ist unwandelbar und in meinem Wesen, nicht in den zeitweiligen Verhältnissen begründet. Ich brauche zu meinem Schreiben Abgeschiedenheit, nicht ,wie ein Einsiedler‘, das wäre nicht genug, sondern wie ein Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein tiefer Schlaf, also Tod, und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen wird und kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht. (FB, 412)
Kafka erinnert Felice öfters an ein chinesisches Gedicht, in dem ein Mann derart in sein Buch vertieft ist, dass er das Zubettgehen vergisst – bis ihm die Geliebte irgendwann verärgert die Lampe wegreißt. Aber nur der Gedanke, dass Felice in seiner Nähe sein könnte, während er schreibt, ängstigt ihn. Er erklärt ihr, dass zum Schreiben äußerste Offenheit und Hingabe gehören. Man könne gar nicht genug allein sein, wenn man schreibt, und die Nacht könne nicht tief und still genug sein:
Oft dachte ich schon daran, daß es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock, durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde! Aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde! (FB, 250)
Man sollte meinen, Nahrungsaufnahme gehöre zu den elementaren Dingen im Leben, aber für Kafka ist es dem Schreiben untergeordnet, das wie ein Heiligtum davon abgegrenzt wird durch eine große räumliche Distanz. Die Schlafbekleidung könnte gesellschaftsuntauglicher kaum sein, sie kennzeichnet geradezu das Private. Der Spaziergang, der normalerweise der zweckfreien Erholung dient, bei Tag und in frischer Luft, dient hier nur dem Essenholen im Kellergewölbe. Kurz, das Schreiben bildet einen Gegensatz, nicht nur zum sozialen Alltagsleben, sondern beinahe überhaupt zum Leben. Das ist Kafkas Wunsch: seine Existenz ganz dem Schreiben zu widmen, das heißt, sie aufzugeben für die geheimnisvollsten Tiefen der Literatur.
Nachtwachen
Da das Schreiben eine Ruhe und Abgeschiedenheit verlangt, wie sie, wenn überhaupt, nur in tiefster Nacht möglich ist, heißt das: nachts schreiben anstatt zu schlafen. Zwar schreibt Kafka, wenn er schreibt, nur die halbe Nacht, die andere Hälfte kann er aber nicht zum Schlafen nutzen, weil er vor lauter Gedanken an seine Arbeiten nicht einschlafen kann: „So besteht die Nacht aus zwei Teilen, aus einem wachen und einem schlaflosen“ (FB, 67). Kafkas Mutter macht sich große Sorgen um seine Gesundheit, weil er zu wenig isst und schläft: Diese dem Schreiben gewidmete Lebensweise ist nicht gesund für jemanden, der morgens früh im Büro zu erscheinen hat. Man mag Julie Kafka vorwerfen, dass sie die Bedeutung der Literatur für ihren Sohn (ganz zu schweigen von der Bedeutung ihres Sohnes für die Literatur) nicht geahnt hat, aber mit ihren Sorgen um seine Lebenskraft behält sie leider Recht. Ihr Versuch, Felice dazu zu bewegen, auf Kafka dergestalt einzuwirken, dass er seine Haltung ändert, bleibt erfolglos (vgl. FB, 100). Der Schlaf muss hingegeben werden für die Aufregungen, die das dichterische Schaffen in Kafka verursacht. Er ist das Opfer, das dargebracht wird für gutes wie für schlechtes Schreiben. Denn durch gutes Schreiben wird Kafka fortgerissen, bis die Morgendämmerung ihn ins Bett treibt, und wenn er schlecht schreibt, ist er darüber so verzweifelt, dass er nicht schlafen kann oder sogar meint, keinen Schlaf verdient zu haben. Aber schlechtes Schreiben ist dann immer noch besser, als gar nicht zu schreiben, denn das käme einer vollständigen Existenzvernichtung gleich. Auf diese Weise kann Kafka seine Existenz rechtfertigen, untergräbt aber Stück für Stück seine Gesundheit. Er klagt häufig über Kopfweh und Müdigkeit: „Ich bin fortdauernd müde, Schlafsucht wälzt sich mir im Kopf herum. Spannungen oben auf dem Schädel rechts und links.“ (FB, 204) Das Essen erkennt er als überlebensnotwendig an, wenn er in seine Vision vom schreibenden Kellerbewohner einen der Nahrungsaufnahme dienenden Spaziergang zur äußersten Tür des Kellergewölbes einarbeitet (vgl. FB, 250). Das Schlafen vergisst er dabei aber, denn der innerste Raum des Kellers ist nur mit einer Lampe und Schreibzeug ausgestattet, nicht aber mit einem Bett, und der Schlafrock scheint seine Arbeitsbekleidung als Schriftsteller zu sein. Die Schlaflosigkeit beginnt mit der intensiven Phase des Schreibens Ende 1912, Anfang 1913 und rührt offensichtlich daher. Kafka erkennt diesen Zusammenhang und klagt über die Schlaflosigkeit, allerdings nicht aus Sorge um seine Gesundheit oder seine Leistungsfähigkeit im Büro, sondern allein deshalb, weil dieser Zustand seiner dichterischen Produktivität und Konzentration schadet. An Felice schreibt er in der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1913:
Heute ist noch verhältnismäßig bald, aber ich will mich auch bald niederlegen, denn das gestrige, beiläufig gute Schreiben habe ich mit Kopfschmerzen während des ganzen Tags (diese Kopfschmerzen sind eigentlich eine Erfindung der letzten zwei Monate, wenn nicht gar erst des Jahres 1913) und schlechtem von Träumen zerplatzendem Schlaf bezahlt. Zwei Abende hintereinander gut zu schreiben ist mir schon lange nicht gelungen. Was für eine unregelmäßig geschriebene Masse das sein wird, dieser Roman! Was für eine schwere Arbeit, vielleicht eine unmögliche das sein wird, nach der ersten Beendigung in die toten Partien auch nur ein halbes Leben zu bringen! Und wie viel Unrichtiges wird stehen bleiben müssen, weil dafür keine Hilfe aus der Tiefe kommt. (FB, 251)
So wie er nicht mit und nicht ohne die Geliebte leben kann, so kann er nicht mit und nicht ohne Schlaf leben. Es ist ein ähnliches Dilemma wie das Entweder-oder des Heiratens, denn der Zwiespalt gehört zu Kafkas Wesen: Wenn er schreibt, schläft er nicht, und wenn er nicht schreibt, kann er nicht schlafen, weil er unzufrieden damit ist, dass er nicht geschrieben hat. So könnte er zu sich selbst sagen: ,Schreibe oder schreibe nicht, du wirst nicht schlafen können!‘ Aber bereut hat er das Schreiben nie, auch das schlechte nicht; bereut hat er immer nur das Nichtschreiben.
Literatur gebären
Das Hervorbringen von Literatur ist für Kafka so lebenswichtig, anstrengend, beglückend, triebhaft und intim, dass er es mit dem Gebären vergleicht. Von der Erzählung Das Urteil heißt es in einer Tagebuchaufzeichnung vom 11. Februar 1913, sie sei „wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir herausgekommen“ (10, 125). Kafka beschreibt den Vorgang dieses Schreibprozesses in einem Tagebucheintrag vom 23. September 1912, dem Tag nach der Niederschrift, um nicht zu sagen, Niederkunft‘ der Erzählung, so stichwortartig und genau wie bei einer Beweisaufnahme:
Diese Geschichte ,das Urteil‘ habe ich in der Nacht vom 22 zum 23 von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem Zug geschrieben. Die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehn. Die fürchterliche Anstrengung und Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte wie ich in einem Gewässer vorwärtskam. Mehrmals in der Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. Wie alles gewagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereit ist, in dem sie vergehn und auferstehn. Wie es vor dem Fenster blau wurde. Ein Wagen fuhr. Zwei Männer über die Brücke giengen. Um 2 Uhr schaute ich zum letzten Mal auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Mal durchs Vorzimmer gieng, schrieb ich den letzten Satz nieder. Auslöschen der Lampe und Tageshelle. Die leichten Herzschmerzen. Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zitternde Eintreten ins Zimmer der Schwestern. Vorlesung. Vorher das Sichstrecken vor dem Dienstmädchen und Sagen: ,Ich habe bis jetzt geschrieben‘. Das Aussehn des unberührten Bettes, als sei es jetzt hereingetragen worden. Die bestätigte Überzeugung, daß ich mich mit meinem Romanschreiben in schändlichen Niederungen des Schreibens befinde. Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.“ (10, 101)
Es wird deutlich, dass es ihm nicht nur um das literarische Endprodukt geht, sondern um das Ereignis des Schreibens selbst. Und zwar dergestalt, dass er seine Identität mit dem Schreiben aufs engste verknüpft: Es ist nicht nur ein Hang oder ein Zeitvertreib. Kafka zeugt und gebiert sich selbst hier gleichsam als Schriftsteller.
Wollust des Schreibens
In der Forschung ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass das Schreiben für Kafka eine entbindungssymbolische (vgl. von Matt 2006, 107), aber auch eine im engeren Sinn erotische Dimension hat. Einige gehen sogar so weit, zu sagen, dass er seine erotische Energie in Schrift umzusetzen suchte (vgl. Kremer 2006, 77), dass die Literatur Kafkas eigentliche Geliebte war und das Schreiben ein „Koitus mit sich selbst“ (Schärf 2000, 18). Kafka nennt das einsame Schreiben in der Nacht ein äußerst wollüstiges Geschäft, rückt aber auch das briefliche Erzählen von seiner literarischen Arbeit metaphorisch in die Nähe erotischer Praktiken, wenn er Felice im November 1912 schreibt, er werde sich „wenn die Zeit und die Fähigkeit da sein sollte, ordentlich vor Dir ergießen und Du magst dann die Hände im Schoß die große Bescherung ansehn“ (FB, 117). Der Hintergrund dieser Bemerkung ist der: Kafka fühlt sich zu müde, um Felice von der Verwandlung zu erzählen, an der er gerade schreibt, und kündigt an, dass er es am Sonntag tun werde. Das ausgesuchte Wortfeld erzeugt aber die Vorstellung einer sexuellen Ekstase mit Zuschauerin.
Kompromissloses Schreiben
Das Schreiben ist für Kafka nie ein Luxus für Mußestunden oder ein Bildungsideal. Sein Verhältnis zu ihm ist kein rationales, distanziertes. Es wird vielmehr als körperliche Notwendigkeit erfahren. Wie eine individuelle und zugleich biologisch-teleologische Wesensbestimmung klingt es, wenn Kafka am 3. Januar 1912 im Tagebuch das Schreiben als den eigentlichen Zweck seines Wesens beschreibt:
In mir kann ganz gut eine Koncentration auf das Schreiben hin erkannt werden. Als es in meinem Organismus klar geworden war, daß das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehn, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens, des philosophischen Nachdenkens der Musik zuallererst richteten. Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab. Das war notwendig, weil meine Kräfte in ihrer Gesamtheit so gering waren, daß sie nur gesammelt dem Zweck des Schreibens halbwegs dienen konnten. (9, 264)
Kafkas Eltern und Felice haben kaum Verständnis für die existenzielle Bedeutung, die das Schreiben für Kafka hat. Der Vater versucht es zu ignorieren, die Mutter betrachtet es als Zeitvertreib und Felice findet Kafkas Engagement zu extrem, sie ist eifersüchtig auf die Literatur und hat Angst, dass ihr Geliebter sich zu sehr an dieses ihr fremde Geschäft verschwendet. Von Max Brod muss sie sich erklären lassen, dass Kafka ein Mensch ist, der nur das Unbedingte, das Äußerste will und sich vor allem beim Schreiben nicht mit Kompromissen zufrieden gibt. Entweder mit voller Kraft oder gar nicht (vgl. FB, 96). Kafkas Lebensaufgabe besteht darin, das Recht zu schreiben zu benutzen (vgl. 9, 109); gleichzeitig gibt ihm das Schreiben das Recht zu existieren – und bis an die Grenzen der Existenz zu gehen. Das Schreiben ist für Kafka also Existenz-Aufgabe im doppelten Sinn.