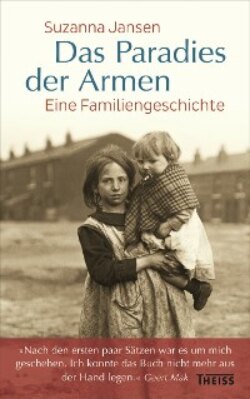Читать книгу Das Paradies der Armen - Suzanna Jansen - Страница 10
|23|2
Grüße aus Veenhuizen
ОглавлениеAuf der Landkarte der Provinz springen im Mosaik der Flurstücke und sich schlängelnder Flüsschen sofort die schnurgeraden Linien von Veenhuizen ins Auge. In der Realität wirken die Alleen und die Siedlungen weniger mit dem Lineal gezogen als auf der Landkarte, da sie mit Grün bewachsen sind, das sich schon vor langer Zeit in die Landschaft eingenistet hat. Mächtige Buchen geben einem das Gefühl, statt auf einer Asphaltstraße über ein altes Landgut zu spazieren. Es herrscht keinerlei Verkehr, man hört nur das Zwitschern der Vögel.
Bevor ich mit der Spurensuche beginne, will ich mich zur Orientierung erst einmal um die eigene Achse drehen. Mir fällt auf, dass alle Häuser in demselben streng-symmetrischen Stil entworfen wurden. Die Arbeiterhäuschen und die freistehenden Villen unterscheiden sich nur in der Dimension, nicht in der Form. Ihr einziger Schmuck sind die weiß-grünen Fensterläden, mit denen jedes, Stück für Stück, verschönert wurde. Die Gärten sind gepflegt, weit und breit ist kein vernachlässigtes Grundstück zu sehen. Man ahnt sofort, dass diese Dorfgemeinschaft nicht um einen Dorfacker oder eine Kirche herum entstanden ist, sondern nach einem wohlüberlegten Plan. An den Fassaden stehen auf gebieterischen, schwarz umrandeten Schildern in Zement gemeißelte Sprüche. Jeder abgeschlossen mit einem dicken Punkt. »PFLICHTGEFÜHL.«, »AUFOPFERUNG.«, »BITTER UND SÜSS.« Steht auf drei nebeneinanderliegenden Häusern, deren Fenstern vernagelt sind. Ein Schild des Fremdenverkehrsvereins Drenthe lässt mich wissen, dass die Gebäude ehemals als Krankenhaus in Gebrauch waren.
Es ist, als würde ich nach den Öffnungszeiten in einem Freilichtmuseum |24|herumlaufen, in einem verträumten Dorf, das auf befremdliche Weise altmodisch geblieben ist. Bis mich der sonore Klang einer elektrischen Klingel in die Realität zurückwirft. Hinter den Bäumen erblicke ich einen Betonklotz mit Gitterstäben. Ein weiteres Gefängnis.
Veenhuizen, die ehemalige Bettlerkolonie, zählt im Jahr 2003 ungefähr tausend Gefangene und fast so viele freie Einwohner. Die meisten Einwohner von Veenhuizen arbeiten in den Strafanstalten, ein paar Häftlinge pflegen die Grünflächen außerhalb des Gefängniszaunes. Bis in die Achtzigerjahre war das ganze Dorf Eigentum des Justizministeriums, und es galten besondere Regeln. Innerhalb der Dorfgrenzen wohnten nur Häftlinge und Gefängnispersonal. Das ganze Dorf war abgeriegelt, was man sonst nur in der DDR oder in der Sowjetunion erwartet hätte. Der Gefängnisdirektor herrschte inner- und außerhalb der Mauer über die Bewohner: Keiner in Veenhuizen durfte ohne seine schriftliche Einwilligung Besuch empfangen. Auch heute noch hängen überall Schilder mit der Aufschrift: »Zutritt für Unbefugte verboten«. Eines dieser Schilder hält mich vor einem markanten, karreeförmigen Gebäude auf Abstand. Aus allen vier Himmelsrichtungen führen Straßen auf den lang gezogenen Komplex zu, auf dessen Fassaden sich im eintönigem Rhythmus endlos Fenster und Türen hintereinanderreihen. Drumherum ein Wassergraben, ein Wachtturm, und überall Überwachungskameras. Doch keine Menschenseele zu sehen. Als ich das Verbotsschild hinter mir lasse, um das Gebäude aus der Nähe zu betrachten, geschieht nichts. Über dem Eingangsbogen steht:
1823. Zweite Anstalt
W. Visser, Koloniedirektor
Durch die Fenster sehe ich einen kahlen Raum, in der Ecke steht ein Stapel Kartons. Dort, wo seit 1823 die Bettler untergebracht waren, lagert das Briefpapier der Justizvollzugsanstalten, auf dem Briefkopf die Justitia mit den verbundenen Augen.
|25|Ich möchte wissen, wozu dieses Gebäude heutzutage dient, doch es ist niemand da, den ich fragen könnte. Ein Loch in der Mauer öffnet den Blick auf einen riesigen Innenhof, auf dem der Container einer Aktenvernichtungsfirma steht, und auf dem auch ein paar Bänke zu sehen sind – für wen sind die Bänke? Ich sehe mich noch ein wenig um, ohne schlau daraus zu werden, und gerade als ich das Gelände verlassen will, hält ein hochrädriger Geländewagen vor dem Eingangstor. Ein paar Männer in Anzügen steigen aus, gefolgt von einer Dame in wehendem Mantel. Sie sind an diesem verlassenen Ort völlig fehl am Platz. Es sind deutlich keine Gefängniswärter.
»Wir sind vom Planungsbüro«, sagt einer der Männer, der sich selbst »Projektleiter« nennt. Er hat einen gehetzten Blick und drückt eine Dokumentenmappe fest an sein Sakko. Weil ich ihn danach frage, erzählt er mir, dass dieses historische Gebäude »die Zweite Anstalt« ist und noch vor Kurzem als Werkstatt für die Häftlinge genutzt worden sei. Jetzt soll es zu einem Nationalen Gefängnismuseum umgebaut werden.
»Wir wollen das ganze Dorf umkrempeln.« Er zeigt mit seinem Autoschlüssel um sich. »Unsere Vision geht von der Grundidee der Bettlerkolonie aus. Autarkie, Fürsorge, Experiment. Die ideellen Eckpfeiler des Gründers Johannes van den Bosch.«
Der Projektleiter ist sichtlich in Eile, dennoch spricht er gerne über sein Projekt. Er tritt einen Schritt zurück und fährt im Beraterjargon fort. In naher Zukunft, sagt er, werde es hier ein Pflegehotel geben, Erholungszentren, Kochkurse für Manager, bei denen nur regionale Produkte verwendet werden, um nur ein paar Dinge zu nennen.
Und das inmitten von fünf Gefängnissen? Ich muss eine Augenbraue hochgezogen haben, worauf der Projektleiter entschlossen nickt: Die auffällige Präsenz der Gefängnisse ist in seinen Augen kein Hinderungsgrund, im Gegenteil.
»Das gehört zur einzigartigen Atmosphäre, die wir bieten wollen: ein Unbehagen, dass die Gefangenen einfach so herumlaufen und der Stacheldraht. Man kommt hier mit den dunklen |26|Seiten des Lebens in Berührung, das ist das Besondere daran.« Sein Ziel ist es, mithilfe des »Qualitätstourismus«, das dahinsiechende Dorf wieder attraktiv und bewohnbar zu machen. Die Pläne knüpfen, seiner Meinung nach, nahtlos an die Geschichte Veenhuizens an.
»Wenn man in hundert Jahren zurückblickt, wird man feststellen, dass die historische Tradition nicht unterbrochen wurde.«
Auf meine Frage, was er denn damit meine, antwortet er, dass er keine Zeit habe. Er könne mir seine Dokumentation gerne per E-Mail zusenden, da stehe alles drin: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Vorläufig muss ich mich mit dem bereits vorhandenen, kleinen Museum begnügen, das im rückwärtigen Teil des Geländes in ein paar Holzbaracken untergebracht ist. Vor der Tür drängelt sich eine Gruppe ausgelassener Schulkinder, offensichtlich gerade ausgestiegen aus einem DAF mit der Aufschrift »Ganovenbus.« Gleich hinter dem Eingang befindet man sich vor einem Modell der Zweiten Anstalt. So von oben herab betrachtet, fällt mir die kasernenartige Abgeschlossenheit erst richtig auf. Die Anstalt hat nur zwei Tore. Der Innenhof des maßstabsgetreuen Modells ist wie ein englischer Garten angelegt, mit Bäumen und Beeten, zwischen denen sich ein paar Miniaturfiguren – die Bettler? – ausruhen.
Es findet gerade eine Führung statt, und ich fange ein paar Gesprächsfetzen auf. Demnach gab es drei identische Anstalten, von denen lediglich Nummer zwei erhalten geblieben ist. Sie lagen eine halbe Stunde Fußweg voneinander entfernt, wie Inseln in der eintönigen Landschaft. Damals war man entweder in »der Ersten«, »der Zweiten«, oder »der Dritten« zu Hause, und so nennt man sie heute immer noch. Allerdings verbindet heute eine Asphaltstraße die drei Örtlichkeiten miteinander.
Der Führer, ein ehemaliger Gefängnismitarbeiter, nennt das frühere Veenhuizen eine »Zwangskolonie«, in der Bettler und Landstreicher mit militärischer Zucht und Ordnung lernen sollten, sich anzupassen. »Das war nicht immer einfach«, sagt er und |27|macht ein paar torkelnde Schritte, »denn die Burschen in der Kolonie haben sich gerne mal einen hinter die Binde gegossen«. Sein Publikum, Damen und Herren in gepflegter Freizeitkleidung, bricht in Gelächter aus. »In den Sälen rund um den Innenhof«, fährt Ex-Wächter fort, »waren die Bettler untergebracht, die in diese Kolonie zwangsverschickt worden waren. Sie schliefen in Hängematten, zu achtzig Mann in einem Schlafsaal. Die äußeren Unterkünfte waren für die Armen, die freiwillig hier waren.«
Ich ziehe ein Notizbüchlein aus meiner Tasche. Das ist eine entscheidende Information. Helena, meine Urgroßmutter, wurde in so einer Anstalt geboren. Wo war sie mit ihren Eltern untergebracht: Auf der Innen- oder Außenseite der Anstalt? Und wie lebte man damals hier: in der Ecke eines Schlafsaales, abgeschirmt mit Decken, wie in einem Flüchtlingslager? Mit meinem Stift in der Hand – als Halt – setze ich meinen Gang durch das Museum fort und notiere mir, was mir auffällt.
Dass der Friedhof die »Vierte Anstalt« genannt wurde.
Dass die Mahlzeiten an einem Tag aus Brei bestanden, und am nächsten Tag mit Wasser gestreckt als »Breisuppe« serviert wurden. (Montag: Graupensuppe – Dienstag: Graupen mit Melasse – Mittwoch: Graupensuppe)
Dass man die Bettler »Pfleglinge« nannte. (Ich wundere mich: Wie lässt sich das mit der militärischen Zucht und Ordnung vereinbaren?)
Dass am Sonntag alle zur Kirche mussten. (Die Anstaltsbewohner hatten die Wahl: protestantisch oder katholisch. Wer »keine Konfession« angab, wurde automatisch den Katholiken zugeteilt.)
In einer Vitrine liegt eine »Spuckmaske«, die dem dazugehörigen Foto zufolge straff mit Bändern um das Gesicht gebunden wurde. Bei wem? Warum? Den größten Schrecken flößt mir der Schlafkäfig ein: Ein enger Eisenkäfig mit einem straff gespannten Stück Jute als Bett. Auf einem kleinen Brett oberhalb des Fußendes steht ein Nachttopf, darüber ein Schild mit Anweisungen in Piktogrammen, wie das Bettzeug zusammengelegt werden |28|muss. Auf der Hinweistafel ist zu lesen, dass der Käfig im Vergleich zu den Hängematten als entscheidende Verbesserung galt.
Je mehr ich sehe, desto besser verstehe ich es, dass man seine Vergangenheit in Veenhuizen lieber verschweigen will. Wenn man wie ein Verbrecher behandelt wird, muss man auf die Dauer ja glauben, dass man sich für irgendetwas schämen muss. Obwohl ich Helena nicht gekannt habe – ich bin dreißig Jahre nach ihrem Tod zur Welt gekommen –, wird mein Mitleid mit ihr immer größer, wenn ich an die Umstände denke, unter denen sie aufgewachsen ist. Hat sie in einer Hängematte oder in einem Käfig geschlafen? Hat sie jemals eine »Spuckmaske« getragen, wenn sie draußen gespielt hat – hat sie überhaupt draußen gespielt?
Mein Blick fällt auf ein an die Wand geheftetes DIN-A4-Blatt.
Achtung: Im Dorf gibt es noch immer Gefängnisse.
Sprechen Sie nicht mit den Personen, die die Grünanlagen pflegen oder sich hinter den Zäunen aufhalten. Es ist auch nicht erlaubt, sie zu fotografieren.
Ich frage mich, ob das überhaupt jemand will?
In einem kleinen Saal wird ein Film über die Entstehungsgeschichte von Veenhuizen gezeigt. Die Kolonie wurde im Jahr 1823 von einem gewissen Johannes van den Bosch gegründet. Er war ein sozial gesinnter General, der etwas gegen die Verarmung in den niederländischen Städten unternehmen wollte. Angesichts der unterentwickelten nördlichen Provinzen zählte er eins und eins zusammen: Hinter dem Pflug konnten sich Vagabunden, arme Schlucker und von ihren Eltern verstoßene Kinder nützlich machen; die harte Arbeit würde sie zugleich erziehen und zivilisieren. Der General baute in Veenhuizen drei Anstalten, in denen mehr als zehntausend Arme einer Umerziehung unterzogen wurden. Erst im Jahr 1973 verließ der letzte Landstreicher Veenhuizen.
Es war ein außergewöhnliches Experiment, einzigartig in ganz Europa. Delegationen aus dem In- und Ausland kamen angereist – sogar Preußen und Franzosen –, um es sich anzusehen.
|29|Nach dem Ende der Führung setzen sich die Museumsbesucher zu Apfelkuchen mit Sahne in die Cafeteria und ergreifen die Gelegenheit, die neuesten Nachrichten auszutauschen.
Urlaubsgeschichten und Fotos der Enkel machen die Runde. Ein paar Damen sehen sich die Souvenirs an, die zum Kauf angeboten werden: Hinter Gitter eingekerkerte Seifen, Gaunerpüppchen aus Stoff, gefüllt mit getrocknetem Lavendel, Ansichtskarten mit den unglaublichen »Grüßen aus Veenhuizen«.
Ich scheine die Einzige zu sein, die von den Geschichten hinter der Museumsausstellung eine Gänsehaut bekommt, doch vielleicht bin ich ja zu sensibel. Die meisten besuchen das Gefängnismuseum nur, weil sie einen Ausflug machen wollen. Hier werden Kindergeburtstage unter dem Motto »Fang den ausgebüchsten Landstreicher« organisiert, Limonade und Überraschungsgeschenk inbegriffen; Gruppen reisen zur »Teambildung« an; Veenhuizen steht bei so manchen Geselligkeitsvereinen für den jährlichen Ausflug hoch im Kurs.
Ich interessiere mich in der Cafeteria vor allem für das Dokumentationsregal. Da liegen Mappen mit Zeitungsausschnitten und ein moosgrünes Register, das die Namen der Bewohner der Kolonien enthält. Das Buch liest sich wie ein Telefonbuch von Veenhuizen, aber noch vor der Erfindung des Telefons. Viel steht nicht drin: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Archivnummer. Wer mehr wissen will, muss nach Assen in das Drents Archief, das Archiv der Provinz Drenthe.
Ich suche und finde meine Urgroßmutter: Gijben, Helena, 09/06/1856, 4 197. Außerdem liegt im Regal auch eine Liste aller Bewohner der Dritten Anstalt. Sie stammt von 1848, acht Jahre bevor Helena dort zur Welt kam.
1472 Bettler-Kolonisten
158 Militär-Kolonisten
315 Arbeiter mit ihren Familien
18 Gärtner mit ihren Familien
106 Bettler mit ihren Familien
|30| 18 Strafkolonisten
10 Entsandte
142 Beamte mit ihren Familien
Insgesamt 2239 Menschen, in einer einzigen Anstalt.
Unwahrscheinlich, dass Helenas Eltern in dieser Liste nicht mitgezählt wurden. Im Melderegister von Norg war ihr Vater seit 1851 als wohnhaft in Veenhuizen verzeichnet. In Rotterdam als Teunis Gijben geboren, kam er mit gerade mal 19 Jahren in die Anstalt. War er ein Bettler und Vagabund gewesen, und wurde er deshalb in den Norden des Landes, nach Drenthe, zwangsverschickt? Helenas Mutter, Cato Braxhoofden, war drei Jahre vorher aus der Festungsstadt Namur, im späteren Belgien, in der Kolonie angekommen, kurz nach ihrer Gründung. Da war sie ganze dreizehn Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wie sie nach Drenthe gekommen war.
Nach meiner Rückkehr aus Veenhuizen fand ich in meiner Mailbox die Dokumentation des Projektleiters, dem ich bei der »Zweiten Anstalt« in die Arme gelaufen war. Es handelte sich um den zukünftigen Plan für ein Dorf, das bisher aus Den Haag verwaltet und finanziert worden war, und nun wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen sollte.
Ich war irritiert. Diese Geschichte Veenhuizens hatte kaum etwas mit der des Museumsführers gemeinsam. Kein Wort über Zwangsarbeit, militärische Zucht und Ordnung, enge Schlafkäfige oder Spuckmasken. Der Projektentwickler sprach nur von Idealen und den fortschrittlichen Ideen des Gründers von Veenhuizen, der den Armen eine menschenwürdige Zukunft bieten wollte. Die Bettlerkolonie sei ein Ort der »Sorge und des Respekts füreinander« gewesen, wo »soziale und wirtschaftliche Verantwortlichkeit für alles und von allen gelebt wurde«. Im einundzwanzigsten Jahrhundert könne man dieses Programm als Konzept für »Betreutes Wohnen für Heimatlose« betrachten. Zugegeben, das ist schon ein angenehmeres Bild. Mir fiel wieder |31|ein, dass die Anstaltsbewohner auch als Pfleglinge und die Kolonie manchmal als Asyl bezeichnet wurden. Vielleicht sollte man ja Veenhuizen wirklich besser als Zufluchtsort für Arme bezeichnen, die zum ersten Mal in ihrem Leben Aussicht auf ein menschenwürdiges Dasein hatten.
Offenbar hatte die Wahrheit mehrere Gesichter. Um die ganze Tragweite des Aufenthalts in einer solchen Armenanstalt ermessen zu können, musste ich zunächst wissen, worum es in diesem sozialen Experiment überhaupt ging. Nur so konnte ich erfahren, was das Leben in den Umerziehungsanstalten bei den zehntausenden bettelarmen, im Drenther Niemandsland zusammengepferchten Stadtbewohnern, angerichtet hatte. Auch bei meinen Vorfahren.