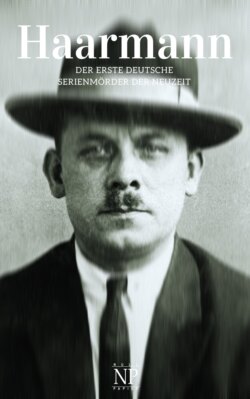Читать книгу Haarmann - Theodor Lessing - Страница 10
Ort und Zeit des Dramas
ОглавлениеHannover, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und der Mittelpunkt der niedersächsischen Lande, liegt an den letzten Ausläufern des deutschen Mittelgebirges, von welchem aus sich die norddeutsche Ebene mit ihren sandigen Kiefern- und Heidebezirken bis fern zur Nordseeküste hinabzieht. Das Flüsschen Leine, vom Eichsfelde kommend und die zwischen Harz und Weserbergen eingesenkte hügelige Mulde Göttingens durchfließend, erreicht unterhalb Elze, zwischen dem Hildesheimer Wald und dem Osterwald hervorbrechend, die kahle norddeutsche Ebene; von Hannover ab macht der Fluss einen Bogen nach Westen und mündet hinter Hudemühlen im Großen Moor. Das »Hohe Ufer«, dort wo der Fluss die Deisterbäche Ihme und Föße aufnahm und in schnellem Laufe die Altstadt durcheilt, hat wohl dem um 1050 zuerst erwähnten Ort den Namen gegeben: »Honovere«. – Eine Stadt im Grünen! Denn ein Waldgürtel, die Eilenriede genannt, 2500 Morgen weit, umzieht die Stadt in weitem Halbkreis und lässt nur nach Süden die Ebene offen, in welche sich die sogenannte Masch (oder Marsch) hineinschiebt, ein wasserreiches, sumpfiges Flachland, an dessen Rand wiederum Waldhügel, genannt Deister (von Dixter-Dichtwald), die Stadt umgrenzen. Wenige europäische Städte haben zwischen 1850 und 1900 so völlig ihr Antlitz verändert. Bis 1866 war Hannover die weltfern-vornehme Residenz der alten englischen Welfenkönige. In dem grünumbuschten Idyll der durch sechshundert Jahre träumenden Niedersachsenstadt schlugen die ersten Lerchen der deutschen Lyrik: Hölty und Bürger, sodann die Frühnachtigallen der Romantik: die Brüder Schlegel; hier grübelten Lichtenberg und Leisewitz, Detmold und Feder, und vor allem der wissensreichste deutsche Denker: Leibniz. Moritz und Iffland sind hier geboren, sowie Hartleben und Frank Wedekind. Als Hannover 1866 durch Bismarck für Preußen annektiert wurde, hatte die Stadt kaum 70.000 Einwohner. Aber in der Zeit nach dem siegreichen Krieg mit Frankreich, zwischen 1870 und 1873, in der sogenannten Gründerzeit, hielt die Industrie machtvoll Einzug, sodass die kleinen lieblichen Dörfer der Umgebung, Hainholz, Döhren, Limmer, List bald zu rußigen Fabrikvororten sich wandelten. Eine Technische Hochschule wurde gebaut; die Deisterkohle geschürft, und vollends änderte sich das Stadtbild, als der schiffbare Rhein-Weser-Leine-Kanal angelegt und in den großen »Mittellandkanal« überführt wurde, gleichzeitig aber die riesigen Kalischätze des Bodens rund um Hannover abgebaut zu werden begannen. Eine einzige Fabrikanlage, die sogen. »Continental«, welche sich mit dem Herstellen künstlichen Kautschuks beschäftigte, machte binnen weniger Jahre aus dem kleinen Vorort Vahrenwald ein fünfzehntausendköpfiges Proletarierviertel. Brauereien, Spinnereien, Wollwäschereien, die Maschinenfabriken von Gebr. Körting und Georg Egestorff und die sogen. Hanomag, eine Wagen- und Waggonfabrik wandelten das jenseits der Ihme gelegene Dorf Linden in eine Fabrikvorstadt von über hunderttausend Beamten- und Proletarierfamilien. Immerhin war diese Entwicklung zu Geldherrschaft und Werkertum, darunter die alte Adels- und Bauernkultur Niedersachsens erstickte, keineswegs ungewöhnlich. Sie war das allgemeine Wesensgepräge des wilhelminischen Deutschlands. Wahres Höllenchaos aber setzte ein, als dies preußische Machtreich zerbrach und eine an Töten und »Requirieren« gewöhnte, im fünfjährigen Weltkrieg verwilderte Jugend, alle Zucht und Form abschüttelnd, in die völlig armgewordene, ausgezogene Heimat zurückkehrte. 14 Millionen Tote! Im Osten Hungersnöte, welche ganze Länderstriche dahinrafften und schließlich dahin führten, dass Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern fraßen. Entartung, Verarmung, Verwirrung ohnegleichen. Das deutsche Geld auf dem Weltmarkt so entwertet, dass nur durch das immer neue Drucken und Hinausschleudern immer neuer wertloser Papierfetzen ein trostloses Scheinleben von Tag zu Tag gefristet wurde. In dieser sogenannten »Inflationszeit«, anhebend mit dem Zusammenbruch der deutschen Heere im Weltkrieg und den Stürmen der deutschen Revolution, begann die Bedeutung der Stadt Hannover als eines internationalen Durchgangs- und Schiebermarktes plötzlich zu wachsen. Die Stadt beherbergte um 1918 etwa 450.000 Menschen. Knapp vier Eisenbahnstunden von Berlin, Deutschlands großem Wasserkopf entfernt, knapp acht Stunden entfernt von Köln (wo damals Engländer-, Franzosen- und Belgierherrschaft begann), war Hannover der günstigste Mittelpunkt für das Tausch-, Schieber- und Transaktions-Geschäft, welches Tausende ernährte. Alle Welt lebte von Spekulation. Da Geld nichts mehr galt, und nur Sachwerte das Leben fristen konnten, so wurde aufgekauft, getauscht und gestohlen wie nie zuvor. Und zwischen Berlin, in welches der slawische, wendische, polnische, jüdische Osten einströmte, Amsterdam, wo viel Reichtum abfloss nach Holland und England und endlich Köln, welches nach Belgien und Frankreich die Brücke schlug, lag Hannover aufs günstigste in der Mitte, sodass sich hier aufzutun vermochten hundert neue Gründungen, hundert neue Vergnügungs- und Lasterstätten, die ein schlimmes Händler-, Schieber-, Parasiten- und Schmarotzervolk ins Land brachten, langsam zerfressend die alte bürgerliche Tüchtigkeit und ehrenfesten Solidität der (wie ein großer Dichter sie nannte) »fahlsten unserer Städte«.
An drei Stellen der Stadt erhob sich ein Gauner-, Hehler- und Prostitutionsmarkt ohnegleichen, dessen die Behörden nicht mehr Herr wurden. Zunächst im Bahnhof und auf den ihn umgebenden Plätzen. Hier wurde in der schweren Brotmarkenzeit, wo man Brot, Fleisch und Milch nur in kleinsten Rationen gegen teures Geld und nach stundenlangem »Schlangenstehn« erhalten konnte, unter der Hand ein schwunghafter Handel mit gestohlenem und heimlich geschlachtetem Nutzvieh, auch mit Kaninchen, Ziegen, Hunden und Katzen, mit Kartoffeln, Mehl und mit allerhand gepaschter und verschobener Ware getrieben; vor allem aber mit Kleidern, Wäsche und Schuhen. Hier versammelten sich allnächtlich in den Wartesälen viele Obdachlose, Arbeitslose, Hungrige und Entgleiste.
Geht man vom Bahnhof aus die breite Baumallee der Bahnhofsstraße entlang, so gelangt man nach wenigen Minuten in die Georgstraße, die Herzader der Stadt. Ein weiter Boulevard, lindenüberblüht, voller Beete, Gartenanlagen, Pavillons und Denkmäler. Und dort zwischen dem alten berühmten Hoftheater und den schönen Gartenanlagen des sogenannten Café Kröpcke befand sich um 1918 ein zweites Zentrum der Sittenlosigkeit: der »Markt der männlichen Prostituierten«, deren 500 damals in den Polizeilisten eingeschrieben standen, indes der Kriminaloberinspektor die Gesamtzahl der sogenannten Homosexuellen in Hannover auf nahezu 40.000 veranschlagte. Sie bildeten eine eigene kleine Welt. In einem der schönsten Lokale der Kalenberger Vorstadt, dem sogen. Neustädter Gesellschaftshaus veranstalteten sie Gesellschaftsabende und Bälle, bei denen Knaben und Jünglinge in weiblicher Ballkleidung den Damenflor vertraten. Ein zweiter minder vornehmer Treffpunkt war der alte Ballhof, ein Barocksaal aus der Königs- und Kurfürstenzeit. Und für die allerunterste Schicht gab es in einer der ältesten und verrufensten Straßen der Altstadt, welche »Neue Straße« heißt, ein kleines Tanzlokal, genannt »Zur schwulen Guste«, wo nur auf ein bestimmtes Zeichen hin zugelassen, lesbische Mädchen und gleichgeschlechtlich gerichtete Männer nachts zusammenkamen. Aber das dritte Hauptzentrum alles Luder- und Lasterlebens war die malerische Altstadt, dort wo der Fluss an dem sogenannten Hohen Ufer entlang eine von vielen Brücken überquerte, als »Klein-Venedig« bekannte, uralte Inselstadt bildet: Verfallene Winkel, Jahrhunderte altes Gemäuer, ein trotziger altsächsischer Beguinenturm und ein Gewirr von Giebeln, Fachwerk und baufälligen, noch ans Mittelalter mahnenden Gassen, aus deren Mitte jene Kirche ragt, in welcher Leibniz begraben liegt, sowie der auf dem »Berge«, einer plangemachten Rampe, erbaute maurische Judentempel. Dieser Stadtteil, unmittelbar benachbart dem vom Strom bespülten mächtigen Schloss der Welfen, war einst der vornehmste Stadtteil, ist aber im Lauf der Zeiten, ähnlich der Umgebung des Berliner Schlosses, zum ärmsten Kaschemmen- und Verbrecherviertel herabgesunken. Gleich dem alten Hildesheim, Braunschweig und Goslar das Entzücken für jedes schönheitsuchende Auge, wurde dieses älteste Hannover die Brutstätte lichtloser, armutgelber, in Verfall und Moder atmender, zum Unglück verfluchter Geschlechter. –
Die »Neue Straße« mit dem einstigen Wohnhaus des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig, dem späteren Armenhaus, zieht sich entlang der steilen Uferhöhe des Flusses. Die Hinterwände ihrer dreihundertjährigen Häuser, ihre Erker und Balkone stürzen jäh hinab in den Fluss, über dessen Ufern die grünumbuschten armen Höfe und rührend bescheidenen Gärtchen schweben. Nicht weit davon, dem Judentempel gegenüber, liegt die sogenannte »Rote Reihe«; eine Gruppe müder, einander kaum noch stützender morscher Häuser, in deren einem (dem Mordhaus benachbart) einst der Elektrotechniker Rühmkorff die Induktionselektrizität entdeckte. In diesem schmutzigen Häusergewirr, auf den seit Jahrhunderten ausgetretenen elenden Holzstiegen, in Verschlägen, mehr Käfigen gleich, nur durch dünne Tapetenwände oder Bretterverschläge voneinander abgetrennt, hausten in Deutschlands Elendszeit die Ärmsten der Armen. Die aus dem großen Kriege übriggebliebene Jugend hatte die Lehre begriffen, dass man um eines Rockes, um eines Paar Stiefel willen den Feind töten darf. Und »Feind« ist jeder andere. Auf der »Insel« war Diebesbörse und Hehlermarkt. Hier wurde (in der Sprache dieser Hinterwelt geredet) allabendlich geküngelt und gekütchebücht. Hier wurde Schores geschoben (d.h. Diebesware verhandelt), wurde Rebbes gemacht, wurde manche »heiße Sache gedreht«. Abends, wenn der Mond hing über den morschen Dächern und grauen Schloten und den gespenstigen schwarzen Fluss versilberte, kam die schwere, dürre, zermürbte, zerarbeitete Leidensmenschheit aus ihren alten Kästen hervor und hing und hockte über der stinkenden Lagune, auf der alten Brücke: arme, sorgenschwere, kinderreiche Mütter, müdegewordene, früh verstumpfte Männer. Und dazwischen wimmelte lebensgierig das junge Volk; die Unzahl der Gassendirnen und ihrer Zuhälter, »Nepper«, »Strezer«, »Schoresmacher«, die in der »Kreuzklappe«, im »Kleeblatt«, im »Deutschen Hermann« manche Missetat baldowerten, während die rätselhaften Sterne glitzerten im dunklen Wasser des in sich selbst versumpfenden Stromes.