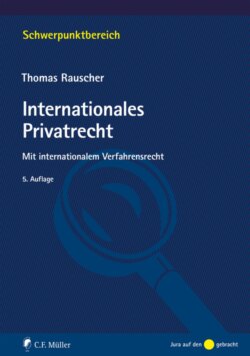Читать книгу Internationales Privatrecht - Thomas Rauscher - Страница 10
I. Begriff des IPR
Оглавление1
Wer sich noch nicht mit Internationalem Privatrecht (IPR) befasst hat, könnte der irrigen Meinung sein, vor deutschen Gerichten werde immer deutsches Recht angewendet.
1. Art. 3 letzter Hs.[1] geht aber offenbar von der Möglichkeit der Anwendung einer ausländischen Rechtsordnung vor deutschen Gerichten aus. Damit stellt sich die der materiellen Rechtsanwendung vorgelagerte Frage:
Welche aus den zahlreichen in der Welt geltenden Rechtsordnungen beherrscht den konkret zu entscheidenden privatrechtlichen Sachverhalt?
Diese Auswahl zu treffen ist Aufgabe des IPR. IPR ist damit ein Teilbereich des Kollisionsrechts. Kollisionsrecht entscheidet den Sachverhalt nicht in der Sache selbst. Es bestimmt bei Zusammentreffen mehrerer zur Entscheidung eines Sachverhalts in Betracht kommender Rechtsordnungen, welche materiellen Normen anzuwenden sind. IPR ist innerhalb der verschiedenen Kollisionsrechte dasjenige Recht, das bei Zusammentreffen der Rechtsordnungen verschiedener Staaten das anwendbare Recht auswählt.
Verstarb ein österreichischer Staatsangehöriger 2014 an seinem letzten Wohnsitz in München, so ist nicht ohne weiteres klar, ob sich die Beerbung nach österreichischem oder deutschem Erbrecht beurteilt. Hinterlässt er Vermögen in Luxemburg und der Schweiz, könnte man auch an diese Rechtsordnungen denken. War er mit einer Italienerin verheiratet, so stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Einfluss des Ehegüterrechts. Das IPR (hier Art. 25 aF [bei Erbfall ab 17.8.2016 die EU-ErbVO] und Art. 15) bestimmt die maßgeblichen Rechtsordnungen.
2
Dabei können in einem Sachverhalt in natürlicher Sichtweise (zB die Rechtsbeziehungen in einer Ehe oder die Vermögensabwicklung eines verheirateten Erblassers) auch verschiedene Rechtsordnungen auf unterschiedliche Sachfragen (Eheschließung, Ehegüterrecht, Ehescheidung, Erbrecht) anzuwenden sein.
3
2. Das Rechtsverständnis in Kontinentaleuropa (zu anderen Ansätzen Rn 18 ff) geht also davon aus, dass weder durchweg die Anwendung des Rechts des angerufenen Gerichts (lex fori) angebracht ist, noch inländische Gerichte und Behörden nur über solche Fälle zu entscheiden haben, die deutschem Recht unterliegen. Deshalb trennt das deutsche Recht nahezu vollständig die – dem Internationalen Zivilverfahrens- oder Zivilprozessrecht zugewiesene – Frage der Internationalen Zuständigkeit zur Entscheidung eines Sachverhalts von der dem IPR zugewiesenen Frage, welches Recht hierbei anzuwenden ist. Auch die zunehmend deutsches IPR ersetzenden EU-Regelungen des IPR folgen diesem Ansatz der Trennung von IPR und Internationaler Zuständigkeit.
4
3. Art. 3 setzt für die Anwendung des deutschen IPR eine „Verbindung zu einem ausländischen Staat“ (Auslandsbezug) voraus. Die Feststellung eines solchen Auslandsbezugs ist aber nicht technisch-tatbestandliche Voraussetzung für die Anwendung von Normen des IPR, er hat gegenüber den Anknüpfungskriterien, die in den Kollisionsnormen, zB Art. 7 ff, die Verbindung zum anwendbaren Recht beschreiben, keine eigenständige Filterfunktion. Erst die Anwendung der Normen des IPR zeigt, ob in dem Fall auf bestimmte Sachfragen ein ausländisches Recht angewendet wird. Theoretisch lässt sich das deutsche IPR daher auf jeden im Inland zu entscheidenden Sachverhalt anwenden und führt in „reinen Inlandsfällen“ zwangsläufig zur Anwendung deutschen Rechts. Kein vernünftiger Rechtsanwender wird nun aber jeden Inlandsfall mit einer schematischen, offensichtlich überflüssigen IPR-Prüfung beginnen. Ob man – in Klausur oder Praxis – das IPR tatsächlich prüft, hängt daher nicht von einem als Tatbestandsmerkmal definierten, sondern einem nur mit einiger Erfahrung intuitiv festgestellten Auslandsbezug ab. Ein solcher Auslandsbezug besteht dann, wenn der Sachverhalt irgendwelche möglicherweise für das IPR relevante Elemente enthält, die auf einen ausländischen Staat hinweisen (Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Aufenthalt eines Beteiligten, Belegenheit betroffenen Vermögens, Währung bei Schuldverträgen, Vertragsschluss-, Handlungs- oder sonstige Ereignisorte); liegt auch nur ein solches Element vor, wird man sinnvoller Weise das IPR prüfen, um eine unzutreffende Fallbehandlung durch Übergehen des IPR zu vermeiden. Die richtige Anwendung des IPR auf einen „reinen Inlandsfall“ kann jedenfalls nicht zu einer falschen Falllösung führen.
Verpachtet eine in Delaware (USA) gegründete Gesellschaft eine in Hamburg belegene Gaststätte an einen Deutschen, so besteht jedenfalls hinsichtlich der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft ein Auslandsbezug, auch wenn die kollisionsrechtliche Prüfung des Vertragsstatuts zu deutschem Pachtrecht führen kann.
5
4. Diese Prüfung des IPR nimmt das Gericht, sobald ein Auslandsbezug in Betracht kommt, von Amts wegen vor. Auf die Anwendung ausländischen Rechts muss sich keine Partei berufen.[2]