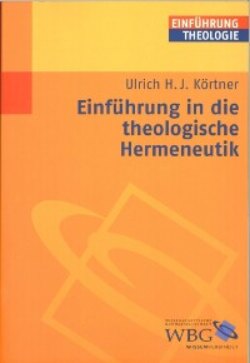Читать книгу Einführung in die theologische Hermeneutik - Ulrich Körtner - Страница 11
c) Nicht-hermeneutische Interpretationstheorien
ОглавлениеSynchrone und diachrone Interpretation
Gleichwohl haben sich im 20. Jahrhundert Interpretationstheorien etabliert, die man als nicht-hermeneutisch bezeichnen kann, weil sie eine entscheidende Voraussetzung hermeneutischen Denkens nicht teilen: den Gedanken der radikalen Historisierung aller erkenntnistheoretischen Bedingungen von Verstehensprozessen. Odo Marquard bezeichnet die Gegenspieler der Hermeneutik als „Code-Knacker“ und versteht darunter vor allem Kommunikationstheorie und Semiotik (41: 134ff.). Linguistik, Semiotik und Kommunikationstheorie entwickeln eine konsequent synchrone Betrachtungsweise menschlicher Kommunikations- und Verstehensprozesse. Sie blenden die diachrone Betrachtungsweise, welche für die historischen Geisteswissenschaften und die Hermeneutik grundlegend ist, konsequent aus. Das gilt letztlich auch für die Sprachspieltheorie des späten Wittgenstein, selbst wenn sich zwischen ihr und der philosophischen Hermeneutik Gadamers eine positive Beziehung herstellen läßt. Auch Wittgenstein kann „das eigentlich geschichtliche des Verstehens, die Vermittlung zwischen den zerfallenden und entstehenden Sprachspielen (das normale Phänomen der Traditionsvermittlung) und wiederum die Vermittlung über die Zeiten hinweg, die Wiederbelebung und Aneignung der Vergangenheit in die gegenwärtige Lebensform hinein mit seinem Denkmodell nicht eigentlich fassen, sondern allenfalls von ihm her konzedieren“ (3: 87).
In synchronen Theorien menschlicher Kommunikation spielt der Begriff des Codes eine Schlüsselrolle. Für Marquard verweist sein Begriffsfeld auf „die Optik des Dechiffrierers“, der sich z. B. in der Spionage mit einer „Geheimsprache“ konfrontiert sieht, die er selbst zunächst nicht spricht und nicht kennt (41: 137). Während die Beobachterperspektive synchroner Sprachtheorien letztlich unverständliche oder unverständlich gewordene Welt unterstellt, geht das hermeneutische Denken davon aus, daß wir zwar niemals alles, aber auch niemals gar nichts verstehen. Verstehen ist nur möglich, wie und soweit wir schon etwas verstanden haben. Eben das meint bei Heidegger und Gadamer das Vorverständnis oder Vorurteil: die Situation der immer oder doch irgendwie schon – und sei es in aller Vorläufigkeit – verstandenen Sprache, Textwelt oder Sozialwelt. Hermeneutik ist erklärtermaßen zirkulär. Sie setzt voraus, was doch ihr Ziel ist: gelingendes Verstehen. Eine antihermeneutische Theorie des Verstehens, welche diesen Zirkel durchbrechen möchte, gerät jedoch in einen Widerspruch, weil es keinen Weg vom radikalen Nichtverstehen zum Verstehen gibt. Auch vernachlässigt das Verständnis von Sprache als Code, daß nicht nur Worte, sondern auch Grammatiken eine Geschichte haben. Im Sinne Wittgensteins ist die Bedeutung von Worten ihr Gebrauch in der Sprache, der in eine soziale Praxis eingebettet ist. Diese aber ist stets eine geschichtlich gewordene und bedingte.
Die Stärken der Hermeneutik gegenüber nichthermeneutischen Interpretationstheorien sprechen jedoch nicht grundsätzlich gegen synchrone Theorien des Verstehens. Vielmehr kommt es darauf an, diachrone und synchrone Verstehenstheorien sinnvoll miteinander zu verbinden. Anschlußmöglichkeiten gibt es dafür beispielsweise in der Semiotik Umberto Ecos, der ausdrücklich die Seinsfrage erörtert, die im Zentrum der hermeneutischen Phänomenologie Heideggers steht. Auch wenn er Heideggers Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem als unnötige sprachliche Verdopplung zurückweist, erkennt Eco doch einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen Sein und Sprache: „Das Sein, insofern es denkbar ist, zeigt sich von Beginn an als eine Wirkung von Sprache. Sobald es vor uns steht, erzeugt das Sein Interpretationen; sobald wir über es sprechen können, ist es bereits interpretiert. Andere Möglichkeiten gibt es nicht“ (18: 33). Die Sprache wiederum „konstruiert das Sein nicht ex ovo: Sie befragt es, und sie findet immer und in irgendeiner Weise etwas Vorgegebenes“ (18: 69). Vattimo formuliert als hermeneutisches Prinzip, daß es nicht Fakten gibt, sondern nur Interpretationen. Das schließt nach Eco freilich nicht aus, „daß man sich fragen kann, ob es nicht möglicherweise auch ,schlechte‘ Interpretationen gibt“ (18: 62). Eco spricht an dieser Stelle von „Tendenzlinien“ bzw. von „Resistenzlinien“, was besagt, „daß die Wirklichkeit unserem Erkennen nur in dem Sinn Einschränkungen auferlegt, als sie falsche Interpretationen ablehnt“. Man könnte auch sagen, daß Eco die Aufgabe der Kritik einmahnt, die schon bei Schleiermacher neben der Hermeneutik ihren Aufgabenbereich hat.
Synthese von Hermeneutik und Semiotik
Tatsächlich gibt es heute unterschiedliche Versuche einer Synthese von Semiotik und Hermeneutik. So plädiert beispielsweise Eberhard Hauschildt zugleich für eine deutliche Eingrenzung des Geltungsanspruchs wie für eine Ausweitung ihres Gegenstandsbereichs. Wie bei Schleiermacher die Kritik ihren Geltungsbereich neben Grammatik und Hermeneutik hat, die beide zusammengehören wie Verstehen und Beurteilen, eröffnet die Hermeneutik eine Zugangsweise zur Wirklichkeit neben anderen. Sie ist bei Schleiermacher auch keineswegs identisch mit Erkenntnistheorie überhaupt oder die Basis der Geisteswissenschaften, sondern „eine Anleitungslehre“, die der Wissenschaftspraxis des Verstehens dient, ohne selbst Erkenntnistheorie zu sein“ (476: 84f.). Mag Hermeneutik dabei ihren Ausgangspunkt beim Problem des Textes nehmen, wie es Paul Ricœur vorschlägt, so hat sie es doch nicht nur mit der Interpretation von Texten zu tun, „sondern mit den fixierbaren Verwendungen aller Zeichencodes. So steht Hermeneutik heute im Geviert von Grammatik, Kritik, Semiotik und Phänomenologie“ (476: 85). Die Verbindung von Hermeneutik und Semiotik führt dazu, daß die phänomenologische Beschreibung und Deutung von Wirklichkeit konsequenter, als es in der Phänomenologie meist der Fall ist, auf fixierbare Äußerungen zurückgeführt werden, wodurch die intersubjektive Kontrolle an der Oberflächenerscheinung von Phänomenen ermöglicht wird. Die Beziehung auf konkrete empirische Phänomene verbindet die Hermeneutik mit Grammatik und Semiotik, doch bringt sie diesen strukturalen Wissenschaften gegenüber „gewollt in die allgemeinen Systeme die Kreativität im Moment der Interpretation ein – entschiedener auch, als solche Vertreter der Semiotik das tun, die sich für das Problem der Abduktion zwischen Deduktion und Induktion interessieren“ (ebd.). In diesem Sinne zeichnen sich Möglichkeiten ab, falsche Alternativen zwischen Hermeneutik und Semiotik zu überwinden, ohne die Gegensätze oder Spannungen zwischen diachronen und synchronen Theorien der Interpretation leugnen zu wollen.